Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
Ihr 18% Rabatt11 auf ausgewählte Eurographics Puzzles mit dem Code PUZZLE18
Jetzt einlösen
mehr erfahren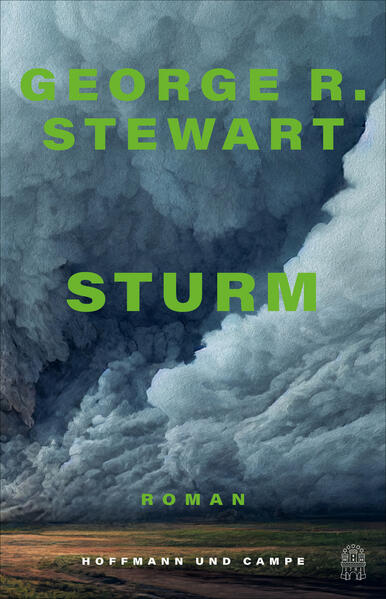
Zustellung: Di, 25.02. - Do, 27.02.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Kalifornien wird seit Monaten von einer verheerenden Dürre geplagt, als ein Schiff aus dem fernen westlichen Pazifik eine ungewöhnliche Messung meldet. Ein junger Meteorologe in San Francisco nimmt die Anomalie zur Kenntnis und tauft sie insgeheim Maria.
Mit rasanter Geschwindigkeit wächst Maria zu einem gewaltigen Sturm heran, entwickelt ein Eigenleben und bahnt sich ihren Weg von der Pazifikküste in die Sierra Nevada und darüber hinaus. Meteorologen, Schneepflugfahrer, ein General, ein Liebespaar und eine unglückliche Eule verfolgen Marias zerstörerischen Weg durch die USA mit ebenso großer Sorge wie Faszination. Der Sturm fegt durch die Staaten, bringt lang ersehnten Regen, überflutet Täler, vergräbt ganze Bergketten im Schnee, und macht den Menschen unbestreitbar bewusst, wie sehr das Wetter ihr Leben bestimmt.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Die Figuren dieses [. . .]
Widmung
Inhalt
Vorwort des Autors
Motto
Erster Tag
Zweiter Tag
Dritter Tag
Vierter Tag
Fünfter Tag
Sechster Tag
Siebenter Tag
Achter Tag
Neunter Tag
Zehnter Tag
Elfter Tag
Zwölfter Tag
Nachwort
Über George R. Stewart
Impressum
Titelseite
Die Figuren dieses [. . .]
Widmung
Inhalt
Vorwort des Autors
Motto
Erster Tag
Zweiter Tag
Dritter Tag
Vierter Tag
Fünfter Tag
Sechster Tag
Siebenter Tag
Achter Tag
Neunter Tag
Zehnter Tag
Elfter Tag
Zwölfter Tag
Nachwort
Über George R. Stewart
Impressum
Produktdetails
Erscheinungsdatum
07. Januar 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
382
Autor/Autorin
George R. Stewart
Übersetzung
Jürgen Brôcan, Roberta Harms
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
460 g
Größe (L/B/H)
211/140/34 mm
ISBN
9783455018721
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Sturm liest sich wie ein amerikanischer Katastrophenfilm der Siebzigerjahre. « Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
»George R. Stewart würdigt das Faszinosum Wetter literarisch auf einzigartige Weise. « Christoph Ohrem, WDR 5 Bücher
»Die Neuübersetzung von Jürgen Brôcan und Roberta Harms zeigt, dass Stewarts Werk auch 84 Jahre später nichts an seiner Aktualität eingebüßt hat. « Oliver Nowack, WDR 3 »Kultur am Mittag«
»Der Klassiker von 1942 in angemessener kraftvoller Neuübersetzung. « Focus
»Meteorologie ist keine Poesie, aber solche Präzision hat durchaus poetische Wirkung. « Wieland Freund, Welt am Sonntag
» Sturm ist ein ungewöhnlicher Roman über Mut und Opferbereitschaft, den zu lesen sich lohnt. « Doris Kraus, Die Presse online
»Fesselnd! Ein Klassiker! « Peter Pollack, Kultbote. de
»Ein fesselndes Werk über die unberechenbare Macht der Natur und die Menschen, die ihr trotzen. « Mit Liebe
»Nicht nur angesichts der sich abzeichnenden Klimakatastrophe ist Sturm ein moderner Roman, dessen Alter von über 80 Jahren man ihm kaum anmerkt. « Blog: Buch-Haltung
»Die Lektüre hat an Aktualität nichts verloren und zeigte auch schon damals, wie der Mensch der Natur unterlegen ist und Gefahren unterschätzt. « Instagram: @meineliteraturwelt
»George R. Stewart würdigt das Faszinosum Wetter literarisch auf einzigartige Weise. « Christoph Ohrem, WDR 5 Bücher
»Die Neuübersetzung von Jürgen Brôcan und Roberta Harms zeigt, dass Stewarts Werk auch 84 Jahre später nichts an seiner Aktualität eingebüßt hat. « Oliver Nowack, WDR 3 »Kultur am Mittag«
»Der Klassiker von 1942 in angemessener kraftvoller Neuübersetzung. « Focus
»Meteorologie ist keine Poesie, aber solche Präzision hat durchaus poetische Wirkung. « Wieland Freund, Welt am Sonntag
» Sturm ist ein ungewöhnlicher Roman über Mut und Opferbereitschaft, den zu lesen sich lohnt. « Doris Kraus, Die Presse online
»Fesselnd! Ein Klassiker! « Peter Pollack, Kultbote. de
»Ein fesselndes Werk über die unberechenbare Macht der Natur und die Menschen, die ihr trotzen. « Mit Liebe
»Nicht nur angesichts der sich abzeichnenden Klimakatastrophe ist Sturm ein moderner Roman, dessen Alter von über 80 Jahren man ihm kaum anmerkt. « Blog: Buch-Haltung
»Die Lektüre hat an Aktualität nichts verloren und zeigte auch schon damals, wie der Mensch der Natur unterlegen ist und Gefahren unterschätzt. « Instagram: @meineliteraturwelt
 Besprechung vom 05.01.2025
Besprechung vom 05.01.2025
Warum Sturmtiefs weiblich sind
In "Sturm" erzählte George R. Stewart vor 80 Jahren, was es heißt, kollektiv zu handeln. Und der Wissenschaft zu vertrauen.
Vor ein paar Jahren forderte die "Zeit" in einem Leitartikel lautstark eine klimabewusste Literatur: Romane also, die sich dem allerdrängendsten Anliegen der Gegenwart widmen, der Erderwärmung mit all ihren Folgen. Das wurde direkt zurückgewiesen - entweder, weil es solche Romane längst gab, auch auf Deutsch, oder weil so eine Politisierungsquote nicht zur Freiheit der Literatur passe. Inzwischen ist die Klimaerwärmung als Stoff erzählender Literatur in allen Verlagsprogrammen präsent. Gleichzeitig beginnt so etwas wie eine retrospektive Kanonbildung der Katastrophe: die Suche nach Romanen aus der Literaturgeschichte, die schon früh zur Sprache brachten, was jetzt alle brennend interessieren sollte. Eine Art von Aufwertungsversuch, denn wenn so ein Stoff von heute auch eine Geschichte hat, erscheint es noch legitimer, ihn zu erzählen.
Zu dieser Geschichte und zur Kanonbildung gehört "Sturm", der dritte Roman des amerikanischen Autors George R. Stewart (1895-1980). Stewart war Professor für Englische Literatur an der Universität Berkeley (Spezialgebiet Namenskunde) und so etwas wie der Frank Schätzing oder vielleicht besser: der Bernhard Kegel seiner Zeit. Er schrieb Wissenschaftsthriller über Seuchen und Naturkatastrophen. Sein berühmtestes Werk, "Earth Abides" von 1949, wurde gerade eben auch als Serie verfilmt und gehört zum Letzter-Mensch-auf-Erden-Genre, es lässt sich als hellsichtiger Schlüsselroman für die Corona-Pandemie lesen, weil darin ein Virus die Zivilisation auf den Nullpunkt bringt.
"Sturm" von 1942 erscheint jetzt zum dritten Mal auf Deutsch, übersetzt von Jürgen Brôcan und Roberta Harms, die Stewart in ihrem Nachwort "einen ungeheuren Weitblick" bescheinigen, "der heute an Brisanz noch einmal zugelegt hat. Das Klima ist selbstverständlich nicht regional oder national begrenzt, sondern es entsteht global."
"Sturm" erzählt von zwölf Tagen im Leben eines extremen Wetterereignisses in einem Winter um 1940. Und auch wenn der Hauptschauplatz der amerikanische Westen ist, wandert der Blick tatsächlich immer wieder über die Grenzen des Kontinents hinaus. Die Hauptfigur der Geschichte ist der Sturm selbst - wie er sich aufbaut, zuschlägt, das Land in Regen und Schnee eindeckt und sich schließlich wieder in Luft auflöst. Wir sehen dem Sturm dabei aus den Augen der Menschen zu, die ihn begleiten, erforschen, erleben und zu verstehen versuchen. Die meisten sind Männer, sie arbeiten in Wetterstationen, im Straßenverkehrsdienst, bei der Polizei und in der Armee. Der Sturm aber trägt einen Frauennamen: "Maria". Ein junger Meteorologe hatte ihn so getauft, nach seiner Ex-Freundin. Wie Brôcan und Harms es in ihrem Nachwort erklären, ließ sich der National Weather Service in der Wirklichkeit von Stewarts Roman inspirieren: Sie gaben Tiefs ab 1953 weibliche Vornamen.
"Sturm" liest sich wie ein amerikanischer Katastrophenfilm der Siebzigerjahre, wie "Erdbeben" mit Charlton Heston in der Hauptrolle: ganz normale Menschen, die ihrem Alltag nachgehen, in die Bank fahren, im Diner bedienen, ein paar Techniker, die langsam merken, dass sich da was anbahnt, und sich gegen das Unheil stemmen, als es losbricht. Nur dass es diesen einen Helden, wie ihn Heston in "Erdbeben" gespielt hat, auch eine kalifornische Geschichte, bei Stewart nicht gibt. Im Gegenteil, der Reiz dieses achtzig Jahre alten Romans - und vor allem seine Gegenwärtigkeit - liegt darin, wie er eine kollektive, forschungsbasierte Reaktion auf Naturereignisse beschreibt. Daten sammeln, studieren, auswerten, Karten zeichnen, Maßnahmen justieren, das Richtige tun. Nicht auf Beschwichtigungen oder Durchhalteparolen setzen, auf gefühltes Erfahrungswissen oder Bauernweisheiten: "Im Englischen heißt es noch heute: 'Rain before seven, / Clear before eleven.' In anderen Sprachen sagt man derartigen Unsinn nicht - nicht, weil man schlauer ist, sondern weil diese Zahlwörter sich dort nicht reimen."
Eine seltene Stelle von Humor. Sonst ist George R. Stewart eher der Typ Epiker: "Eine stolze Stadt, auf Hügeln errichtet, perlgrau in der Wintersonne, von Rauch und Staub gereinigt durch einen steten Wind vom Meer. Eine Stadt, letzte Wächterin im Westen, die hinausblickt auf weites Gewässer, wo der Westen am Ende zum Osten wird, ein Raum, so weit, als könne er die Zeit, die uralte, überwinden und den Kalender dazu bewegen, einen Tag zu verlieren." Doch so elegisch der Ton ist, den Stewart für seinen Roman gewählt hat, so weit er darin auch immer wieder zurückgreift auf die Menschheitsgeschichte, auf Mythen und Sagen: Wenn "Sturm" etwas feiert, dann ist es Sachlichkeit. Das nation building der Sekundärtugenden. Den zivilen Dienst an der Gesellschaft. Im Katastrophenfilm würde so eine Haltung eher von einem Kopfmenschen wie Tom Hanks verkörpert als von einem Kraftpaket wie Charlton Heston.
Aber wie gesagt, in "Sturm" gibt es gar keine Helden und auch keinen Bedarf danach, und das unterstreicht der Namenskundler Stewart mit einer einfachen erzählerischen Entscheidung. Der "Chef", der "Junior-Meteorologe", der "Oberstraßeninspektor": Die Figuren in diesem Roman tragen keine Namen, außer Maria, natürlich, der Sturm selbst, der am Ende einige Menschen das Leben gekostet haben wird, der aber dann wieder verschwindet, bis er, in anderer Gestalt, unter anderem Namen, wiederkommt. Kollektives Handeln selbstbewusster, aufgeklärter Individuen, darum geht es in diesem Buch. Und darum, der Unbestechlichkeit und Selbstskepsis der Wissenschaft zu vertrauen.
Ganz am Anfang betritt der "Chef" sein Wetteramt in Kalifornien und sieht auf das Dach hinaus, wo seine Kollegen in diesem Moment die Instrumente ablesen: "Überall schauten in dieser Minute die Beobachter in den Wetterstationen auf die Thermometer und Barometer und blickten in den Himmel, um zu prüfen, wie stark wolkenverhangen er war. Unvermittelt stellte er sich sämtliche Beobachter überall auf der Welt vor. In Paris und London lasen sie die Instrumente ab und hatten noch viel Zeit bis zum Mittagessen. In Rio war es neun Uhr morgens, in New York sieben Uhr. Hier an der Pazifikküste wälzten sich die Männer zu einer überaus lästigen Stunde schläfrig aus dem Bett. In Alaska war es allerdings schlimmer. In Neuseeland blieben die Beobachter um diese Zeit höchstwahrscheinlich noch auf, bis sie ihre Instrumente abgelesen hatten, und gingen erst danach zu Bett."
Der Chef spürt in diesem Moment "aufkeimenden Stolz auf den eigenen internationalen Beruf, in dem man gegen Naturgewalten kämpfte, nicht gegen seine Mitmenschen". Als "Storm" 1941 erschien, im Jahr des Kriegseintritts der Vereinigten Staaten, und kurz darauf und dann ein zweites Mal 1950 auf Deutsch übersetzt wurde, wird man die Geschichte realpolitischer gelesen haben als heute, aber am Ende beim gleichen Ergebnis herausgekommen sein: kollektives, aufgeklärtes Handeln als Gebot der Stunde. TOBIAS RÜTHER
George R. Stewart, "Sturm". Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Jürgen Brôcan und Roberta Harms. Hoffmann und Campe, 384 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 16.02.2025
Ein literarisches Kunstwerk!
**** Worum geht es? ****
Maria ist ein Sturm, der nicht nur verschiedene Orte miteinander verbindet, sondern auch unterschiedlichste Persönlichkeiten. Die Natur, der Mensch eine Symbiose. Damals wie heute.
**** Mein Eindruck ****
Stewart hat mit diesem Werk einmalige Literatur erschaffen, die den Menschen in seine Grenzen weist und unsere ewige Verbundenheit mit der Natur zur Schau stellt. Die Ereignisse und das Geschehen fühlen sich aus heutiger Sicht für mich noch nahbarer an als in den 1940er Jahren. Die Neuveröffentlichung trifft einen wunden Punkt. Sprachlich ist das Buch für mich ein Meisterwerk. Die Bilder, die Stewart erschafft, klingen nach. Meine größte Kritik an diesem Werk ist die Verfehlung der heutzutage relevanten Schnelllebigkeit. Momente treffen aufeinander und werden zunächst in keinem direkten Zusammenhang gestellt etwas, das wir heute dringend benötigen, um überhaupt der Botschaft zu lauschen. Anstatt Spannung und Neugier zu empfinden, fühlt man sich weitestgehend vom Belanglosen erschlagen, es sei denn, man hat die Freude, den Text literarisch auseinanderzulegen. Das Nachwort ist wirklich gelungen und bildet in Summe mein Leseempfinden ab. Um mit dem Werk eine breitere Leserschaft zu erreichen, hätte hier für mein Empfinden mehr am Original gearbeitet werden müssen. Die Frage ist am Ende, ob man das überhaupt möchte. Die, die es lesen, werden es zu schätzen wissen, denn ein personifizierter Sturm spricht wohl eher die Minderheit der Leserschaft an.
**** Empfehlung? ****
Kurzum: Fans von ausufernder Literatur und metaphorischen Bildnissen werden mit diesem Klassiker große Freude haben. Alle anderen wohlmöglich eher weniger.
LovelyBooks-Bewertung am 03.02.2025
Wir sind dabei wie ein Sturm geboren ist, wie sich entwickelt, wie tobt und wie sterbt, ein Klasse Buch wenn jemand Interesse auf die meteorologische Fakten hat. Eigentlich hier passiert nicht viel, der Handlung ist sehr karg und trotzdem für mich was echt spannend zum lesen wie der Sturm entsteht und welche Auswirkungen auf das Leben von unterschiedlichen Menschen Hat. Natürlich die viele meteorologische Fakten können ermüdend sein, für mich jedoch war die Portion gut, habe viel neues über Wetter erfahren.Der Schreibstil ist flüssig und die kurze Kapiteln mit abwechselnden Perspektiven sorgen für schnelle lesen , die Personen hier bleiben irgendwie hier am Rand von die Geschichte, nur die Meteorologen sind mehr präsent. Eine Geschichte welche viel von ein Sachbuch hat aber mit spannenden , langsam sich entwickelten Lesestrudel , für mich eine fesselnde Geschichte wo die Realität mit die Fiktion sehr gut verbunden ist









