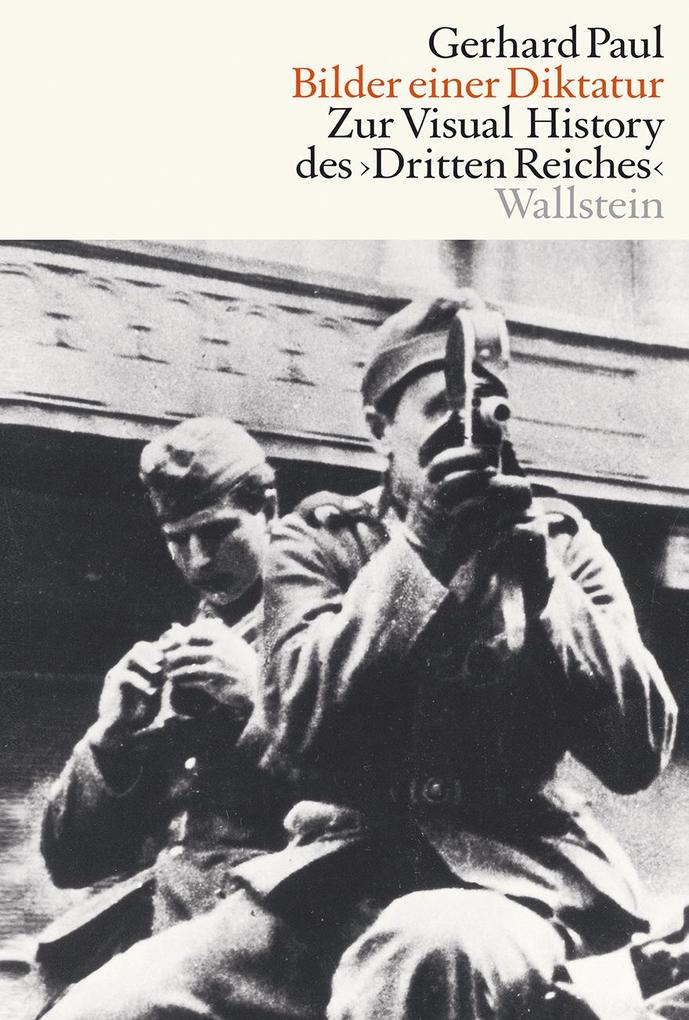
Zustellung: Sa, 26.04. - Di, 29.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Überraschende und ungewöhnliche Einblicke in die Bilderwelten des Nationalsozialismus. Bilder aus der NS-Zeit begegnen uns immer noch häufig. Viele davon entstammen der nationalsozialistischen Propaganda und vermitteln einen einseitigen Blick. Gerhard Paul - Begründer einer Visual History im deutschsprachigen Raum - fächert das Spektrum der Bilderwelten in der NS-Zeit neu auf. In »Bilder einer Diktatur« stellt er offizielle Aufnahmen des Regimes neben weniger bekannte und bisher völlig unbekannte. Sie zeigen Geschehnisse auf Straßen und Plätzen ebenso wie in Lagern oder Gefängnissen, in privaten Räumen oder Verstecken. Viele bieten überraschende Entdeckungen, und oftmals erweist sich ihre Nachkriegsgeschichte als ebenso spannend wie ihre zeitgenössische Wahrnehmung. Trotz der strengen Kontrolle der Nationalsozialisten entfalteten viele der Bilder eine Wirkung, die den Absichten des Regimes zuwiderliefen.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
02. März 2020
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
528
Reihe
Visual History. Bilder und Bildpraxen in der Geschichte, 6
Autor/Autorin
Gerhard Paul
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
ca. 220 z.T. farbige
Gewicht
1201 g
Größe (L/B/H)
236/164/35 mm
ISBN
9783835336070
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Indem Paul Bilder nach ihren Produktions- und Rezeptionsbedingungen fragt, setzt er in der Geschichtswissenschaft nach wie vor Maßstäbe. «
(Niklas Zimmermann, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05. 06. 2020)
»Wer (. . .) denkt, was auf einem Bild zu sehen ist, das sähe man ja selbst, wird hier seine ersten Aha-Erlebnisse haben. «
(Frank Keil, taz-nord, 10. 03. 2020)
»um die heimliche Macht der Bilder zu brechen, müssen sie überhaupt erst einmal verstanden werden. Dazu (. . .) leistet Gerhard Paul einen bemerkenswerten Beitrag. «
(Bernhard Schulz, Der Tagesspiegel, 13. 03. 2020)
»ein unglaublich spannender Bilder-Erklärungs-Band«
(Gesa Ufer, Deutschlandfunk Kultur Lesart, 08. 05. 2020)
»Das ist kein Fachbuch ausschließlich für Akademiker, sondern eine aufklärende Schule des Sehens, in die Paul hier einführt. «
(Carsten Hueck, Deutschlandfunk Kultur Buchkritik, 25. 05. 2020)
»Es ist eine beeindruckende Leistung, wie akribisch Paul vermeintlich Offensichtliches hinterfragt. «
(Dirk Walter, Münchner Merkur, 18. 06. 2020)
»Ein erschütterndes Kaleidoskop. «
(neues deutschland, 05. 12. 2020)
»ein wichtiges Buch«
(Paul Weßels, Emder Jahrbuch für Landeskunde Ostfrieslands, 2021)
»Die Kapitel sind übersichtlich gegliedert und sehr anschaulich geschrieben, sodass man sich zu keiner Zeit belehrt oder überfordert fühlt. Auch die Vielschichtigkeit der einzelnen Themen spricht ein breites Publikum an und liefert sogar Einblicke in vermeintlich untergeordnete Bereiche, die in der historischen Wissenschaft bisher wenig beleuchtet wurden. Ich werde den Titel daher gerne weiterempfehlen (. . .). «
(Sonja Kurewitz, Thalia, Göttingen)
(Niklas Zimmermann, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05. 06. 2020)
»Wer (. . .) denkt, was auf einem Bild zu sehen ist, das sähe man ja selbst, wird hier seine ersten Aha-Erlebnisse haben. «
(Frank Keil, taz-nord, 10. 03. 2020)
»um die heimliche Macht der Bilder zu brechen, müssen sie überhaupt erst einmal verstanden werden. Dazu (. . .) leistet Gerhard Paul einen bemerkenswerten Beitrag. «
(Bernhard Schulz, Der Tagesspiegel, 13. 03. 2020)
»ein unglaublich spannender Bilder-Erklärungs-Band«
(Gesa Ufer, Deutschlandfunk Kultur Lesart, 08. 05. 2020)
»Das ist kein Fachbuch ausschließlich für Akademiker, sondern eine aufklärende Schule des Sehens, in die Paul hier einführt. «
(Carsten Hueck, Deutschlandfunk Kultur Buchkritik, 25. 05. 2020)
»Es ist eine beeindruckende Leistung, wie akribisch Paul vermeintlich Offensichtliches hinterfragt. «
(Dirk Walter, Münchner Merkur, 18. 06. 2020)
»Ein erschütterndes Kaleidoskop. «
(neues deutschland, 05. 12. 2020)
»ein wichtiges Buch«
(Paul Weßels, Emder Jahrbuch für Landeskunde Ostfrieslands, 2021)
»Die Kapitel sind übersichtlich gegliedert und sehr anschaulich geschrieben, sodass man sich zu keiner Zeit belehrt oder überfordert fühlt. Auch die Vielschichtigkeit der einzelnen Themen spricht ein breites Publikum an und liefert sogar Einblicke in vermeintlich untergeordnete Bereiche, die in der historischen Wissenschaft bisher wenig beleuchtet wurden. Ich werde den Titel daher gerne weiterempfehlen (. . .). «
(Sonja Kurewitz, Thalia, Göttingen)
 Besprechung vom 05.06.2020
Besprechung vom 05.06.2020
Das Porträt des Führers im Herrgottswinkel
Schnappschüsse und Propaganda: Gerhard Paul schärft den Blick auf die Bilderwelt des Nationalsozialismus
Ein Sympathisant der Berliner Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums wird Gerhard Paul nicht mehr. Der Historiker kritisiert in seinem jüngsten Buch vor allem die Abteilung zum "Dritten Reich". Sie begreife Bilder teilweise als Spiegel historischer Wirklichkeit. Seine Schelte konkretisiert Paul auch an Ernst Vollbehr, der als "Maler des Führers" galt. Die Ausstellung habe seine Ästhetisierung der Nürnberger Reichsparteitage lange als realistisches Abbild des Geschehenen dargestellt. Ähnlich naiv sei eine Aufnahme vom 1. September 1939 rezipiert worden, die einen scheinbar mühelos beseitigten Schlagbaum in Danzig zeigt. Tatsächlich sei der Angriff auf die Stadt kein einfaches Manöver gewesen. Den polnischen Adler als Symbol für die Unterworfenen hätten die Fotografen kurzerhand von einem nahe gelegenen Forsthaus hergebracht.
Bilder erzeugten Realitäten, ist der Autor überzeugt. In der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft sind für diese Auffassung jedoch dicke Bretter zu bohren. Paul zitiert den Ausstellungsarchitekten Klaus-Jürgen Sembach, der die Meinung vertritt, die Geschichte des Nationalsozialismus werde vor allem "gelesen", nicht "gesehen". Paul gehört zu den Pionieren des "Visual Turn" in der Geschichtswissenschaft. Er hat bereits zwei Überblickswerke zum zwanzigsten Jahrhundert als "Jahrhundert der Bilder" und ein Studienbuch zur "Visual History" geschrieben. Nun zeigt er an zweiundvierzig Fallstudien, dass Bildproduktion und -rezeption im "Dritten Reich" vielfältiger waren, als es der Begriff der "Gleichschaltung" suggeriert.
Paul beschäftigt sich dabei auch mit Bildern, die schon vor der nationalsozialistischen Machtergreifung entstanden. So konkurrierte etwa der "Prolet-Arier", den die NSDAP im Reichspräsidenten-wahlkampf von 1932 plakatierte, mit der politischen Ikonographie der KPD, auf deren Postern ein ebenso mächtiger Arbeiter forderte: "Schluss mit diesem System." Der Nationalsozialismus setzte wie keine politische Bewegung zuvor auf Körpermetaphern. In der späten Kriegsphase ist das Bild des Arbeiterriesen aus der Öffentlichkeit allerdings verschwunden, da sich die Diktatur zu diesem Zeitpunkt mit ihm lächerlich gemacht hätte.
Ein Schwerpunkt des Buchs ist der Analyse antijüdischer Bilder gewidmet, wie sie etwa 1936 in der "Großen antibolschewistischen Schau" in München zu sehen waren. Dort wurden Juden mit vermeintlich authentischem Archivmaterial als "minderwertiges Rassengemisch" dargestellt. Darüber hinaus zeigt Paul, dass die deutsche Propaganda in den nach 1939 besetzten Gebieten Feindbilder adaptierte und Juden als hygienische Gefahr, Ungeziefer und Krankheitsüberträger inszenierte. Besonders verstörend sind Aufnahmen aus dem ukrainischen Lemberg, auf denen zu sehen ist, wie Jugendliche für die Kamera sexualisierte Gewalt gegen jüdische Frauen ausüben. Hinzu kommen Bilder, die von Opfern des nationalsozialistischen Terrors stammen, etwa Schnappschüsse der Novemberpogrome von 1938. Sie wurden in Kiel von einem jüdischen Studenten aufgenommen, der so tat, als fotografiere er einen Freund.
Moderne Kunst wurde von den Nationalsozialisten nicht nur als "entartet" diffamiert, sondern auch instrumentalisiert. So konkurrierte beispielsweise der Bauhausstil mit Motiven, die sich an der christlichen Ikonographie orientierten, etwa dem Hitlerporträt im Herrgottswinkel alpiner Wohnstuben. Allerdings verzichtete das Regime nach 1941 immer häufiger auf Darstellungen des "Führers", da sogar Anhänger des Nationalsozialismus zunehmend der Meinung waren, er eigne sich nicht mehr für auratische Abbildungen.
Aufgrund der zahlreichen Einzelstudien ist es schwierig, einen roten Faden des Buchs auszumachen. Dafür erlaubt die chronologische Struktur eine gute Orientierung. Indem Paul Bilder nicht nur interpretiert, sondern auch nach ihren Produktions- und Rezeptionsbedingungen fragt, setzt er in der Geschichtswissenschaft nach wie vor Maßstäbe.
NIKLAS ZIMMERMANN
Gerhard Paul:
"Bilder einer Diktatur".
Zur Visual History des
,Dritten Reiches'.
Wallstein Verlag, Göttingen 2020. 528 S., Abb.,
geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Bilder einer Diktatur" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.














