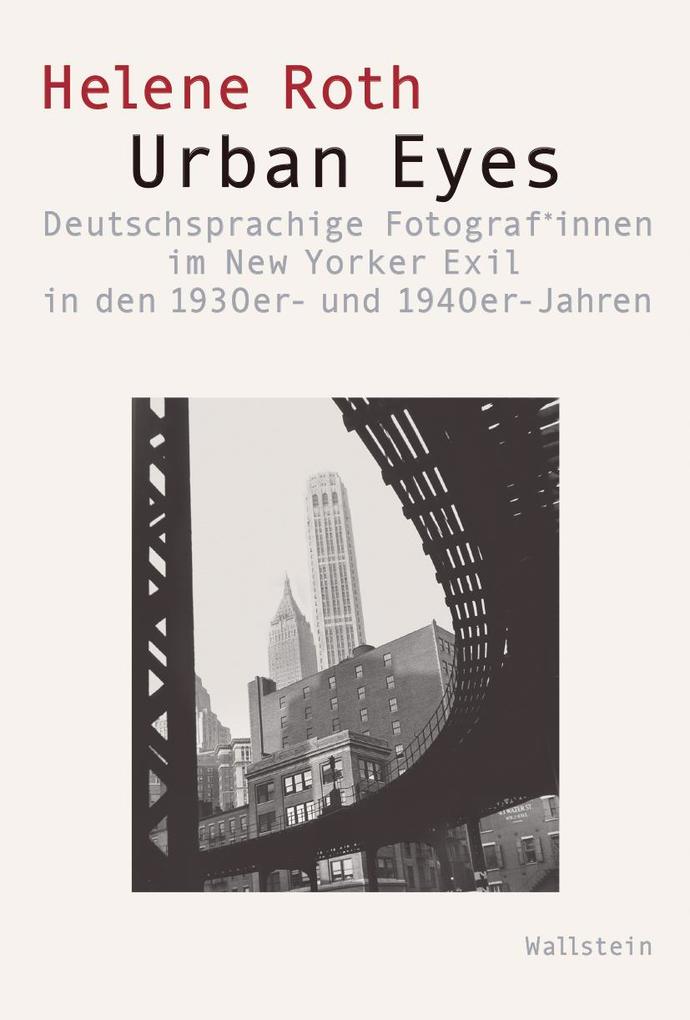
Zustellung: Sa, 26.04. - Di, 29.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
The Place to Be? Mit der Kamera in der Exilmetropole New YorkMit dem Machtantritt der Nationalsozialisten etablierte sich New York als Ankunftsstadt für deutschsprachige Fotograf*innen, denen die Flucht aus Europa gelang. Die Fotografie als Medium befand sich zu dieser Zeit in einem Umbruch, unter anderem durch das Bemühen, sie als Kunstform zu etablieren. Die Exilant*innen wiederum brachten unterschiedliche Ausbildungen, Kameratypen und Emigrationsverläufe mit. Manche waren schon professionell tätig gewesen, andere mussten ihre erlernten Berufe aufgeben und erwarben sich autodidaktisch fotografische Kompetenzen. So unterschieden sich auch ihre künstlerischen Strategien im New Yorker Exil. Die Kamera diente als Medium, sich mit der Metropole auseinanderzusetzen, die Emigrationserfahrung zu reflektieren, Netzwerke aufzubauen und schlicht ökonomisch zu überleben. Um die komplexen Zusammenhänge von Fotografie und Exil im Kontext der Metropole New York umfassend zu analysieren, nimmt Helene Roth die kreativen Leistungen und heterogenen Perspektiven, aber auch die Niederlagen und Rückschläge emigrierter Fotograf*innen näher in den Blick. Aus einer transnationalen Sicht betrachtet sie die soziokulturellen, politischen sowie künstlerischen Entwicklungen während der 1930er- und 1940er-Jahre.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
25. September 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
494
Reihe
Visual History. Bilder und Bildpraxen in der Geschichte, 11
Autor/Autorin
Helene Roth
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit 234 z.T. farb. Abbildungen
Gewicht
1112 g
Größe (L/B/H)
232/164/34 mm
ISBN
9783835356559
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»eine minutiös gearbeitete Recherche ( ). (Man hat es) mit einem reichen Kompendium zu tun, das ein wichtiges historisch-ästhetisches Feld aufschluss- und informationsreich kartiert. «
(Bernd Stiegler, FAZ, 13. 11. 2024)
»ein Lesegenuss für alle Foto- und Fotobuchliebhaber, Exilforscher sowie an Stadtgeschichte Interessierte ( ) Ach was: an Soziologie Interessierte! Denn (Roth) schreibt anschaulich und ( ) die acht Kapitel lassen sich auch einzeln lesen«
(Thomas Honickel, Photonews Zeitung für Fotografie, 02/2025)
(Bernd Stiegler, FAZ, 13. 11. 2024)
»ein Lesegenuss für alle Foto- und Fotobuchliebhaber, Exilforscher sowie an Stadtgeschichte Interessierte ( ) Ach was: an Soziologie Interessierte! Denn (Roth) schreibt anschaulich und ( ) die acht Kapitel lassen sich auch einzeln lesen«
(Thomas Honickel, Photonews Zeitung für Fotografie, 02/2025)
 Besprechung vom 13.11.2024
Besprechung vom 13.11.2024
New York als Kontaktzone
Spuren im Netzwerk: Helene Roth widmet emigrierten deutschsprachigen Fotografen eine minutiös gearbeitete Recherche.
Lang, sehr lang ist die Liste der deutschsprachigen Fotografen und Fotografinnen, die während der NS-Zeit nach New York emigrierten. Sie reicht von Ellen Auerbach, Ruth Bernhard, Ilse Bing und Josef Breitenbach über Andreas Feininger, Trude Fleischmann, Lotte Jacobi und Lisette Model bis hin zu Rolf Tietgens, Roman Vishniac, Werner Wolff und Ylla, um nur einige zu nennen. Bereits diese Namen deuten an, dass man es mit einer in vieler Hinsicht heterogenen Gruppe zu tun hat, ästhetisch reicht der Bogen von Tierfotografien und surrealistischen Fotomontagen bis zu neusachlichen Architekturaufnahmen und sozialdokumentarischen Reportagen.
So unterschiedlich wie die ästhetischen Ausrichtungen sind auch die Ausdrucks- und Publikationsformen und, wie wir nun durch die minutiöse Recherche von Helene Roth wissen, die lebensweltlichen Verortungen. Roths Buch geht zurück auf eine mehrjährige Recherche in Archiven, deren Auflistung viele, sehr viele Seiten umfasst. Einiges, was sie dabei in Bild und Text zutage gefördert hat, war bisher kaum bekannt oder - bei den Prominenten - allenfalls ein kurzes Kapitel in einem Ausstellungskatalog oder eine Randbemerkung in einem Aufsatz wert. In dieser Hinsicht hat man es mit einer echten Pionierarbeit zu tun, die immer dann überzeugt, wenn sie das Material in seiner Fülle entfaltet und dabei mitunter eine regelrechte Netzwerkanalyse vornimmt. Weniger überzeugend ist die theoretische Ebene, die sie gelegentlich einzieht, da sich diese zumeist wie eine fremde Stimme ausnimmt und das Material nicht wirklich in anderer Form aufschließt. Doch auch so hat man es mit einem reichen Kompendium zu tun, das ein wichtiges historisch-ästhetisches Feld aufschluss- und informationsreich kartiert.
Doch wie lässt sich eine so große Materialfülle überhaupt sinnvoll ordnen und darstellen? Es geht immerhin um viele Fotobücher, biographische Dokumente wie Tagebücher, Briefe oder Berichte, aber auch um Förderinstitutionen, Museen, Agenturen und Bildnachlässe mit Zigtausenden Abzügen. Helene Roth macht sich geschickt die Tatsache zunutze, dass die höchst unterschiedlichen Fotografinnen und Fotografen gleichwohl doch vieles teilen, angefangen mit der Fluchtroute über eine recht überschaubare Zahl von Publikations- und Verdienstmöglichkeiten, bestimmte Verlage und Institutionen, die ihnen Arbeit gaben, wie das Museum of Modern Art oder die New School for Social Research, bis hin zu bestimmten Vierteln der Stadt, die sie frequentierten oder in denen sie arbeiteten. Sechs der acht Kapitel stellen jeweils einen dieser Bereiche mitsamt den Lebens- und Arbeitswegen vor, die sich mal überschneiden, mal aber auch parallel zueinander verlaufen. Es ist eine Art Netzwerkstudie, die zwar gelegentlich auch Karten und Stadtpläne enthält, um auf diesen die Fotografinnen und Fotografen konkret verorten zu können, zumeist aber anschaulich aus dem reichen Material heraus entwickelt wird. Dargestellt wird dabei in Text und Bild nicht dessen gesamte Breite, sondern - ungleich plastischer - das eine oder andere repräsentative Beispiel.
So werden etwa verschiedene Serien von Aufnahmen vorgestellt und verglichen, die während der Schiffsüberfahrten nach Amerika entstanden, werden anhand der erhaltenen Bilder Wege durch die Stadt mitsamt ihren fotografischen Perspektiven rekonstruiert oder auch wichtige damals publizierte Fotobücher vorgestellt.
Das Leben im New Yorker Exil wird keineswegs als Verlust beschrieben, sondern als ein Raum der Möglichkeiten, von denen auch die dortige Kunstszene profitierte, selbst wenn die meisten Fotografinnen lange als "enemy aliens" geführt wurden. "Kreativität", "Kontaktzonen", "Netzwerke" sind daher Schlüsselbegriffe dieses kompakten Kompendiums, das einen Raum beschreibt, in dem sich viel tat. Das gilt auch für die Fotografie, die in dieser Zeit ihrerseits im Umbruch begriffen ist und sich erst allmählich den Bereich der Kunst und der Presse erschließt. Hier, im New Yorker Exil, wird sie zu einem intellektuellen, ästhetischen, aber auch politischen und queeren Reflexionsmedium im besten Sinne. Das vielleicht anregendste Kapitel gilt nämlich den queeren Praktiken der Fotografinnen und Fotografen, die Teil einer Kunstszene werden, in der unter vielen anderen auch Patricia Highsmith verkehrt, die sich auf Liebeleien und bemerkenswerte Porträtsitzungen einlässt, deren Bilder dann zum Teil für surreale Kompositionen weiterverwendet werden. In ihren Aufzeichnungen hat sie einige Hinweise hinterlassen, die eine weitere Perspektive auf die auch in Sachen sexueller Neigungen experimentelle Fotoszene eröffnen. BERND STIEGLER
Helene Roth: "Urban Eyes". Deutschsprachige Fotograf*innen im New Yorker Exil in den 1930er- und 1940er- Jahren.
Wallstein Verlag, Göttingen 2024.
494 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Urban Eyes" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.














