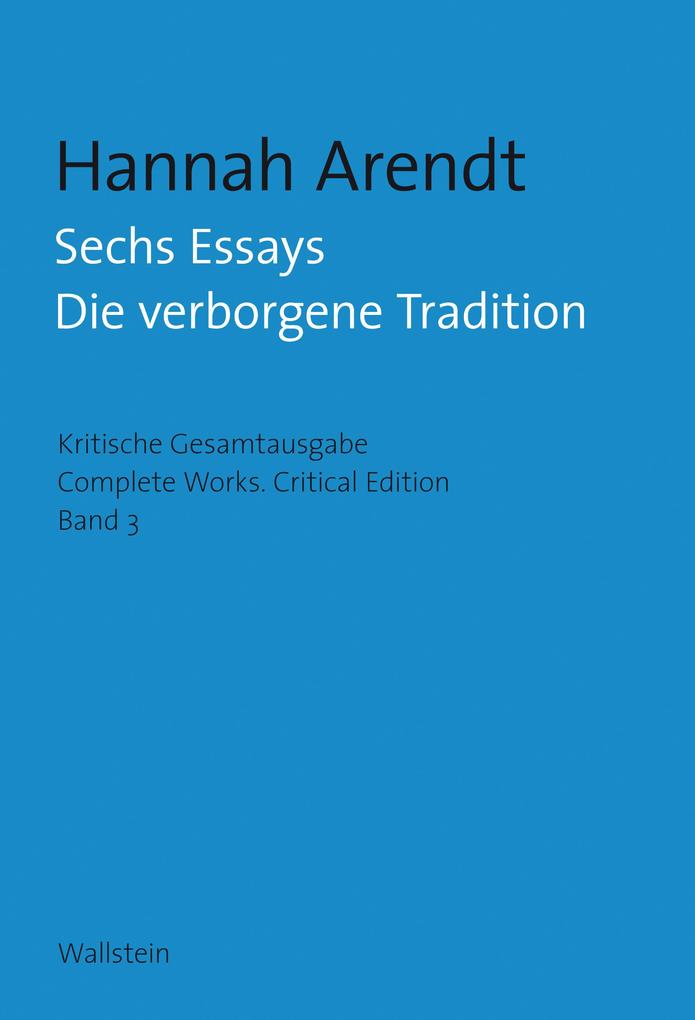
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
(Elke Schmitter, Der Spiegel, 09. 02. 2019)
»Eine großartige Sache war es schon immer, aber sie ist jetzt noch großartiger geworden. «
(Andreas Isenschmid, SRF Literaturclub, 12. 02. 2019)
»Endlich ehrt die Welt Hannah Arendt mit einer Kritischen Gesamtausgabe«
(Hendrikje Schauer, Der Tagesspiegel, 20. 01. 2019)
»Für alle, die mit Arendts Schriften wissenschaftlich arbeiten wollen, ist dieses Editionsprojekt ein Segen. «
(Tobias Albrecht, www. theorieblog. de, 18. 02. 2019)
»Arendt seziert schon in diesen frühen Schriften mit glasklarer Sprache und messerscharfem Verstand unsere abendländischen Traditionen in Literatur, Denken und Politik. «
(Roman Herzog, SWR2 Lesenswert Kritik, 26. 03. 2019)
»Hannah Arendt wäre auch heute noch in jeder politischen oder literarischen Debatte ein Gewinn. «
(Gerhard Henschel, junge Welt, 21. 03. 2019)
»Eine philologische Herkulesaufgabe. «
(Marie-Luise Knott, Deutschlandfunk Büchermarkt, 21. 04. 2019)
»Der Beginn dieser kritischen Gesamtausgabe der Werke Hannah Arendts kann nicht anders als ein großer Erfolg begrüßt werden. «
(Stefania Maffeis, Information Philosophie, 1/2020)
»Mit der Werkausgabe wird dereinst gewiss eine verlässliche Textausgabe dieser vielseitigen Wissenschaftlerin in einer bezahlbaren Ausgabe vorliegen, die allen modernen Ansprüchen Genüge leistet. «
(Thomas Gerhards, Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 5/2020)
»Die Essays sind beeindruckend und zeigen Hannah Arendts politischen und geradezu prophetischen Scharfsinn«
(Wilhelm Schwendemann, Zeitschrift für jüdisch-christliche Begegnung im Kontext, 2023)
 Besprechung vom 27.01.2019
Besprechung vom 27.01.2019
Gegnerin der Einsamkeit
Wer groß denkt, muss auch als Mensch sichtbar sein: zur neuen Hannah-Arendt-Ausgabe
Wenn der Name Hannah Arendt fällt, dann glaubt man Bescheid zu wissen: Die selbstbewusste deutsche Jüdin, zeitweilige Geliebte des Philosophen Martin Heidegger, exzellente Biographin Rahel Varnhagens, erst Flüchtling, dann amerikanische Staatsbürgerin, brillante Analytikerin der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, emphatische Freundin und umstrittene Autorin einer Reportage über den "Fachmann" für den systematischen Mord an den europäischen Juden Adolf Eichmann. All das ist keine Erfindung ihrer Verehrer. Es wurde gelebt, erdacht und erschrieben von einer auf Deutsch wie auf Englisch publizierenden Autorin, die ihre Werke ständigen Revisionen unterzieht und darin weder sich noch den Common sense schont. Als sie 1975, bereits unheilbar krank, in New York nach einem Herzinfarkt innerhalb weniger Minuten starb, verbreitete sich die Nachricht von ihrem Tod sofort über alle Medien auf der ganzen Welt.
All das ist richtig. Doch haben die seit Jahren in nahezu jedem Text über Arendt vorkommenden Fakten dazu geführt, dass sie nach und nach zu einer jederzeit und für jeden Zweck abrufbaren "Figur" geworden ist. Eine Art "Antwortregister" auf die jeweils brennenden Fragen der Zeit, was auf Kosten ihrer intellektuellen Eigenständigkeit, geistigen Unabhängigkeit und vor allem der Relevanz ihrer Argumente und Ideen ging. Arendts Theorie des Republikanismus, ihre Auseinandersetzungen mit Konzepten und Phänomenen wie Freiheit, Religion, Vernunft und Wahrheit, ihre Aussagen zu Revolution und der Zukunft des Menschen als politischem Lebewesen, das Insistieren auf den Unterschied von öffentlich und privat, schienen durch die Konzentration aufs bloß Biographische entweder zu Accessoires oder zu wirklichkeitsfremdem Expertenwissen zu werden.
Muss man also auf die so berühmt gewordene, im Zigarettennebel eingehüllte Fernsehgesprächspartnerin von Günter Gaus verzichten, um die selbständige Aristotelikerin und Kantianerin erkennen zu können?
Dass diese Frage alles andere als trivial ist, belegen die beiden soeben erschienenen Bände der ersten kritischen Gesamtausgabe von Arendts Schriften auf je unterschiedliche Weise eindrücklich. Denn wir haben es zum einen mit teilweise erstmals zugänglich gemachten Texten zu tun, die durchtränkt sind mit Erfahrungen, gelegentlich ungefiltert bitter, manchmal stolz auftreten und die darin zugleich Arendts analytische Genauigkeit und ihre besondere Denk- und Schreibweise offenlegen. Zum anderen wird in ihrem großen, unabgeschlossenen, erstmals in seiner ganzen schroffen Größe erkennbaren Vorhaben über die "moderne Herausforderung der Tradition" die für Arendt typische Verschränkung von Zeitdiagnostik und immer neuen Deutungsanläufen kenntlich: Der Mensch, will er denn wieder seiner Spezies vertrauen können, muss alles auf den Prüfstand stellen, was er zu wissen glaubte.
Wie radikal Arendt nach und nach das Terrain des Menschlichen in der Welt vermisst, zeigt bereits die von Karl Jaspers initiierte Textsammlung "Sechs Essays", die 1948 von der Zeitschrift "Die Wandlung" herausgegeben wird. Dass Jaspers und seine jüdische Frau Gertrud in Deutschland überlebt hatten, gibt Arendt das Vertrauen zurück, es nochmals mit den Deutschen zu versuchen - allerdings zu ihren Bedingungen. Die zwischen 1943 und 1946 ursprünglich auf Deutsch verfassten und in den Vereinigten Staaten veröffentlichten Essays sind in jeder Hinsicht Zumutungen, die immer aus dem jeweiligen Anlass heraus argumentieren. "Denn der systematische Massenmord, der die reale Konsequenz aller Rassentheorien und Ideologien von dem ,Recht des Stärkeren' in unserer Zeit ist, sprengt nicht nur die Vorstellungskraft des Menschen, sondern auch den Rahmen und die Kategorien, in welchen politisches Denken und politisches Handeln sich vollziehen."
Was Arendt in dem Essay "Organisierte Schuld" feststellt, wird zum Programm werden. Doch unmittelbar nach dem Krieg, zumal Arendts erste Besuche in Deutschland ihr nur wenig Anlass zu Hoffnung bieten, können die Konsequenzen des Gesagten noch nicht gezogen werden. Vielmehr gilt es zunächst, die genuin jüdische Geschichte zu erinnern, ihre Entwicklung und ihr scheinbares Ende zu prüfen. So liefert sie mit der Darstellung einer, allerdings bloß vermeintlichen "verborgenen jüdischen Tradition" eine Gegengeschichte zu jenen aus dem Zeitalter der Emanzipation und Assimilation hervorgegangenen Literaturgeschichten. Arendt will Heinrich Heine aus deren Fängen befreien, wie sie es auch mit Charlie Chaplin versucht. Bei all dem geht es nicht um Deutungskonkurrenz, sondern um eine Klarstellung. Und diese Klarstellung besagt, dass sich jüdisches Leben und Denken nicht länger in der Annahme von Angeboten erschöpfen darf, sondern einen aufgegebenen Eigensinn entfalten muss. Einen Eigensinn, dem der politische Zionismus der Zeit nach Arendt angeblich nicht folgt - er bindet sich zurück an eine Vorstellung, die mit für den Untergang des europäischen Judentums verantwortlich gewesen sei: an die Idee des Nationalstaats.
Arendts Kafka-Aufsatz eröffnet eine andere Perspektive und bietet insofern eine Ergänzung des angekündigten Programmes. Der Prager Jude hatte in seinen Romanen nämlich nicht nur "die Zerstörung der gegenwärtigen Welt antizipieren können", sondern auch jeden aufgefordert "der guten Willens ist, vielleicht sogar du und ich", sprichwörtlich Berge zu versetzen. Ohne die seinerzeit von deutschen Kafka-Lesern so innig geliebte existenzielle Dimension samt einer üppigen Dosis Metaphysik, liefert Arendt einen kämpferischen Kafka, der sich weder den monströsen Zeitläuften, noch den Erwartungen an die Vermittlung seiner Einsichten unterwirft. Er bleibt für Arendt gegenstrebig und damit von fortwährender, nicht aufzulösender Spannung zur jeweiligen Gegenwart. Genau diese Poesie wird Teil des neuen Rahmens und der neuen Kategorien werden, in denen Arendt künftig politisches Denken und politisches Handeln verorten möchte. Liest man dann ihre späteren Texte zu Hermann Broch, Tania Blixen oder W. H. Auden, schaut man aber auch auf Arendts eigenen Stil, dann scheint darin etwas auf, das ihr zufolge vor allem in der tradierten politischen Philosophie seit Platon gänzlich vergessen wurde: das trotz allem in die Menschen vorhandene Vertrauen.
Es verwundert insofern nicht, dass die 1951 zunächst auf Englisch und dann stark verändert vier Jahre später auf Deutsch als "Ursprünge und Elemente totaler Herrschaft" erschienene erste Systematisierung von Arendts Denken wesentlich von den "Sechs Essays" und den darin enthaltenen programmatischen Äußerungen lebt. Die analytische Bestandsaufnahme von Antisemitismus, Nationalsozialismus und Kommunismus findet dann ihre direkte Fortsetzung in den nun zugänglich gemachten Bruchstücken eines nie geschriebenen Buches. Was die Herausgeber unter dem Titel "Modern Challenge of Tradition" publizieren, bietet die angekündigte Destruktion der politischen Philosophie und liefert zugleich einen Ausblick auf Arendts eigenes Programm.
Was Arendt aller politischen Philosophie, ja der Philosophie und ihren Protagonisten insgesamt vorwirft, ist ihre Weltlosigkeit. Gefangen in dem, was sie "loneliness" nennt, richten sie ihren Blick auf die Welt, in der Illusion kein Teil von ihr zu sein. Einsamkeit als professionelle Krankheit, das ist nicht Arendts Sozialprognose, vielmehr ein Verdikt, das aus den Texten selbst gewonnen wird. Sie hat keine Scheu, "von Platon bis Madison" und weiter bis Nietzsche eine komplexe Verfehlungsgeschichte zu konstatieren. Dass es in ihr zu keinen Brüchen kam, verwundert sie. "Was sich im modernen Denken mit Marx einerseits und Nietzsche andererseits ereignete, ist die Übernahme des Rahmens der Tradition bei gleichzeitiger Leugnung ihrer Autorität. Dies ist die eigentlich geschichtliche Bedeutung der Umstülpung Hegels und der Umkehrung Platos." "Übernahme" und "Leugnung", "Umstülpung" und "Umkehrung" - zu mehr an Reaktion auf die Wirklichkeit ist die Philosophie nicht bereit? Noch Marx' also, den sie als denjenigen charakterisiert, der den größten Sprung aus der "Einsamkeit" des Denkens hinein in die Öffentlichkeit und die radikale Veränderung der Gesellschaft lediglich ankündigte, vollzieht seine Abkehr mit der nicht abzuschüttelnden Last von Platon bis Hegel.
Arendt wäre nicht Arendt, wenn sie solchen Großerzählungen nicht die notwendige Arbeit am Begriff folgen ließe. Was sie zu der Trias von Tradition, Autorität und Religion zu sagen hat, wird immer mit den jeweiligen Argumenten abgeglichen. Das ist auch deshalb spannend zu verfolgen, weil Arendt hier großflächig entfaltet, was an den "offiziellen" Texten als entweder überpointiert oder allzu verknappt kritisiert wurde. Die auch in ihrer radikalen Einseitigkeit stets beeindruckende Destruktion der Philosophie und ihre Rückbindung an die Situation des "Kalten Krieges" und der allmählichen Vergegenwärtigung des Ausmaßes der Schoa, ist aber nur die eine Seite der Medaille.
Die andere liefert ein zweiter Blick in Arendts Denkwerkstatt. In ihr setzt sie nach und nach die Instrumente zusammen, mit denen sie die Grundlage für ihre Berühmtheit schafft. Den Erscheinungsraum des Menschen als originales und originelles Zusammenspiel von Handeln und Politik zu bestimmen, wird schon hier angedeutet. Die Öffentlichkeit als Bedingung der Möglichkeit für verantwortliches Aushandeln von Argumenten auszuweisen und damit den Menschen in seiner Eigentümlichkeit zu fassen, ist in "Modern Challenge" schon klar ausgesprochen. Und wie der Kommentar der Edition immer wieder deutlich macht, lassen sich von hier aus die anderen Texte nicht nur besser verstehen, sondern erst erschließen. Das gilt gleichermaßen für das sogenannte "Denktagebuch" wie für ihr Hauptwerk "Vita Activa".
Doch in dieser Feststellung ist nur verkapselt mitgeteilt, was die öffentliche Hannah Arendt stets mitdachte und auch mitteilte: Wer denkt, der trägt Verantwortung. Und wer groß denkt, der muss auch als Mensch wahrhaftig und sichtbar sein. Zu ihrem Denken gehörte insofern eben auch die berühmte Zigarette. Dass Hannah Arendt und mit ihr Aristoteles und Kant klar zu sehen sind, dafür sorgt nun die kritische Edition ihrer Schriften. Die Beschäftigung mit Arendt beginnt gerade neu.
THOMAS MEYER
Hannah Arendt: "Sechs Essays. Die verborgene Tradition". Hg. v. Barbara Hahn, Barbara Breysach u. Christian Pischel. Wallstein-Verlag, 503 Seiten, 39 Euro
Hannah Arendt: "The Modern Challenge to Tradition. Fragmente eines Buchs". Hg. v. Barbara Hahn, James McFarland, Ingo Kieslich u. Ingeborg Nordmann. Wallstein- Verlag, 924 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Sechs Essays" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.










