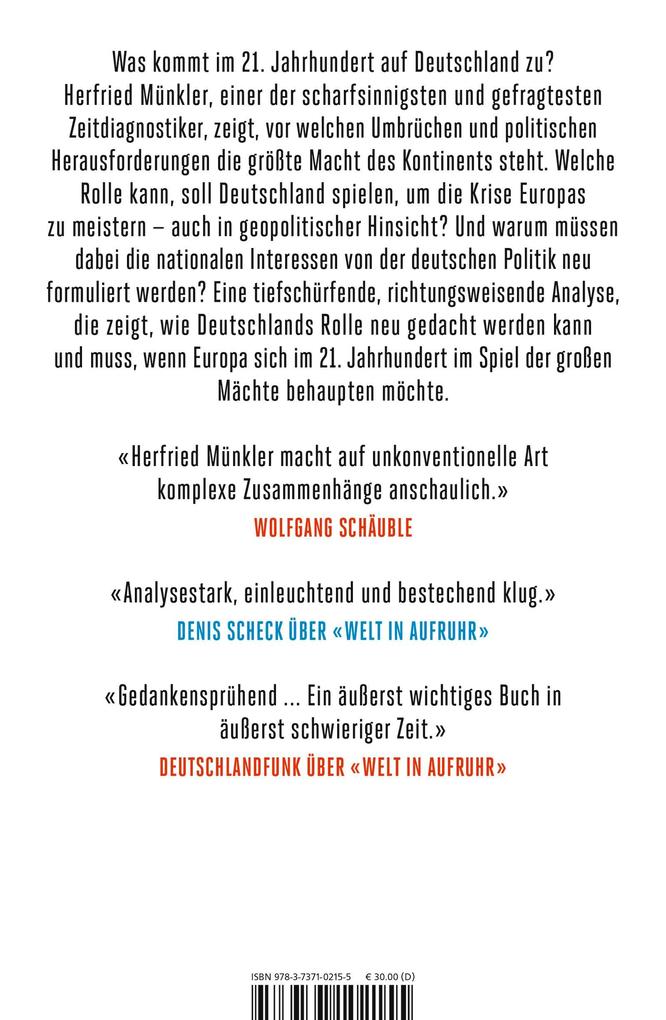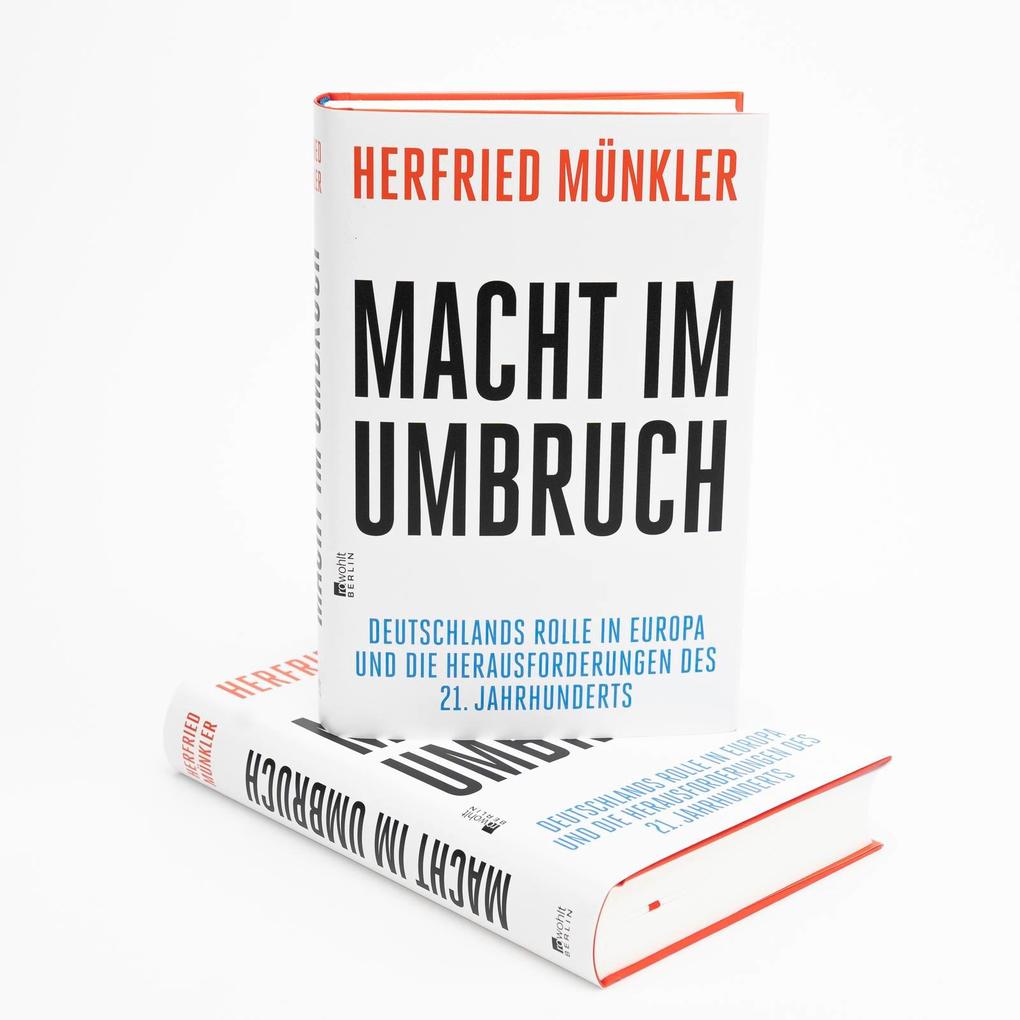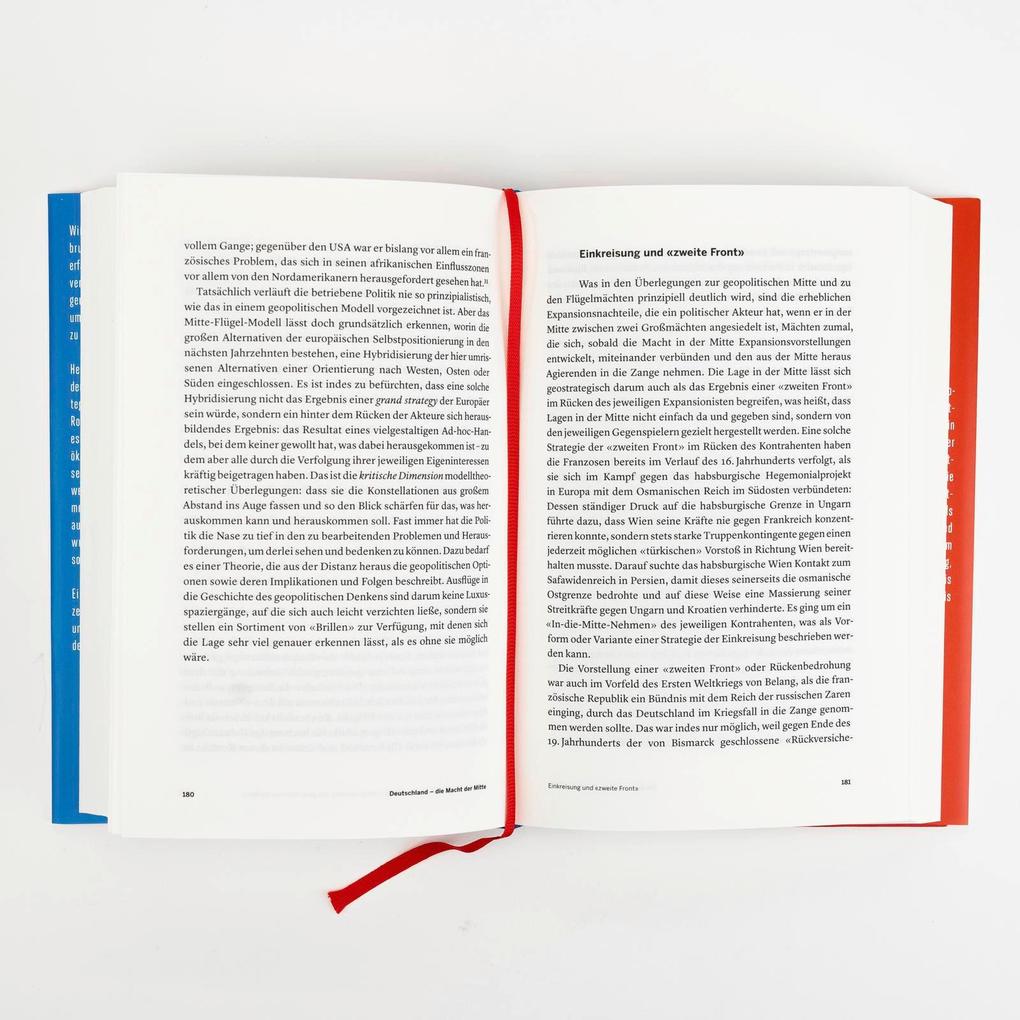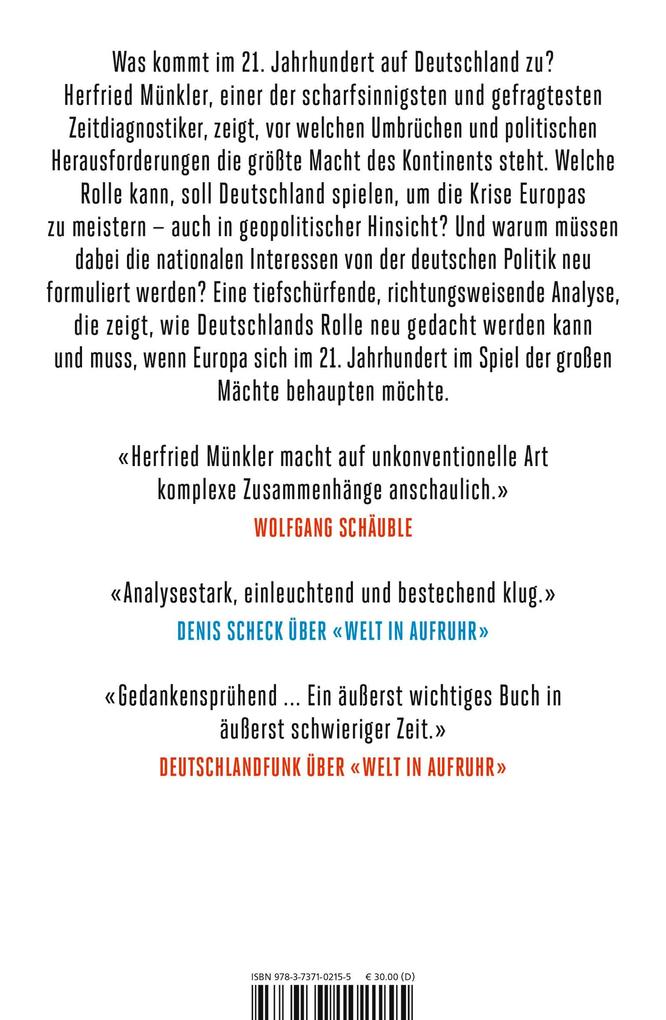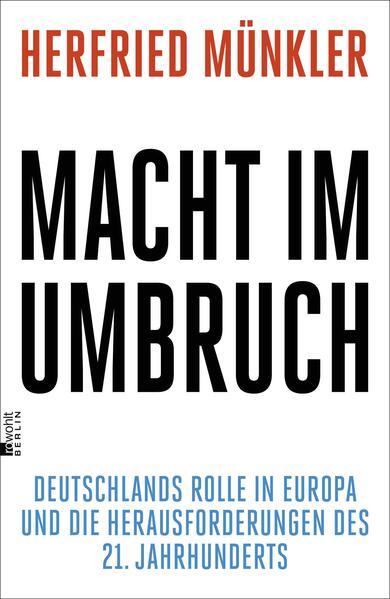
Zustellung: Sa, 19.04. - Mi, 23.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Wir alle spüren, dass Deutschland eine Macht im Umbruch ist, ein Land, das tiefgreifende Veränderungen erfährt. Was bedeutet der Wandel der Welt für das Selbstverständnis Deutschlands, vor welchen Herausforderungen stehen wir, und was müssen die Deutschen jetzt tun, um nicht abgehängt zu werden, sondern aktiv gestalten zu können, innen- wie außenpolitisch?
Herfried Münkler kreist die neuralgischen Punkte der deutschen Politik ein und entwirft hellsichtig eine Strategie für das künftige Agieren. Die Frage nach der neuen Rolle Deutschlands wird wesentlich davon abhängen, ob es dem größten Land in der Mitte Europas gelingt, seine ökonomische, politische und kulturelle Macht so einzusetzen, dass ein Auseinanderfallen Europas verhindert werden kann. Hierfür sind nicht nur grundlegende Reformen dringend nötig, Deutschland und die EU müssen sich auch als widerstandsfähig gegen Russland, selbstbewusst im Umgang mit China und, falls es nötig werden sollte, als unabhängig von den USA erweisen.
Eine tiefschürfende, richtungsweisende Analyse, die zeigt, wie Deutschlands Rolle neu gedacht werden kann und muss, wenn Europa sich im 21. Jahrhundert im Spiel der großen Mächte behaupten möchte.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
11. März 2025
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
432
Autor/Autorin
Herfried Münkler
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
558 g
Größe (L/B/H)
221/155/35 mm
ISBN
9783737102155
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Herfried Münkler zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Politikerklärern Er beschreibt in seinem klugen, kühlen und doch leidenschaftlichen neuen Buch eine aus den Fugen geratene Welt. Und er fordert nicht nur die deutsche Politik heraus. Süddeutsche Zeitung
Selten hat ein Sachbuch so perfekt eine Stimmungslage erfasst, gespiegelt, analysiert wie Macht im Umbruch . taz
Der Politikwissenschaftler wurde mit seinen Analysen selten mehr gebraucht als jetzt. Sachbuch-Bestenliste von Welt, Neue Zürcher Zeitung, RBB Kultur und ORF
Die Weltordnung ist im Wanken Was heißt das für Deutschland? Herfried Münkler plädiert für eine neue Führungsrolle, um das Auseinanderfallen Europas zu verhindern. Platz 1 Sachbuch-Bestenliste Die Zeit, Deutschlandfunk Kultur und ZDF
Herfried Münkler zeigt, warum der Westen von innen mehr bedroht ist als von außen ein führender Zeitanalytiker. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Das Buch zur Frage der Zeit: Welche Rolle soll Deutschland, soll Europa in Zukunft spielen? Wie vermeiden wir, im neuen Spiel der Großmächte zerquetscht zu werden? Der Spiegel
Herfried Münkler ist einer der gelehrten Köpfe unserer Zeit, das ist tiefes Wissen, aus dem er schöpft, und das spürt man auf jeder Seite. Robert Habeck
Herfried Münkler erklärt, wie Deutschland mit Trump und China umgehen sollte. Und ermahnt dazu, Politik langfristiger auszurichten. Ein wertvoller Leitfaden, nicht nur für die neue Bundesregierung. Frankfurter Allgemeine Zeitung
Münklers Buch liefert ein Panorama der aktuellen globalen Lage und ihrer enormen Herausforderungen. Deutschlandfunk
Mit seiner scharfsinnigen Betrachtung zeigt Münkler, wie Deutschland und Europa ihre Positionen im geopolitischen Machtgefüge behaupten können und warum ein Umdenken jetzt entscheidend ist. tageszeitung
Einer der wichtigsten geopolitischen Denker Deutschlands. Profil
Herfried Mu nkler macht auf unkonventionelle Art komplexe Zusammenhänge anschaulich. Wolfgang Schäuble
Selten hat ein Sachbuch so perfekt eine Stimmungslage erfasst, gespiegelt, analysiert wie Macht im Umbruch . taz
Der Politikwissenschaftler wurde mit seinen Analysen selten mehr gebraucht als jetzt. Sachbuch-Bestenliste von Welt, Neue Zürcher Zeitung, RBB Kultur und ORF
Die Weltordnung ist im Wanken Was heißt das für Deutschland? Herfried Münkler plädiert für eine neue Führungsrolle, um das Auseinanderfallen Europas zu verhindern. Platz 1 Sachbuch-Bestenliste Die Zeit, Deutschlandfunk Kultur und ZDF
Herfried Münkler zeigt, warum der Westen von innen mehr bedroht ist als von außen ein führender Zeitanalytiker. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Das Buch zur Frage der Zeit: Welche Rolle soll Deutschland, soll Europa in Zukunft spielen? Wie vermeiden wir, im neuen Spiel der Großmächte zerquetscht zu werden? Der Spiegel
Herfried Münkler ist einer der gelehrten Köpfe unserer Zeit, das ist tiefes Wissen, aus dem er schöpft, und das spürt man auf jeder Seite. Robert Habeck
Herfried Münkler erklärt, wie Deutschland mit Trump und China umgehen sollte. Und ermahnt dazu, Politik langfristiger auszurichten. Ein wertvoller Leitfaden, nicht nur für die neue Bundesregierung. Frankfurter Allgemeine Zeitung
Münklers Buch liefert ein Panorama der aktuellen globalen Lage und ihrer enormen Herausforderungen. Deutschlandfunk
Mit seiner scharfsinnigen Betrachtung zeigt Münkler, wie Deutschland und Europa ihre Positionen im geopolitischen Machtgefüge behaupten können und warum ein Umdenken jetzt entscheidend ist. tageszeitung
Einer der wichtigsten geopolitischen Denker Deutschlands. Profil
Herfried Mu nkler macht auf unkonventionelle Art komplexe Zusammenhänge anschaulich. Wolfgang Schäuble
 Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Zeitenwende? Mehr Kontinuität!
Herfried Münkler erklärt, wie Deutschland mit Trump und China umgehen sollte. Und ermahnt dazu, Politik langfristiger auszurichten. Ein wertvoller Leitfaden, nicht nur für die neue Bundesregierung.
Von Thomas Speckmann Von Thomas Speckmann
Von Thomas Speckmann
Zeitenwende - mehrfach, zumindest ausgerufen. Epochenbruch. Neue Ära. Alles sicherlich nicht falsch, was seit der Münchner Sicherheitskonferenz 2025 und den folgenden transatlantischen Gesprächen beziehungsweise Nichtgesprächen gesagt und geschrieben wurde. Aber wirklich treffend? Geht Geschichte nicht einfach nur weiter? Ihr laut verkündetes Ende hatte nach dem Ende des alten Kalten Krieges bekanntlich dann doch nicht stattgefunden. Sollte man daher nicht umso mehr in Kontinuitäten denken anstatt in Brüchen? Bereitet dies nicht an sich besser vor auf die Welt von morgen? Sollte man sich nicht an sich rüsten für jegliche Gemengelagen - mental wie materiell? Zumindest dürfte man dann weniger oft eiskalt erwischt werden und nackt dastehen.
Doch wo kann man derlei Denken und Handeln lernen? Bei Herfried Münkler dürfte man hier gut aufgehoben sein - und dies bereits seit vielen Jahren. Der inzwischen emeritierte, aber weiterhin wohltuend stark engagierte Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität hat sich bereits mit Krieg und Kriegführung, mit dem Auf und Ab von Nationalstaaten und Imperien, mit dem oftmals überaus blutigen Kampf der großen, mittleren wie kleinen Mächte beschäftigt, als dies alles andere als angesagt war im Land der Dichter und Denker. Umso aufmerksamer sollte man sein neues Buch lesen - das wie eine zeitlose Bedienungsanleitung für ein Deutschland daherkommt, das gerade erst beginnt, die Folgen all der von ihm selbst ausgerufenen Zeitenwenden für sich selbst zu verstehen.
Münkler zählt vier große Herausforderungen auf, mit denen er die Europäische Union als Ganzes und in besonderer Weise Deutschland als die zentrale Macht der EU konfrontiert sieht: zunächst die politisch-militärische Bedrohung durch Russland, das - wie auch immer der Ukrainekrieg ende - die Europäer weiterhin mit nuklearen Drohungen unter Druck setzen, sie einschüchtern und gegeneinander ausspielen werde. Zwar glaubt Münkler, dass Russland vorerst nicht in der Lage sein dürfte, einen weiteren Krieg, etwa im Baltikum, zu beginnen. Aber es werde neben den Drohungen mit Atomwaffen die bislang bereits praktizierten Formen der hybriden Kriegführung fortsetzen und vermutlich noch steigern.
Allen, die Verhandlungen mit Wladimir Putin das Wort reden, schreibt Münkler ins Stammbuch, es sei naiv zu glauben, dass sich der Kreml dauerhaft mit größeren territorialen Zugeständnissen der Ukraine im Donbass zufriedengeben werde und danach die Europäer mitsamt Deutschland wieder zum wirtschaftlichen Austausch früherer Zeiten zurückkehren könnten. Dagegen sprechen nach seiner Einschätzung schon die geopolitischen Entwürfe, die im Kreml zirkulierten. Münklers Schlussfolgerung: Die Agenda der deutschen Regierung müsse sowohl die Verteidigungsfähigkeit nach außen als auch die im Innern als eine drängende Aufgabe behandeln. Zumindest die zukünftige Bundesregierung scheint dies nicht nur verstanden, sondern bereits in Angriff genommen zu haben. Als zweite große Herausforderung benennt Münkler das Disengagement der Vereinigten Staaten in Europa, das durch die Wahl Donald Trumps zum 47. Präsidenten zusätzliche Dramatik erhalten habe: durch dessen demonstrative Verachtung der Europäer sowie durch die Unberechenbarkeit und demzufolge Unvorhersehbarkeit seiner Entscheidungen. Münkler bescheinigt Trump, der sich selbst als politischer "Deal Maker" verstehe, kein Interesse daran zu haben, sich auf längerfristig angelegte Strategien einzulassen und unter deren Einfluss politisch bindende Verpflichtungen einzugehen. Denn dies würde die Spielräume seines okkasionell-opportunistischen Agierens einschränken.
Daraus leitet Münkler ab, dass alle Zusagen und Vereinbarungen zwischen der EU und den USA in den kommenden Jahren unter dem Vorbehalt stehen werden, dass der Mann im Weißen Haus es sich auch anders überlegen und, weil er sich mehr davon verspreche, das Gegenteil des Verabredeten tun könne. Darauf werden die Europäer nach Münklers Prognose dann ihrerseits kurzfristig reagieren müssen, was in ihrem System der mühsamen, zeitraubenden Beratungen und Kompromissbildungen kaum möglich sein werde. Für Münkler ist es daher nicht zuletzt der Rückzug der USA aus Europa, der eine grundlegende Reform der EU erforderlich mache, die wiederum auf der Agenda der Bundesregierung einen vorderen Platz einnehmen solle.
Als dritte Herausforderung macht Münkler den Import hochsubventionierter chinesischer Produkte in den europäischen Wirtschaftsraum aus, insbesondere der von Elektroautos. Diese Einfuhr werde mit den von Trump angekündigten Strafzöllen auf Importe aus China noch weiter ansteigen, da die Chinesen bestrebt sein würden, all das, was in den USA aufgrund der verhängten Zölle nicht mehr konkurrenzfähig sei, in den europäischen Markt zu pressen, der für sie die einzige attraktive Alternative zum amerikanischen Markt sei. Würden die Europäer dies "laufen lassen", würde eine Deindustrialisierung Europas die Folge sein, und dies an erster Stelle die deutsche Wirtschaft treffen.
Nach Münklers Analyse wird die EU entsprechende Abwehrmaßnahmen ergreifen müssen, doch sollten diese so angelegt sein, dass Europa nicht zum gefügigen Juniorpartner der USA in deren Wirtschaftskrieg gegen China werde. Das Ziel müsse eine eigenständige wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und Europa sein, die für beide Seiten vorteilhaft sei. Münkler sagt voraus: Je strikter der Ausschluss Chinas vom amerikanischen Markt sein werde, desto größer dürften die Chancen der Europäer ausfallen, die chinesische Politik in dieser weitreichenden Frage zu Kompromissen zu bewegen, da China kein Interesse daran haben könne, dass sich die EU notgedrungen der amerikanischen Strafzollpolitik anschließe.
Die USA wiederum - schätzt Münkler - würden einiges daransetzen, ein europäisch-chinesisches Handelsabkommen zu verhindern, etwa indem sie ihre militärischen Sicherheitsgarantien für Europa davon abhängig machten, dass die Europäer sich ökonomisch gegenüber China abschotten. Hier bezeichnet Münkler vor allem die Deutschen als hochgradig erpressbar. Es räche sich jetzt, dass sie nicht schon früher eine Reduzierung der sicherheitspolitischen Abhängigkeit Europas von den USA vorangebracht hätten. Dies werde nun unter Zeitdruck stattfinden müssen. Auf diesen Prozess müsse sich die deutsche Regierung einstellen, zum einen als Akteur einer Balance zwischen den Erwartungen der USA gegenüber der EU und den Bedrängungen der Europäer durch China und zum anderen im Hinblick auf eine eigene Wirtschafts- und Technologiepolitik, die den Industriestandort Deutschland zu erhalten und zu erneuern bestrebt sei.
Als vierten Punkt notiert Münkler für das politische Aufgabenbuch, dass sich die Europäer darüber Gedanken machen müssten, wie sie die illegale Migration nach Südeuropa begrenzen könnten, was vermutlich nur mit einer niedrigstufigen Integration der Maghrebstaaten in den EU-Raum möglich sein werde. Dies wiederum setze eine energische Unterstützung durch die deutsche Politik voraus.
Eine Art Klammer um diese vier Herausforderungen bildet Münklers Mahnung, dass die Politik einer "Regierung der politischen Mitte" besser erklärt und verdeutlicht werden müsse, als dies zuletzt der Fall gewesen sei. Dabei ist nach Münklers Überzeugung den längerfristigen Interessen Deutschlands gegenüber den kurzfristigen Wünschen und Bedürfnissen von Teilen der Bevölkerung eine ausschlaggebende Bedeutung beizumessen. Es müsse vor allem erklärt werden, welche Bedeutung eine stabile und handlungsfähige EU für Deutschland habe, für seine Sicherheit und seinen Wohlstand, und, inwiefern eine populistische Politik die Bundesrepublik auf längere Sicht viel Einfluss und noch mehr Geld kosten werde. Zugleich müssten in der operativen Politik langfristige Perspektiven eine größere Rolle spielen, nicht nur in der Klimapolitik, sondern auch bei der strategischen Aufstellung Deutschlands und Europas in einer sich schnell und nicht immer vorhersehbar verändernden Welt.
Damit gibt Münkler der zukünftigen Bundesregierung einen wertvollen Leitfaden an die Hand, den diese bereits aufzugreifen scheint. Vielleicht wird man dann in Zukunft in Deutschland weniger oft eiskalt erwischt werden, wenn die nächste Zeitenwende, der nächste Epochenbruch, die nächste neue Ära ausgerufen werden. Wer will schon immer nackt dastehen?
Herfried Münkler: "Macht im Umbruch". Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Rowohlt Verlag, Berlin 2025. 432 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 16.04.2025
Deutschland
Und wieder gibt es ein neues Buch von Herfried Münkler, " Macht im Umbruch." Nach "Welt in Aufruhr", in dem die
Weltpolitik analysiert wurde ( lesenswert), ist nun Deutschland der Hauptakteur. Die Wahl ist gerade vorbei, die Verhandlungen angeblich abgeschlossen, die SPD läßt die Mitglieder entscheiden ( Warum?) und alles wird gut, oder?
Münkler zeigt in diesem Buch, welches die zukünftige Rolle Deutschlands in der Weltpolitik sein wird. Wie immer sind seine Ausführungen klar und deutlich, für jeden verständlich geschrieben. Ob man/frau diese Thesen unterstützt oder nicht bleibt uns Leserinnen und Leser selbst überlassen.
Auch wer sich nicht für Politik interessiert, sollte einmal einen Blick hineinwerfen ( wofür gibt es Bibliotheken?) Es ist sogar recht spannend geschrieben und hinterlässt einen Hauch von Aufbruchstimmung. Das es dazu kommt, müssen unsere Parteien CDU/CSU und SPD jetzt beweisen und angehen. Und Taten folgen lassen. Heisse Luft bekommen wir schon durch den Klimawandel.........