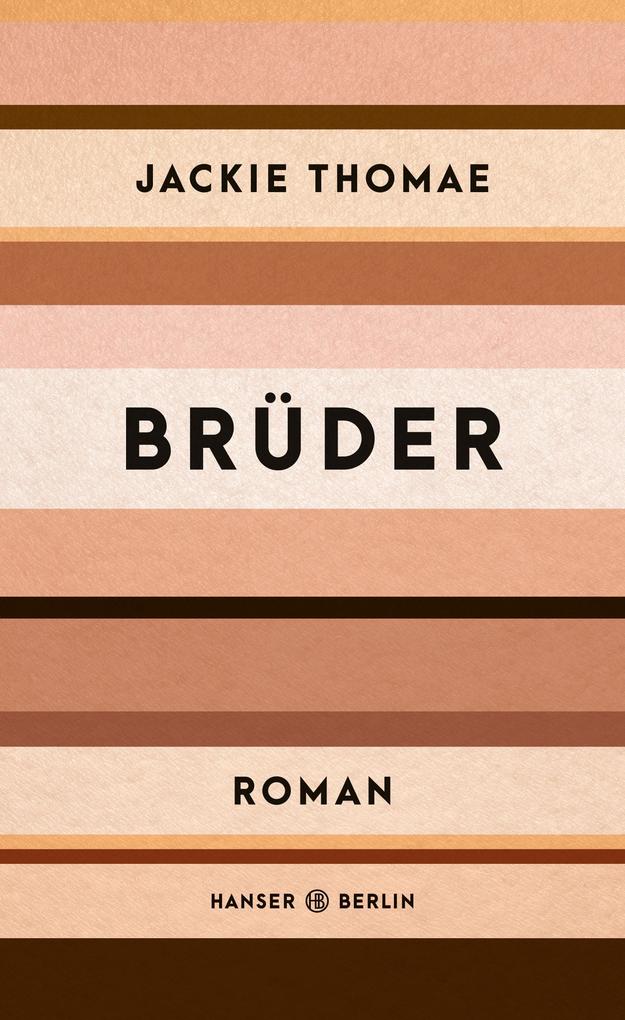
Zustellung: Di, 08.04. - Do, 10.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Zwei Männer. Zwei Möglichkeiten. Zwei Leben. Jackie Thomae stellt die Frage, wie wir zu den Menschen werden, die wir sind.
Mick, ein charmanter Hasardeur, lebt ein Leben auf dem Beifahrersitz, frei von Verbindlichkeiten. Und er hat Glück - bis ihn die Frau verlässt, die er jahrelang betrogen hat. Gabriel, der seine Eltern nie gekannt hat, ist frei, aus sich zu machen, was er will: einen erfolgreichen Architekten, einen eingefleischten Londoner, einen Familienvater. Doch dann verliert er in einer banalen Situation die Nerven und steht plötzlich als Aggressor da - ein prominenter Mann, der tief fällt. Brüder erzählt von zwei deutschen Männern, geboren im gleichen Jahr, Kinder desselben Vaters, der ihnen nur seine dunkle Haut hinterlassen hat. Die Fragen, die sich ihnen stellen, sind dieselben. Ihre Leben könnten nicht unterschiedlicher sein.
Mick, ein charmanter Hasardeur, lebt ein Leben auf dem Beifahrersitz, frei von Verbindlichkeiten. Und er hat Glück - bis ihn die Frau verlässt, die er jahrelang betrogen hat. Gabriel, der seine Eltern nie gekannt hat, ist frei, aus sich zu machen, was er will: einen erfolgreichen Architekten, einen eingefleischten Londoner, einen Familienvater. Doch dann verliert er in einer banalen Situation die Nerven und steht plötzlich als Aggressor da - ein prominenter Mann, der tief fällt. Brüder erzählt von zwei deutschen Männern, geboren im gleichen Jahr, Kinder desselben Vaters, der ihnen nur seine dunkle Haut hinterlassen hat. Die Fragen, die sich ihnen stellen, sind dieselben. Ihre Leben könnten nicht unterschiedlicher sein.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
19. August 2019
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
432
Autor/Autorin
Jackie Thomae
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
628 g
Größe (L/B/H)
221/154/43 mm
Sonstiges
Lesebändchen
ISBN
9783446264151
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Eine bestechend intelligente Prosa, die erklärt, wie wir heute leben. [ ] Eine solche soziologische Intelligenz gibt es selten in der deutschen Prosa." Denis Scheck, SWR, 15. 12. 19
"Wie kann man nur so genau und cool über Männer schreiben? Über Osten, Hautfarben, Normalität und Chaos? Deutsche Gegenwart, scharfsinnig-leicht." Alexander Cammann, Die Zeit, 21. 11. 19
"Dass das mit der Hautfarbe und dem Rassismus komplizierter ist, als die Social-Justice-Warrior denken, zeigt dieser beobachtungsstarke Gesellschaftsroman." Ijoma Mangold, Die Zeit, 21. 11. 19
"'Brüder' ist auf eine angelsächsisch anmutende Art ungemein intelligent, humorvoll und unterhaltsam zugleich geschrieben und bringt damit eine sonst weitgehend fehlende Qualität in die deutsche Literatur ein." Katharina Granzin, Frankfurter Rundschau, 08. 10. 19
"'Brüder' schildert die völlig unterschiedlich verlaufenden Leben zweier Söhne. Und eigentlich ist alles da, was zu einem Epos gehört: die Geschichte einer Generation und einer Epoche, die Folgen eines politischen Umbruchs, die Fragen nach der Ost- und Westidentität und die nach der Hautfarbe, weil beide Jungen einen schwarzen Vater haben. Genauer betrachtet ist der Roman aber etwas anderes: Er ist ein Epos, das Wert darauf legt, keins zu sein. . . er verzichtet auf Pathos und zu viel Bedeutung und ersetzt diese durch Ironie, Lakonik, Lust an der Unterhaltung und eine beeindruckende, manchmal fast schlafwandlerisch wirkende Leichtigkeit, mit der die Autorin erzählt. Er setzt keine Denkmäler, sondern Pointen, handelt von einem der aktuellsten Themen, nämlich Identitätspolitik, und sagt zugleich mit jedem Satz: Dies ist kein Roman über Hautfarbe und keiner über Rassismus, keiner über den Osten oder den Westen." Anna Prizkau, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 06. 10. 19
"'Brüder' weiß ziemlich viel über das Leben und die Welt zu erzählen und kann in wenigen Sätzen Szenen und Figuren anlegen, dass man mit den Ohren schlackert, wie da durch präzise skizzierte finanziell scheiternde Berliner Clubs und Resorts in Thailand und chinesische Großbaustellen galoppiert wird, als wäre es nichts. Und wie da über Hautfarben und deren Zwischentöne geschrieben wird, die mit der Handlung auf den ersten Blick nicht viel zu tun haben, aber an denen niemand so recht vorbeikommt, das hat man in dieser Subtilität zuletzt bei Zadie Smith gelesen." Andrea Diener, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05. 10. 19
"Thomae erzählt leicht und souverän, ein sanftes Allwissen könnte man ihre Technik nennen, denn alles Auktoriale geht in der Empathie auf, mit der sie, oft in erlebter Rede, die Handlung aus der Persektive ihrer Figuren schildert. . . . Es gelingt ihr einen tragfährigen epischen Bogen aufzuspannen. Schlüssig und doch im Bewusstsein des unergründlichen Zufalls wird geschildert, wie sich Persönlichkeiten über drei Jahrzehnte hinweg entfalten." Juliane Liebert, Die Zeit, 26. 09. 19
"Man kann sagen, dass 'Brüder' wirklich eine große deutsche Neuigkeit ist: Ein Roman, der von Herkunft und nicht-weißer Identität erzählt, ohne seine Formen und Fragen von diesem Thema abhängig zu machen." Marie Schmidt, Süddeutsche Zeitung, 17. 09. 19
"Brüder ist ein perfekt durchdachter, klug konzipierter und eloquent verfasster Gesellschaftsroman, dessen überbordende Leidenschaft und Dynamik zusammen mit Jackie Thomaes Fähigkeit, plastische Figuren zu zeichnen und in deren Psyche vorzudringen, Geist und Sinne schärfen. Ein schillerndes Aushängeschild zeitgenössischer deutscher Literatur." Gérard Otremba, Rolling Stone, 01. 09. 19
"Ein Plädoyer für den zweiten Blick und auch den dritten, ein Plädoyer gegen die Gefahr, farbfehlgeleitet durch die Welt zu gehen." Tobias Becker, Der Spiegel, 17. 08. 19
"Wie kann man nur so genau und cool über Männer schreiben? Über Osten, Hautfarben, Normalität und Chaos? Deutsche Gegenwart, scharfsinnig-leicht." Alexander Cammann, Die Zeit, 21. 11. 19
"Dass das mit der Hautfarbe und dem Rassismus komplizierter ist, als die Social-Justice-Warrior denken, zeigt dieser beobachtungsstarke Gesellschaftsroman." Ijoma Mangold, Die Zeit, 21. 11. 19
"'Brüder' ist auf eine angelsächsisch anmutende Art ungemein intelligent, humorvoll und unterhaltsam zugleich geschrieben und bringt damit eine sonst weitgehend fehlende Qualität in die deutsche Literatur ein." Katharina Granzin, Frankfurter Rundschau, 08. 10. 19
"'Brüder' schildert die völlig unterschiedlich verlaufenden Leben zweier Söhne. Und eigentlich ist alles da, was zu einem Epos gehört: die Geschichte einer Generation und einer Epoche, die Folgen eines politischen Umbruchs, die Fragen nach der Ost- und Westidentität und die nach der Hautfarbe, weil beide Jungen einen schwarzen Vater haben. Genauer betrachtet ist der Roman aber etwas anderes: Er ist ein Epos, das Wert darauf legt, keins zu sein. . . er verzichtet auf Pathos und zu viel Bedeutung und ersetzt diese durch Ironie, Lakonik, Lust an der Unterhaltung und eine beeindruckende, manchmal fast schlafwandlerisch wirkende Leichtigkeit, mit der die Autorin erzählt. Er setzt keine Denkmäler, sondern Pointen, handelt von einem der aktuellsten Themen, nämlich Identitätspolitik, und sagt zugleich mit jedem Satz: Dies ist kein Roman über Hautfarbe und keiner über Rassismus, keiner über den Osten oder den Westen." Anna Prizkau, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 06. 10. 19
"'Brüder' weiß ziemlich viel über das Leben und die Welt zu erzählen und kann in wenigen Sätzen Szenen und Figuren anlegen, dass man mit den Ohren schlackert, wie da durch präzise skizzierte finanziell scheiternde Berliner Clubs und Resorts in Thailand und chinesische Großbaustellen galoppiert wird, als wäre es nichts. Und wie da über Hautfarben und deren Zwischentöne geschrieben wird, die mit der Handlung auf den ersten Blick nicht viel zu tun haben, aber an denen niemand so recht vorbeikommt, das hat man in dieser Subtilität zuletzt bei Zadie Smith gelesen." Andrea Diener, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05. 10. 19
"Thomae erzählt leicht und souverän, ein sanftes Allwissen könnte man ihre Technik nennen, denn alles Auktoriale geht in der Empathie auf, mit der sie, oft in erlebter Rede, die Handlung aus der Persektive ihrer Figuren schildert. . . . Es gelingt ihr einen tragfährigen epischen Bogen aufzuspannen. Schlüssig und doch im Bewusstsein des unergründlichen Zufalls wird geschildert, wie sich Persönlichkeiten über drei Jahrzehnte hinweg entfalten." Juliane Liebert, Die Zeit, 26. 09. 19
"Man kann sagen, dass 'Brüder' wirklich eine große deutsche Neuigkeit ist: Ein Roman, der von Herkunft und nicht-weißer Identität erzählt, ohne seine Formen und Fragen von diesem Thema abhängig zu machen." Marie Schmidt, Süddeutsche Zeitung, 17. 09. 19
"Brüder ist ein perfekt durchdachter, klug konzipierter und eloquent verfasster Gesellschaftsroman, dessen überbordende Leidenschaft und Dynamik zusammen mit Jackie Thomaes Fähigkeit, plastische Figuren zu zeichnen und in deren Psyche vorzudringen, Geist und Sinne schärfen. Ein schillerndes Aushängeschild zeitgenössischer deutscher Literatur." Gérard Otremba, Rolling Stone, 01. 09. 19
"Ein Plädoyer für den zweiten Blick und auch den dritten, ein Plädoyer gegen die Gefahr, farbfehlgeleitet durch die Welt zu gehen." Tobias Becker, Der Spiegel, 17. 08. 19
 Besprechung vom 05.10.2019
Besprechung vom 05.10.2019
Keine Trommeln zu mögen reicht nicht
Jackie Thomaes Roman "Brüder" betreibt ein großartiges Spiel mit unseren Klischees
Verrisse schreiben sich sprachlich immer rasant runter, aber wenn es was zu loben gibt, dann steht man vor Wörtern wie "lebensklug" und "welthaltig" und zuckt zurück, weil sie so abgeschmackt klingen und man das jetzt wirklich nicht ernsthaft aufschreiben will. Und Vergleiche helfen auch nicht weiter. Aber irgendwie muss man die Sache ja angehen, also: Jackie Thomaes zweiter Roman "Brüder" weiß ziemlich viel über das Leben und die Welt zu erzählen und kann in wenigen Sätzen Szenen und Figuren anlegen, dass man mit den Ohren schlackert, wie da durch präzise skizzierte finanziell scheiternde Berliner Clubs und Resorts in Thailand und chinesische Großbaustellen galoppiert wird, als wäre es nichts. Und wie da über Hautfarben und deren Zwischentöne geschrieben wird, die mit der Handlung auf den ersten Blick nicht viel zu tun haben, aber an denen niemand so recht vorbeikommt, das hat man in dieser Subtilität zuletzt bei Zadie Smith gelesen.
So, da ist er, der Vergleich, es wundert einen, dass er nicht schon viel früher irgendwo gefallen ist. Er liegt auch auf der Oberfläche so nahe: Die eine Autorin jamaikanisch-britisch, die andere mit einer ostdeutschen Mutter und einem Vater aus Guinea, beide aufgewachsen in Europa. Aber die Sache geht tiefer, denn beide, Smith wie Thomae, haben sich für das Prinzip des Erzählens entschieden und füllen ihre Bücher mit überbordenden, fiktionalen Biographien, beide haben ein Händchen für und einen sehr genauen Blick auf Lebensläufe und Zeitgeistumstände und einen Humor, der nie ins Zynische kippt - um jetzt nicht auch noch das fürchterliche Wort "warmherzig" zu verwenden, auch wenn es die Sache trifft.
Jackie Thomae hat bereits mit ihrem Debüt, dem Trennungsreigen "Momente der Klarheit" gezeigt, dass sie sich in Figuren hineinfinden kann, die in immer neuen Konstellationen übereinander nachgedacht haben und aneinander gescheitert sind. In "Brüder" nun kommen noch ein paar Dimensionen hinzu: weniger Figurenreigen, mehr Welt. Der senegalesische Vater der titelgebenden Brüder studierte in der DDR Medizin und wurde Zahnarzt. Er war kein Einzelfall, Angehörige soeben unabhängig gewordener afrikanischer Staaten waren im realexistierenden Sozialismus sehr willkommen, denn vielleicht konnte man die junge Elite ferner Länder von seinen Vorzügen überzeugen. Idris, so heißt der Vater, überzeugte sich zunächst von den Vorzügen der ostdeutschen Frauen und zeugte zwei Jungen, Mick und Gabriel. Soweit die Ausgangslage.
Diese beiden leben ziemlich unterschiedliche Leben. Mick trudelt durch die neunziger Jahre und durch das Berliner Nachtleben, das mittlerweile ein gesamtdeutsches ist, denkt nicht allzuviel über irgendwas nach und hat etwas seltsame Freunde, vermutlich die falschen. Er fährt oft im Taxi durch die Nacht, telefoniert, um irgendetwas oder irgendjemanden ranzuschaffen und zieht durch die Betten. Er sieht gut aus und weiß es auch, denn er hat hart daran gearbeitet. In der Juristin Delia, einer Frau aus gutem Hause, findet er überraschenderweise eine Partnerin in crime, wortwörtlich, sie schmuggelt mit ihm sogar Drogen, so richtig interkontinental, im Flugzeug. Die völlig aus dem Ruder laufende Drogenschmuggelszene kommt ziemlich am Anfang vor und ist wirklich ein herrlich hysterischer Slapstick; wer sich da nicht in dieses Buch verliebt, dem ist nicht mehr zu helfen. Denn auch das haben Jackie Thomae und Zadie Smith gemeinsam: Sie können überzeugend über halbstarke Bengel schreiben, die demnächst Ärger an den Hals bekommen, und zwar so, dass sich in keinem Moment ein gouvernantenhafter Zeigefinger hebt, eher hört man eine leise Belustigung heraus, als hätte die Autorin beim Schreiben still in sich hineingekichert. Die Rezensentin zumindest kicherte haltlos.
In der zweiten Hälfte wird das Buch dann erwachsen, denn es ist Gabriel gewidmet, dem anderen der beiden Brüder. Gabriel ist hoch seriös, lebt in London und ist ein erfolgreicher Architekt. Im Wechsel mit seiner Frau Fleur erzählt er seine Geschichte, und Fleur beschreibt ihn so: "Gabriel richtete sein gesamtes Lebenskonzept darauf aus, keine Stereotypen zu erfüllen. Dafür fuhr er eine beeindruckende Ansammlung an Gegenklischees auf", also eine Vorliebe für klassische Musik, konservative Kleidung, ein betont unkumpeliger Umgang mit Menschen, die ihn nicht interessieren, und das sind die meisten. "Keine Trommeln zu mögen macht aus dir keinen Weißen, Gabriel", rutscht es Fleur einmal heraus, und sie trifft ihn damit hart, denn Gabriel ist sehr damit beschäftigt, seine eigene Hautfarbe zu ignorieren. Er schafft es ja kaum, sich für seine deutsche Herkunft zu interessieren, wie soll ihm da etwas an diffusen afrikanischen Wurzeln liegen?
Auch wenn in dieser zweiten Hälfte keine koksgefüllten Kondome mehr geschluckt werden, ist sie nicht minder unterhaltsam, denn Gabriel hat einen reichlich misanthropischen Blick auf das Milieu, das er sich selbst ausgesucht hat und dann doch nur selten erträgt. Er sprengt Abendessen im südfranzösischen Ferienhaus mit Meinungen zu Kindererziehung und hadert mit der Vorliebe seines Sohnes Albert für sein Schlagzeug ("Kann er nicht ein schöneres Instrument lernen?"). Er bemüht sich, alle englischen Mittelklasseklischees zu erfüllen, und rennt im entscheidenden Moment doch immer wieder dagegen an. Er arbeitet zu viel, und irgendwann kommt es zu einem Kurzschluss, der ihn aus der Bahn seines geregelten Lebens wirft.
Auf den ersten Blick haben die beiden Brüder, die eigentlich Halbbrüder sind, eine sehr ähnliche Ausgangsbasis, und doch entwickeln sie sich so völlig unterschiedlich. Denn am Ende kommt es womöglich darauf an, auf welche Menschen man zufällig stößt, welches Temperament man mitbringt und ob man eigentlich weiß, was man will. Diese ganzen Lebensdinge eben. Gabriel weiß es sehr früh und setzt es mit einiger Konsequenz um, Mick braucht etwas länger. Und so geht es am Ende doch wieder nicht um Hautfarben, sondern um die Biographie zweier junger Männer, die eben sehr verschieden sind und sich nur durch genetische Zusammenhänge zufällig ein wenig ähneln und aus der Masse der Menschen herausstechen, die sie umgeben. So wichtig ist Genetik ja wirklich nicht. Dass diese "Brüder" auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stehen, ist jedenfalls hochverdient.
ANDREA DIENER
Jackie Thomae: "Brüder". Roman.
Hanser Berlin Verlag, Berlin 2019. 416 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 31.10.2024
Zwei Brüder vom selben senegalesischen Vater wachsen getrennt voneinander in der DDR auf. Interessant gezeichnet, klasse geschrieben. 4,5*
LovelyBooks-Bewertung am 05.08.2022
Party, durchgemachte Nächte, Alkohol, Drogen, Techno. Micks Leben findet in der Nacht statt, der Tag dient ihm zur Erholung für den nächsten Exzess und für den notdürftigen Verdienst seines Lebensunterhalts. Irgendetwas findet sich immer, um Miete, Auto und Essen zu bezahlen, doch Mick lebt nicht, um zu arbeiten, sondern um zu feiern. Im freiheitstrunkenen wiedervereinten Berlin der 1990ern findet er seine Bestimmung jenseits der Konventionen von Ausbildung, Beruf, Ehe und Kindern. Dass dabei Menschen und persönliche Entwicklungen auf der Strecke bleiben, erkennt er erst später; im Moment des Rausches fühlt sich jede einzelne Nacht perfekt und richtig an.Auch Gabriel kennt den Rausch: Wenn die Wochen mit 70 Stunden Arbeit am Stück aneinander vorbeirasen, wenn das Großprojekt bereits vor der Deadline erfolgreich beendet wurde, wenn er für den nächsten Megaauftrag im Flieger um den halben Globus jettet. Sweet life of a workaholic, der sich mit Fleiß, Ehrgeiz und Talent dahin gebracht hat, wo er immer hinwollte - ein schönes Haus in London, ein eigens Architekturbüro, Frau und Kind. Zeit für Erinnerungen bleiben kaum: an seine Kindheit in der DDR, an sein Aufwachsen bei den Großeltern, an seine verstorbene Mutter und seinen abwesenden Vater, der ihm nichts hinterlassen hat außer seiner Hautfarbe. Erst der Burnout zwingt Gabriel zur Vollbremsung, die nicht ohne Kollateralschäden erfolgt.Hedonist vs. Highperformer. Westjugend nach dem Rübermachen vs. Sozialisation im Arbeiter- und Bauernstaat. Muttersöhnchen vs. Halbwaise. Träumer vs. Durchplaner. Antimonogamist vs. Loyaler Ehemann. Jackie Thomae erzählt in ihrem RomanBrüder die Leben zweier komplett unterschiedlicher Brüder, die nichts voneinander wissen und deren einzige Gemeinsamkeit scheinbar darin besteht, vom gleichen Vater abzustammen- einem senegalesischen Austauschstudenten - und dessen Abwesenheit in ihrem Leben zwar immer gespürt, aber wenig darunter gelitten zu haben. Doch beim genauen Lesen wird deutlich, dass Mick und Gabriel sich ähnlicher sind als man denkt, insbesondere, was ihr Hang zum Extremen angeht. Und damit ist Jackie Thomae ganz schnell bei der ganz großen Frage, warum wir der sind, wer wir sind. Gene oder Umfeld, Natur oder Sozialisation?Was prägt uns? Warum sind wir der Mensch, der wir sind?Es ist der große Verdienst der Autorin diese großen Fragennicht mit der Holzhammermethode zu verhandeln, sondern im Gegenteil scheinbar im Nebenbeiwährend sie von Clubnächten und Dienstreisen erzählt.Brüderistein atmosphärischer Roman, der auf über 500 Seiten die Leser:innen in die unterschiedlichen Lebenswelten von Mick und Gabriel hineinsaugt und sie dabei die Relevanz der behandelten Themen vergessen lässt. Denn natürlich kann die Identitätsfrage in Micks und Gabriels Fall nicht losgelöst von der Hautfarbe betrachtet werden: nicht in Deutschland, vor allem nicht in Ostdeutschland der 1990er Jahre. DochRassismuswird inBrüdernicht anhand Rostock-Lichtenhagens greifbar, sondern an den kleinen Irritationen des Alltags, an den Momenten, wo beiden Brüdern signalisiert wird, dass sie anders sind und bleiben, egal für wie angepasst sie sich halten.Daneben bestichtBrüder durch eine leichtfüßige Sprache, einen modernen Sound, Witz und interessanten Frauenfiguren, die das Buch zwar einen Männerroman bleiben lassen, ihn aber nicht darauf reduzieren. Die Lektüre geht leicht und angenehm von der Hand, der Roman istUnterhaltung auf hohem Niveau- etwas, was mich die Buchpreisnominierung in 2019 nicht völlig verstehen lässt. Gleichzeitig muss ich gestehen, dass ich erst zum Schluss gemerkt habe, wie sehr das Buch einen doch beschäftigt und wie sehr man das Leben der beiden Protagonisten doch schließlich durchdrungen hat.Brüderist daher eines dieser Bücher, das man - trotz mancher Hänger zwischendurch -unbedingt zu Ende gelesen haben muss, um zu erkennen, wie sehr es wirkt und wie stark es doch jenseits der vermeintlich leichten Textur ist.4 Sterne und eine große Empfehlung für diesen Lesespaß!








