Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
Ihr 18% Rabatt11 auf ausgewählte Eurographics Puzzles mit dem Code PUZZLE18
Jetzt einlösen
mehr erfahren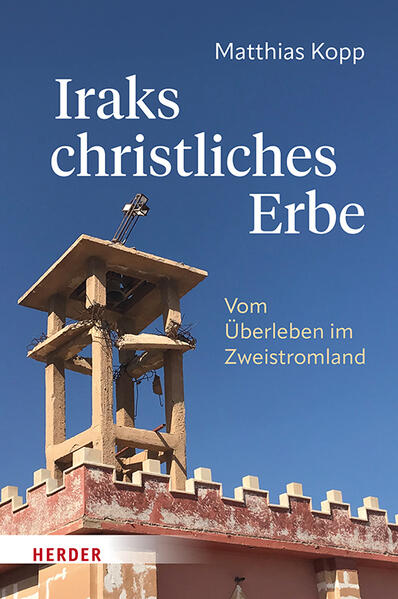
Zustellung: Mi, 26.02. - Fr, 28.02.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Erstmals wird mit diesem Buch eine alle Epochen umfassende Monographie über den Irak, und zwar aus Sicht des Christentums, das im Irak vor seinem Ende steht, vorgelegt. Den Kampf der irakischen Christen für ihr kulturelles Erbe und ihren blutigen und steinigen Weg bis heute zeichnet der Autor nach. Die religionswissenschaftliche Untersuchung rückt dabei auch islamische Strömungen sowie religiöse Minderheiten und Ethnien, insbesondere die Jesiden, in den Fokus. Das Buch ist das Kaleidoskop eines reichen Vermächtnisses in der Wiege der Menschheit.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
27. Januar 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
872
Autor/Autorin
Matthias Kopp
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
1446 g
Größe (L/B/H)
227/164/66 mm
ISBN
9783451024375
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 04.02.2025
Besprechung vom 04.02.2025
Zaghafter christlicher Neuanfang im Irak
Matthias Kopp beschreibt das schwierige Umfeld für die Kirchen in dem Land und ihre reichen Traditionen
Der Exodus der Christen aus dem Irak hat sich verlangsamt. Noch immer verlassen zwar jeden Monat im Durchschnitt zwanzig christliche Familien ihre Heimat. Nach Jahren der Verfolgung, die in der Terrorherrschaft des "Islamischen Staats" (IS) ihren blutigen Höhepunkt gefunden hat, gibt es jedoch ermutigende Zeichen dafür, dass im Zweistromland, das auf eine zweitausendjährige Geschichte des Christentums zurückblickt, christliches Leben wieder zu blühen beginnt.
Matthias Kopp nennt in seiner umfangreichen Studie zum reichen christlichen Erbe im Irak solche Beispiele. So hat die auf den Apostel Thomas und dessen Jünger Addai zurückgehende "Assyrische Kirche des Ostens" nach einem jahrzehntelangen Exil in den USA ihren Patriarchatssitz 2015 wieder in den Irak zurückverlegt; die neue Patriarchatskirche wurde 2022 in der kurdisch-irakischen Stadt Erbil eingeweiht. Ebenfalls 2015 wurde in Erbil eine katholische Universität gegründet.
Den Neubeginn des Christentums im Irak setzt Kopp auf das Jahr 2018 fest, als mit maßgeblicher Unterstützung gerade deutscher christlicher Hilfswerke nach dem Ende des IS-Terrors der Wiederaufbau Fortschritte gemacht hat und mehr als 25.000 Christen in ihre Heimatorte, vor allem in der Ninive-Ebene um Mossul, zurückkehren konnten.
In Mossul, der zweitgrößten Stadt des Iraks, setzten die UNESCO und die Vereinigten Arabischen Emirate zwei große Kirchen instand. Im November 2022 läuteten in Mossul, die Hauptstadt des IS, erstmals wieder Kirchenglocken, und der Bischof der mit Rom unierten chaldäischen Kirche bezeichnete seine Stadt als eine der "ruhigsten Gegenden des Iraks".
Breiten Raum nimmt bei Kopp, dem Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz, die Irakreise von Papst Franziskus im März 2021 ein. Der Besuch habe dem pastoralen und seelsorgerischen Leben viele Impulse gegeben, er stehe für den Aufbruch der Ostkirche, so Kopp. Die ökumenische Zusammenarbeit der Kirchen sei so eng wie nie zuvor, und die irakische Regierung habe den ersten Jahrestag des Papstbesuchs zum nationalen Tag der Toleranz und Koexistenz ausgerufen. Offen bleibe indes, ob die Christen dauerhaft im Lande blieben, Rückkehrer aus Europa gebe es kaum.
Viel Platz räumt Kopp der diskreten vatikanischen Nahostdiplomatie ein. Sie denke und handle politisch, habe die Menschen im Blick, etwa bei der Kritik an den UN-Sanktionen von 1991 gegen den Irak und bei der Ablehnung des Dritten Golfkriegs von 2003. Der Autor bettet die Geschichte des Christentums im Irak in die Geschichte des ganzen Landes ein und zeigt, etwa bei einer Krise zwischen Staatspräsident Abdul Latif Raschid und dem chaldäischen Patriarchen Louis Sako, dass der Irak weit davon entfernt ist, ein normales Land zu sein.
So hatte Raschid im Juli 2023 auf Betreiben des Anführers der chaldäischen "Babylon-Miliz", die weite Teile der christlichen Ninive-Ebene kontrolliert, dem angesehenen Patriarchen die Verfügung über die Einnahmen und das Vermögen der Kirche entzogen. Die Krise illustriert, weshalb der Irak nicht zur Ruhe kommt: Denn noch immer unterhält jede Konfession zum Schutz ihrer Mitglieder Milizen, die aber auch Instrumente der Macht Einzelner sind.
Die Geschichte der Christen im Irak ist eine Geschichte der Emigration. Während des Ersten Weltkriegs flüchteten assyrische Christen vor der Gewalt der jungtürkischen Truppen; nach 1933 verließen sie den Irak, weil die assyrische Kirche nationale Ambitionen auf Autonomie verfolgte und Ziel von Angriffen wurde. Eine weitere Auswanderungswelle folgte in den Sechzigerjahren, unter dem Gewaltherrscher Saddam Hussein konnten regimetreue Christen jedoch frei leben. Der große Exodus setzte mit den drei Golfkriegen (1980 bis 1988, 1991 und 2003) ein. Seit dem Sommer 2004 nahmen die Anschläge landesweit zu, 2006 war jeder fünfte Iraker auf der Flucht. Die wirtschaftlich desaströse Lage, die tägliche Gewalt und der islamistische Fundamentalismus waren die Ursachen. Bei den Christen kam hinzu, dass sie mit dem Westen und den Invasoren gleichgesetzt wurden.
Es war das Ende der friedlichen Koexistenz. Dazu beigetragen hat, dass mit dem Einmarsch der Amerikaner fundamentalistische evangelikale Missionare das friedliche Miteinander zerstört haben, allen voran die Southern Baptist Church mit Franklin Graham, der als Sohn von Billy Graham durch radikale Missionierungsversuche aufgefallen ist. Parallel dazu haben Dschihadisten 2006 den "Islamischen Staat" gegründet, der 2014 das Kalifat mit Sitz in Mossul ausrief.
Wer konnte, verließ den Irak, so auch die meist gut ausgebildeten Christen der irakischen Mittelschicht. 1987 machten sie mit 1,1 Millionen Gläubigen noch 8 Prozent der Bevölkerung aus, 2012 waren es bei 850.000 Gläubigen noch 2,6 Prozent, 2017 bei 250.000 weniger als 0,8 Prozent. Besonders gelitten hat die assyrische Kirche, die aufgrund ihres gescheiterten Machtanspruchs früh eine in der Diaspora zerstreute Kirche wurde. Von weltweit 400.000 Mitgliedern leben nur noch 25.000 im Irak. So wurde die chaldäische Kirche die größte: Von weltweit 400.000 Gläubigen lebt gut die Hälfte im Irak.
Dabei ist die Assyrische Kirche des Ostens die ursprünglichste der erhaltenen der Kirchen Mesopotamiens, ihr Patriarch war das Oberhaupt aller Christen des Ostens. Sie verstand sich lange identitätsstiftend als eine Nation. Die chaldäische Kirche entstand um 1552 nach einer Abspaltung von der assyrischen Kirche, sie ging eine Union mit Rom ein, nannte sich aber nicht "assyrisch-katholisch", sondern chaldäisch, um ihre Zugehörigkeit zur arabischen Welt zu betonen.
Der Irak erhält sein biblisches und christliches Erbe. Schließlich liegt "Ur in Chaldäa", mit dem die biblische Erzählung beginnt, hier im Süden des Zweistromlandes. Auch in der frühchristlichen Ära war Mesopotamien, gelegen zwischen Byzanz und dem Persischen Reich, prägend. Von beiden Seiten nahmen die frühen Christen Ideen auf, was zu einer großen theologischen Vielfalt führte. Die Spreu trennt sich vom Weizen, die Dogmen von Irrlehren.
Kopps Monographie wurde im Juli 2024 als Dissertation angenommen. Entsprechend umfangreich ist der Fußnotenapparat. Trotz der 872 Seiten enthält die Monographie indes keine Karten und keine Fotos von den eindrucksvollen christlichen Stätten, keinen Personenindex und keinen Ortsindex. Statt der langen Reihen von Bischofsnamen würde man sich zudem mehr Aufschluss darüber wünschen, wie im Frühchristentum die vielfältigen regionalen Diskurse verlaufen sind, die letztlich in Dogmen mündeten.
Ohne eine Erziehung zum Frieden und zur Versöhnung hätten weder der Irak noch die Christen dort eine Zukunft, bilanziert Kopp. Die Christen im Irak, die zur besonderen Identität des Landes wesentlich beitragen, haben einen Auftrag, damit dies gelingt. Bei allen Bedrohungen: Die Chancen zum Überleben und zur Bewahrung des christlichen Erbes im Zweistromland haben sich wieder verbessert. RAINER HERMANN
Matthias Kopp: Iraks christliches Erbe. Vom Überleben im Zweistromland.
Herder Verlag, Freiburg 2025. 872 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Iraks christliches Erbe" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









