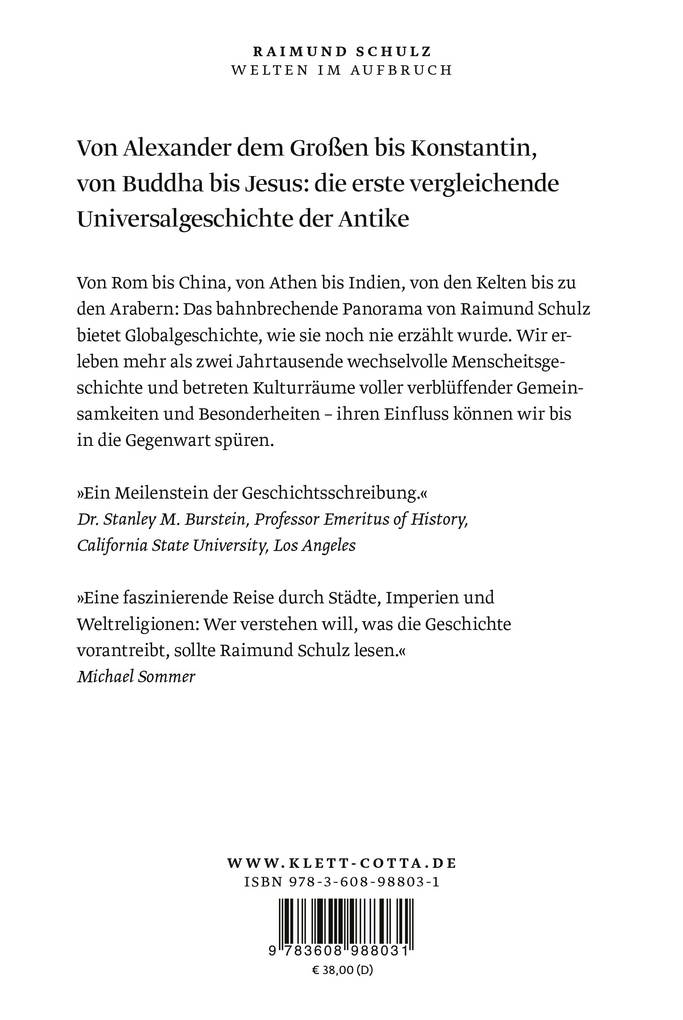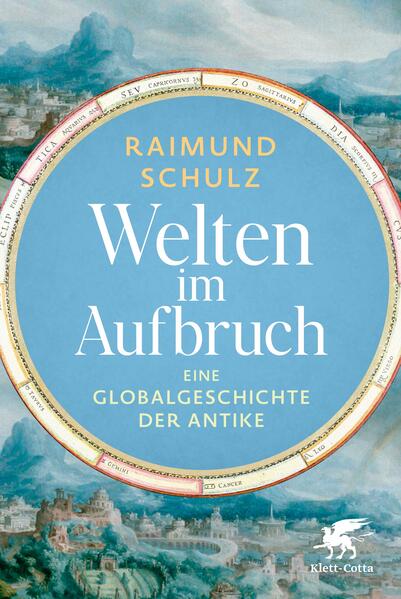
Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Von Alexander dem Großen bis Konstantin, von Buddha bis Jesus: Die erste vergleichende Universalgeschichte der Antike
Von Rom bis China, von Athen bis Indien, von den Kelten bis zu den Arabern: Das bahnbrechende Panorama von Raimund Schulz bietet Globalgeschichte, wie sie noch nie erzählt wurde. Wir erleben mehr als zwei Jahrtausende wechselvolle Menscheitsgeschichte und betreten Kulturräume voller verblüffender Gemeinsamkeiten und Besonderheiten - ihren Einfluss können wir bis in die Gegenwart spüren.
Die Welten Eurasiens haben Anfänge, die weit in die Vergangenheit zurückreichen: Unwirklich mutet an, dass viele große Kulturen und Reiche durch nomadische Eroberer begründet wurden, die schon in der Antike globale Handelsverbindungen über riesige Distanzen knüpften, von der Ostsee bis ans Chinesische Meer, von der Sahara bis nach Sibirien. Menschen bewegten sich auf den großen Pfaden der Welt hin und her, errichteten und zerstörten Städte und Großreiche. Herrscher und Imperien kämpften um Einflusszonen und Reichtümer. Doch auch die großen Weltreligionen nehmen ihren Anfang in der Antike. Sie sind Ausdruck einer in ganz Eurasien lebendigen Überzeugung, dass es jenseits der Welt der Menschen Mächte gibt, die man beeinflussen, aber auch fürchten musste. Asien und Europa waren bei allen Katastrophen von einem Optimismus geprägt, der dem Westen jetzt verloren geht, im Osten aber immer neue Dynamiken entfesselt. Warum ist das alles in der Antike entstanden? Wie hingen die Großreiche und Kulturen zusammen? Und inwiefern prägen uns diese Entwicklungen bis heute? Der Globalhistoriker Raimund Schulz bietet hierauf überraschende Antworten und schärft gleichzeit unser Verständnis für die Welt von heute.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. März 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage 2025
Ausgabe
Ungekürzt
Seitenanzahl
494
Autor/Autorin
Raimund Schulz
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
842 g
Größe (L/B/H)
231/165/46 mm
Sonstiges
gebunden mit Schutzumschlag, mit zahlreichen Karten und einem farbigen Tafelteil
ISBN
9783608988031
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Der Bielefelder Historiker Raimund Schulz hat eine so gelehrte wie vergnügliche Geschichte der Antike geschrieben, in der Europa nicht mehr im Mittelpunkt steht. Das hat einen erstaunlichen Effekt. «
Johan Schloemann, Süddeutsche Zeitung, 20. März 2025 Johan Schloemann, Süddeutsche Zeitung
Johan Schloemann, Süddeutsche Zeitung, 20. März 2025 Johan Schloemann, Süddeutsche Zeitung
 Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Imperien im Austausch
Als sich das Chinesische und das Römische Reich näherkamen: Raimund Schulz versucht sich an einer Globalgeschichte der Antike.
Von Jannis Koltermann
Von Jannis Koltermann
Als 2009 Jürgen Osterhammels "Die Verwandlung der Welt" erschien, wurde seine etwas andere "Geschichte des 19. Jahrhunderts" als "Meilenstein" der deutschsprachigen Geschichtsschreibung gefeiert. Das mehr als tausendseitige Werk setzte die Globalgeschichte mit Nachdruck auf die Agenda und brachte dem Autor den Leibniz-Preis ebenso ein wie die Einladung, den Festvortrag auf Angela Merkels sechzigstem Geburtstag zu halten - schon das Ausweis einer hervorstechenden Wirkung sowohl in der Wissenschaft als auch in der breiteren Öffentlichkeit.
Es überrascht also, dass bislang kein Althistoriker versucht hat, in Osterhammels Fußstapfen zu treten. Daran, dass die antike Geschichte einfach nicht global war, kann es jedenfalls nicht gelegen haben: Zwar war der Interaktionsrahmen in den Jahrhunderten um Christi Geburt enger gesteckt als in der Neuzeit, Amerika noch nicht entdeckt, der Austausch mit Subsahara-Afrika minimal. Innerhalb des eurasischen und nordafrikanischen Raums gab es jedoch eine Fülle von Zivilisationen, die mittelbar oder unmittelbar miteinander in Kontakt standen, deren Entwicklungen aufeinander aufbauten, zusammenliefen oder auseinandertraten. In der Forschung sind Studien etwa über die antike Seidenstraße oder das Han- im Vergleich zum Römischen Reich denn auch längst etabliert.
Sechzehn Jahre nach Osterhammels "Verwandlung der Welt" legt Raimund Schulz nun die erste große "Globalgeschichte der Antike" in deutscher Sprache vor. Für diese Aufgabe scheint Schulz, Professor für Alte Geschichte in Bielefeld, bestens qualifiziert: Schon 2016 veröffentlichte er eine lesenswerte Monographie über die "großen Entdeckerfahrten und das Weltwissen der Antike". Nun möchte er diesen vernetzungsgeschichtlichen offensichtlich um einen vergleichenden Ansatz erweitern, also den Blick auf jene Bereiche ausdehnen, in denen Interaktionen weniger entscheidend waren, sich verschiedene Reiche und Kulturen aber dennoch erkenntnisfördernd nebeneinanderstellen lassen.
Er bewerkstelligt dies in fünf Kapiteln, je einem zu Nomaden, Städten, Imperien, Handel, Religion. Was auf den ersten Blick nach einem streng thematischen Aufbau aussieht, wird auf den zweiten Blick allerdings deutlich komplizierter. Denn durch Anordnung und Inhalt der Kapitel scheint Schulz, ohne es je auszusprechen, zugleich eine chronologische Gliederung zu verfolgen. So geht es im ersten Kapitel um viele Nomadenvölker, die lange vor dem eigentlich avisierten Zeitraum von ungefähr 1000 v. Chr. bis 200 n. Chr. lebten; die keltischen und germanischen Stämme aber, die später immer wieder ins Römische Reich einfielen, bleiben außen vor. Das Kapitel zu Städten wiederum handelt nur von ihrem "Aufstieg" bis ins sechste Jahrhundert v. Chr. und folglich nicht von Rom und Alexandria, Chang'an und Luoyang, einigen der größten und bedeutendsten Städte der Antike.
Möchte Schulz mit dieser Gliederung eine fortschreitende Globalisierung der antiken Lebenswelt suggerieren? Von weitgehend isolierten Nomaden könnte der Weg über miteinander verbundene Städte zur Imperienbildung führen und schließlich zur gegenseitigen Vernetzung der Imperien durch Handel. Eine entsprechende, zweifellos bedenkenswerte These wird von Schulz aber nirgends formuliert. Vielmehr wehrt er sich ausdrücklich dagegen, das Nomadentum nur als Vorstufe zur Entwicklung der Städte zu betrachten, weil viele Verbände zwischen beiden Lebensformen hin und her gewechselt seien.
So bleibt der Eindruck, dass seine Mischstruktur angesichts der Komplexität der Materie das Schlechtere aus zwei Welten vereint. Einerseits steht der Wunsch nach chronologischer Präzision typologisch geschärften Vergleichen im Weg, etwa einer beispielhaften oder idealtypischen griechischen mit einer entsprechenden indischen Stadt. Andererseits verhindert der thematische Zuschnitt der Kapitel eine angemessene Würdigung der einschneidenden globalhistorischen Ereignisse: Der Alexanderzug wird in wenigen Sätzen im Kontext des Makedonenreichs abgehandelt, seine Folgen finden bloß am Rande Erwähnung.
Auch der innere Aufbau der Kapitel erscheint nicht immer glücklich. Hier gliedert Schulz fast ausnahmslos geographisch. Beim Thema "Imperien" wird ein Reich nach dem anderen auf wenigen Seiten abgehandelt, vom assyrischen über das athenische bis zum chinesischen, ohne übergreifende Einleitung oder Fazit. Auf den Leser wirkt das bald ermüdend: Man erhält zu wenig Informationen, um beispielsweise den Aufstieg des Maurya-Reichs in Indien in einen größeren geschichtlichen Kontext einordnen zu können, aber zu viele, um nur die wichtigsten Eigenheiten in Erinnerung zu behalten. Zum Vergleich: Osterhammel stellt in seinem Kapitel zu Imperien anfangs die fünf wichtigsten Entwicklungen des neunzehnten Jahrhunderts vor, grenzt dann verschiedene Typen voneinander ab, um schließlich genauer auf wenige herausstechende Fälle wie das "British Empire" einzugehen.
Einen Mangel an Kenntnissen kann man Schulz freilich nicht vorwerfen - es ist vielmehr beeindruckend, wie er den verschiedenen eurasischen Zivilisationen fast durchweg dieselbe Aufmerksamkeit widmet. Zu selten gelingt es ihm aber, dieses Wissen wirksam zu komprimieren und die entscheidenden Gesichtspunkte erkenntnisfördernd zueinander in Beziehung zu setzen. Zwar vergleicht er immer wieder Einzelaspekte: "Wie die Argeaden in Makedonien errichteten die Magadha-Könige während der Kämpfe Festungsbauten am Ganges." Aber solche Vergleiche im Kleinen ergeben kaum ein größeres Ganzes, etwa Typologien oder Erkenntnisse über Regelmäßigkeiten in historischen Prozessen.
Vor allem fragt Schulz fast nie nach den Ursachen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. So kontrastiert er zwar zumindest im Gesamtfazit die griechisch-römische "Bürgerstadt" mit der indisch-chinesischen, stärker auf den Herrscher ausgerichteten Stadt. Doch welche geographischen, sozialen oder politischen Bedingungen diese Unterschiede hervorgebracht haben könnten, erörtert er weder hier noch anderswo. Damit verschenkt Schulz ein wichtiges Erkenntnispotential der Globalgeschichte: das Gewöhnliche, etwa die griechische Polis, durch Vergleiche ungewöhnlich und erklärungsbedürftig zu machen.
Auch die Verbindungen der Zivilisationen untereinander bleiben erstaunlich unterbelichtet. Die immer intensiveren und unmittelbareren Handelskontakte zwischen dem Chinesischen und Römischen Reich zeichnet Schulz bündig nach. Doch dass schon Plinius der Ältere im 1. Jahrhundert die "Seres" ("Seidenleute") im Fernen Osten kannte, Ptolemäus "Sina" kurz darauf auf seiner Weltkarte verzeichnete und chinesische Quellen von einem Großreich im Westen wissen, in dem es Hunderte Städte gibt und der Kaiser angeblich gewählt wird: Über solche wechselseitigen Kenntnisse und Wahrnehmungen der Kulturen erfährt man wenig.
Wen die Vernetzungen der alten Kulturen interessieren, greife daher lieber zu Schulz' vorherigem Buch über die "Abenteurer der Ferne". Wer sich wiederum einen Osterhammel der Antike wünscht, eine sowohl vernetzende als auch vergleichende Globalgeschichte mit analytischer Schärfe, wird von dieser "Globalgeschichte" enttäuscht sein.
Raimund Schulz:
"Welten im Aufbruch".
Eine Globalgeschichte
der Antike.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2025. 496 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 17.04.2025
Antike Globalgeschichte
Welten im Aufbruch.- eine Globalgeschichte. Ich hatte ja schon an anderer Stelle bemerkt, das Globaslgeschichten im Moment gefragt sind. Ein Rundumschlag. Hier ist nun die Antike dran. Und es macht Spaß zu lesen! Es stimmt schon, in Zeiten der Globaslisierung wächst alles zusammen ( Hallo Trump).
Aber ist es neu? Haben nicht schon andere Völker global gehandelt? Am Beispiel der Antike zeigt uns Raimund Schulz wie es gewesen sein könnte, denn viele Dokumente gibt es ja leider nicht oder sind noch nicht gefunden worden.
IOn fünf großen Kapiteln zeigt er uns , was so los war in der Antike. Und er schildert es sehr farbig. Es macht einfach Spaß dies Buch zu lesen und einzutauchen in eine weit vergangene Zeit. Aber es ist unsere Vergangenheit. Ohne diese gäb es kein Heute.
Ich war traurig, als die letzte Seite aufgeschlagen wurde, denn es hat mich sehr gefangen genommen. Ein wirklich tolles Buch.
Lassen Sie sich entführen in die Welt der Antike. Es lohnt sich. Danke Raimund Schulz.
am 15.04.2025
Philosophischer Rundumschlag
Es ist modern, oder Neudeutsch Mainstream, eine Globalgeschichte zu verfassen. In der Tat eine schwere Aufgabe, denn Autor oder Autorin müssen einen komplexen Überblick über das Thema haben. Diesen Versuch unternimmt R. Schulz mit seinem Buch " Welten im Aufbruch".
Und der Versuch ist geglückt, jedenfalls in meinen Augen. Das Thema dieses Buches ist die Philosophie in seinen ganzen Auswirkungen, also nicht nur Platon und Aristoteles, sondern auch die Klassiker anderer Kulturen wie in China oder Indien etwa
Und hier wird gezeigt, daß große Denker überall auf der Welt zu Hause waren und Ideen in die Welt setzten, die nur zusammengefügt werden müssen. Hinzu kommen die Völker, etwa Afrika ( und hier Weine ich den Kontinent), der eine großartige, aber kaum beachtete Philosophie besitzt ( siehe auch Anke Graneß, Philosophie in Afrika, Suhrkamp Wissenschaft).
Wer glaubt dem Thema nicht gewachsen zu sein, den kann ich beruhigen. Ich tue mich schwer mit philosophischen Themen, aber versuche es immer wieder gerne. und es hat sich gelohnt. Tauchen Sie ein in die Welt der Philosophie und lassen sich von den Gedankengängen und Gemeinsamkeiten faszinieren.