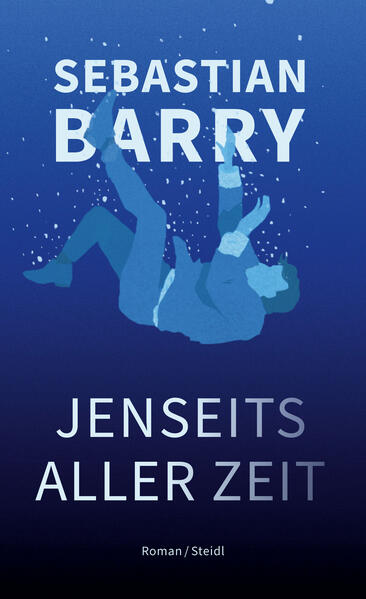
Zustellung: Mi, 23.04. - Fr, 25.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Nach vierzig Jahren als Kriminalbeamter wird Tom Kettle in seinem neuen Zuhause angespült, einer kleinen Einliegerwohnung im Anbau einer viktorianischen Burg, mit Blick auf den Coliemore Harbour und die Irische See. Am liebsten sitzt er in seinem Korbsessel, raucht Zigarillos und schaut durchs Panoramafenster aufs Meer. Sich nicht zu rühren, glücklich und nutzlos zu sein, ist für ihn Sinn und Zweck des Ruhestands. Schon seit Monaten hat er kaum eine Menschenseele gesehen, als an einem stürmischen Frühlingsnachmittag zwei ehemalige Kollegen an seine Tür klopfen und ihn zu einem alten Mordfall befragen wollen. Ein traumatischer Fall, der alte Wunden aufreißt, denn »nichts war so, wie behauptet wurde. Die Wahrheit eingeschlossen. Die Gardaí. Das Land«. Tom Kettle ist ein unzuverlässiger Zeuge und ein unzuverlässiger Erzähler. Seine Welt ist ein Ort voller Trauer und leisem Humor. Hier verweilen die Geister seiner Frau und seiner Kinder, verschwimmen Pflicht und Gerechtigkeit, geht die Erinnerung ganz eigene, verschlungene Wege.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
10. Dezember 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
288
Autor/Autorin
Sebastian Barry
Übersetzung
Hans-Christian Oeser
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Produktart
gebunden
Gewicht
452 g
Größe (L/B/H)
214/133/27 mm
Sonstiges
Lesebändchen
ISBN
9783969994016
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»ein großes literarisches Meisterwerk« -Thomas Wörtche, Deutschlandfunk Kultur
»Wie Tom Kettle trotzdem auf die Welt schaut, vorsichtig nämlich, wie er stets versucht, das Richtige zu tun, auch wenn er im Gespräch keine Worte im Mund findet, das macht ihn zu einem so ungewöhnlichen wie auch berührenden Charakter. «-Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau
»Sebastian Barry schafft eine Atmosphäre wie an einem wärmenden Kaminfeuer, die einen unerklärbaren Trost ausstrahlt wegen der großen Ruhe, Geduld und einem absolut unwiderstehlichen Humor, mit dem über die Tragödien eines Lebens und seine unfassbar beglückenden Momente gesprochen wird. « -Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur
»Der Antriebsmotor dieses herausragend erzählten, alttestamentarisch beseelten Krimis ist die Vergeltung. Es muss heimgezahlt werden. Die Aufklärung in diesem Roman ist nur die Fassade für eine Menschheitsfrage. « -Adam Soboczynski, Die ZEIT
»Ein literarisches Meisterwerk. « -Culturmag
»Sebastian Barry beleuchtet die Verbrechen der katholischen Kirche Irlands mit einer literarischen Wucht, die dir entgegenschlägt wie Wellen an einer sturmumtosten Küste. « -Axel Hill, Kölnische Rundschau
»Sebastian Barrys neustes Werk bietet alles, was einen guten Roman ausmacht. Meisterhaft erzählt und genial komponiert, es ist ebenso geheimnisvoll wie von der ersten Seite an spannend. « -Hartmut Fanger, Schreibfertig
»Tröstlich, tragisch und ganz wunderbar. « -Ingeborg Sperl, Der Standard
»Wie Tom Kettle trotzdem auf die Welt schaut, vorsichtig nämlich, wie er stets versucht, das Richtige zu tun, auch wenn er im Gespräch keine Worte im Mund findet, das macht ihn zu einem so ungewöhnlichen wie auch berührenden Charakter. «-Sylvia Staude, Frankfurter Rundschau
»Sebastian Barry schafft eine Atmosphäre wie an einem wärmenden Kaminfeuer, die einen unerklärbaren Trost ausstrahlt wegen der großen Ruhe, Geduld und einem absolut unwiderstehlichen Humor, mit dem über die Tragödien eines Lebens und seine unfassbar beglückenden Momente gesprochen wird. « -Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur
»Der Antriebsmotor dieses herausragend erzählten, alttestamentarisch beseelten Krimis ist die Vergeltung. Es muss heimgezahlt werden. Die Aufklärung in diesem Roman ist nur die Fassade für eine Menschheitsfrage. « -Adam Soboczynski, Die ZEIT
»Ein literarisches Meisterwerk. « -Culturmag
»Sebastian Barry beleuchtet die Verbrechen der katholischen Kirche Irlands mit einer literarischen Wucht, die dir entgegenschlägt wie Wellen an einer sturmumtosten Küste. « -Axel Hill, Kölnische Rundschau
»Sebastian Barrys neustes Werk bietet alles, was einen guten Roman ausmacht. Meisterhaft erzählt und genial komponiert, es ist ebenso geheimnisvoll wie von der ersten Seite an spannend. « -Hartmut Fanger, Schreibfertig
»Tröstlich, tragisch und ganz wunderbar. « -Ingeborg Sperl, Der Standard
 Besprechung vom 06.02.2025
Besprechung vom 06.02.2025
Das schlimmste aller Verbrechen
Sebastian Barrys Roman "Jenseits aller Zeit" entpuppt sich erst nach und nach als Psychothriller. In einer vielschichtigen Erzählung nähert er sich dem Kindesmissbrauch der katholischen Kirche Irlands und seinen dramatischen Folgen.
Die Geschichte, die hier erzählt wird, beginnt geradezu gemütlich. Der Polizist Tom Kettle ist seit neun Monaten pensioniert; Zigarillos rauchend sitzt er in seinem Korbsessel mit Blick auf die sich ständig wandelnde Irische See und bemüht sich, seinen Ruhestand zu genießen. Er lebt zurückgezogen in seiner Einliegerwohnung, und er wechselt seine Kleider zu selten. Wenn seine Tochter Winnie ihn besucht, bedauert er, dass er die Wohnung noch nicht geputzt hat, und wenn sie gegangen ist, spült er ihre Teetasse. Was nicht ungewöhnlich wäre, wenn Winnie noch leben würde. Doch seine Tochter ist ebenso tot wie seine immer noch innig geliebte Frau June und sein Sohn Joe, der in die Vereinigten Staaten ausgewandert war.
Die Klingel an der Wohnungstür reißt ihn aus diesem Schwanken zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Imagination und Realität: Zwei jüngere Ex-Kollegen brauchen seine Hilfe. Es geht um ein ungelöstes Verbrechen aus den Sechzigerjahren, doch Tom wehrt ab. Er denkt bei sich: "Herrgott, geht nach Hause, Jungs. Ihr bringt mich zurück ich weiß nicht, wohin. Die Nichtswürdigkeit. Das obszöne Dunkel, die Gewalt. Priesterhände. Das Schweigen."
Damit ist die Spur gelegt zum Glutkern des Geschehens, zu dem die Erzählung erst fast hundert Seiten später vorstoßen wird. Der Roman spielt im Jahr 1994, und bei dem Kriminalfall aus den Sechzigerjahren geht es um die Rache für ein Verbrechen, über das niemand spricht: die Täter nicht, erst recht nicht die Opfer, von der Gesellschaft ganz zu schweigen. "Es war das, was alle wollten", so kommentiert Tom das einvernehmliche Schweigen über den systematischen Kindesmissbrauch der katholischen Kirche. Immer tiefer gräbt sich der Roman in die Vergangenheit, da wäre zum Beispiel Father Taddy, "der schwitzende, mörderische Priester", der die Mädchen eines von katholischen Nonnen geführten Waisenhauses missbrauchte. Bei den Nonnen hieß es, er "verwöhne" seine Mädchen, zu denen auch Toms spätere Frau June gehörte, im Alter von sechs bis zwölf. Auch Tom ist ein missbrauchtes Waisenkind, er weiß aus eigener Erfahrung, dass es nichts gibt, "was ein Kind mehr zerstört" als das, was einer wie Father Thaddy ihnen antut: "So manche Menschenseele im Meer seiner Lüsternheit ausgelöscht wie ein Kerzendocht."
Über weite Strecken ist "Jenseits aller Zeit" ein Bewusstseinsroman. Man befindet sich in Toms Kopf und erlebt sein inneres Drama: die durch das geteilte Trauma unauslöschliche Liebe zu June, sein Verzweifeln an der Welt, die wieder von Neuem hochkochende Wut über das Verbrechen an den Schwächsten und seine Straflosigkeit. Dazu kommt, dass Tom nicht nur ein Opfer war: Als Jugendlicher meldete er sich zur Armee und beging Kolonialverbrechen; er erinnert sich, wie er in Südostasien auf malaiische Rebellen schoss nach dem Motto "Erst töten, dann fragen".
So wird der Roman dunkler und dunkler, er entwickelt einen Hallraum wie ein antikes Drama - und erweist sich, bei aller Komplexität, zunehmend als Pageturner. Sebastian Barry ist ein Meister des Informationsmanagements: Er legt Spuren, lässt uns manches erahnen, und wird ein Puzzleteil aufgedeckt, blättert man zurück, weil auf einmal alles in einem anderen Licht erscheint. Dazu kommt eine evokative Sprache (virtuos übersetzt von Hans-Christian Oeser). Manche Sätze über Toms Erfahrung als Polizist zielen haarscharf am Pathos vorbei: "Er wusste, in der Brust menschlicher Angelegenheiten steckte, zitternd wie ein Messer, fast immer eine Komödie." Es gibt überraschende Bilder - Tom hat "einen zerrissenen Pullover als Seele" -, und alles ist grundiert von einer hauchfeinen Ironie: "Sie waren gesonnen, über nichts zu sprechen, und genau das taten sie", so Toms Kommentar über das Vermieter-Ehepaar, das ihn zu Besuch einlädt.
Zu den Besonderheiten dieses literarisch ausgefeilten Psychothrillers gehört das Wetter. Sebastian Barry nutzt es nicht nur, um eine dichte Atmosphäre zu schaffen auf dieser "rauen alten Insel" Irland, er spiegelt darin auch Toms Innenleben. Man kennt das literarische Verfahren aus der Romantik, und Barry spielt damit. "Überall blitzten die Krummsäbel eines schonungslosen Windes auf, schlugen nach seinem Hut, seinem Haar, seinem Herzen." Nachdem sich Tom wieder einmal seinen Erinnerungen an June hingegeben hat, schaut er aus dem Fenster auf die See: "Das Sonnenlicht stach seine Millionen Nadeln ins silbrig schillernde Meer, die weite Fläche funkte und funkelte, als stünde sie kurz vor einer regelrechten Feuersbrunst."
"Jenseits aller Zeit" erzählt von Liebe und Verlust, von Trauer, Trauma und Rache, und durch die Präsenz der Toten erinnert es bisweilen an einen Gespensterroman. Die Lektüre ist anspruchsvoll - und überraschend unterhaltsam. Und genau das ist die Crux: Wer sich dem Lesevergnügen hingibt, tappt in die Falle. "Jenseits aller Zeit" ist ein hochpolitischer Roman über das schlimmste aller Verbrechen, und diese Anklage steht im Widerspruch zum Vergnügen. Sebastian Barry öffnet einen Abgrund, in den hinabzuschauen man sich nicht nur im Irland der Sechzigerjahre geweigert hat. Er hat das Tabu in die Romanhandlung integriert, indem er das Verbrechen erst an dem Punkt offenbart, wo man nicht mehr aufhören kann mit Lesen und unweigerlich in das Verhängnis hineinschlittert. Zumal der Klappentext nichts über den Kindesmissbrauch verrät - eine kühne Entscheidung in Zeiten der Triggerwarnungen. SIEGLINDE GEISEL
Sebastian Barry: "Jenseits aller Zeit". Roman.
Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser. Steidl Verlag, Göttingen 2024. 304 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 23.02.2025
Harte Kost, deprimierend & grandios erzählt zugleich, große Liebe&große Schuld, nicht meins,auch wenn ich den Autoren weiterempfehlen kann.
LovelyBooks-Bewertung am 18.02.2025
Hier entfaltet sich ganz ganz langsam eine Geschichte der Scham, Schuld und Trauer.









