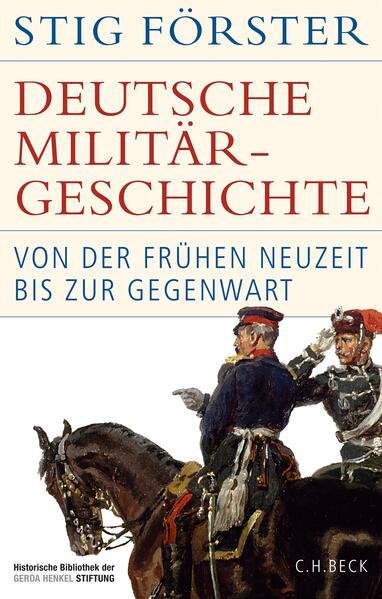
Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
500 Jahre deutsche Militärgeschichte - das Standardwerk
Vom Bauernkrieg und den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges über die Deutsch-Französischen Kriege und die Verheerungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs bis hin zu den Afghanistan-Einsätzen der Bundeswehr - Stig Förster bietet einen weitreichenden Überblick über alle wichtigen militärischen Konflikte der deutschen Staaten vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Das Buch zeichnet sich vor allem durch eine Erweiterung der Perspektiven aus: Neben den großen Schlachten kommt das individuelle Erleben von Krieg ebenso zum Tragen wie die Verflechtungen zwischen Militär und Zivilgesellschaft sowie die internationale Dimension militärischen Handelns. Man erfährt darüber hinaus alles Wissenswerte über Waffengattungen, Uniformen und Militärtaktiken. Diese fundierte und flott geschriebene Darstellung bietet eine spannende Lektüre und ermöglicht ein tiefgreifendes Verständnis von 500 Jahren deutscher Militärgeschichte.
Seit Russlands Angriff auf die Ukraine hat sich auch in Deutschland der Blick auf Bundeswehr und Militärwesen grundlegend geändert. Stig Försters große Überblicksdarstellung der deutschen Militärgeschichte ordnet diese jüngsten Entwicklungen in eine historische Perspektive ein. Für neue Einsichten sorgt der Historiker auch dadurch, dass er das Militär stärker in gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Strukturen einbettet. Zudem wirft er einen kritischen Blick auf die globalen Verstrickungen und Greueltaten des deutschen Militärs, die insbesondere in der Zeit von Imperialismus und Kolonialismus begangen wurden.
Vom Bauernkrieg und den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges über die Deutsch-Französischen Kriege und die Verheerungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs bis hin zu den Afghanistan-Einsätzen der Bundeswehr - Stig Förster bietet einen weitreichenden Überblick über alle wichtigen militärischen Konflikte der deutschen Staaten vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Das Buch zeichnet sich vor allem durch eine Erweiterung der Perspektiven aus: Neben den großen Schlachten kommt das individuelle Erleben von Krieg ebenso zum Tragen wie die Verflechtungen zwischen Militär und Zivilgesellschaft sowie die internationale Dimension militärischen Handelns. Man erfährt darüber hinaus alles Wissenswerte über Waffengattungen, Uniformen und Militärtaktiken. Diese fundierte und flott geschriebene Darstellung bietet eine spannende Lektüre und ermöglicht ein tiefgreifendes Verständnis von 500 Jahren deutscher Militärgeschichte.
Seit Russlands Angriff auf die Ukraine hat sich auch in Deutschland der Blick auf Bundeswehr und Militärwesen grundlegend geändert. Stig Försters große Überblicksdarstellung der deutschen Militärgeschichte ordnet diese jüngsten Entwicklungen in eine historische Perspektive ein. Für neue Einsichten sorgt der Historiker auch dadurch, dass er das Militär stärker in gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Strukturen einbettet. Zudem wirft er einen kritischen Blick auf die globalen Verstrickungen und Greueltaten des deutschen Militärs, die insbesondere in der Zeit von Imperialismus und Kolonialismus begangen wurden.
- "Der Krieg ist eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit anderen Mitteln." Carl von Clausewitz, "Vom Kriege"
- Eine Gesamtdarstellung vom 15. Jahrhundert bis zur Zeitenwende
- Vom Bauernkrieg bis Afghanistan: Die Geschichte deutscher Soldaten
- Das künftige Standardwerk
- Militärgeschichte verflochten mit Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
- Persönliches Erleben von Krieg spielt eine große Rolle
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Der schwierige Aufstieg des Staates. Militär und Kriegswesen in der Frühen Neuzeit
1. Ein neues Zeitalter: Das 16. Jahrhundert
2. Die Katastrophe: Der Dreißigjährige Krieg und seine Folgen
3. Absolutismus und unruhige Zeiten, 1649 1789
II. Das Zeitalter des Volkskriegs. Revolutionen und Reaktion, 1789 1849
1. Die Französische Revolution, Napoleon und die Radikalisierung des Krieges, 1789 1815
2. Reaktion und Revolution, 1815 1849
III. Der Weg in den industrialisierten Volkskrieg, 1850 1871
1. Wirtschaftsaufschwung, internationale Konflikte und Militärreformen, 1850 1864
2. Deutsche Kriege, 1864 1866
3. Das Menetekel: Der Deutsch-Französische Krieg, 1870/71
IV. Das Deutsche Kaiserreich und sein Militär, 1871 1914
1. Die bleierne Bismarckzeit, 1871 1890
2. Herrliche Zeiten: Das Militär im Wilhelminismus, 1890 1911
3. In der Sackgasse, 1911 1914
V. Der Erste Weltkrieg und die Totalisierung der Kriegführung, 1914 1918
1. Blutiger Herbst: Die ersten Monate des Krieges
2. 1915 /16: Am Rande des Abgrunds
3. Die Katastrophe
VI. Revanche. Das deutsche Militär zwischen Konterrevolution und Kriegsvorbereitung, 1918 1939
1. Weimar, die verachtete Republik
2. Der fatale Pakt: Das Militär, das NS-Regime und der Weg in den Krieg
VII. Der Zweite Weltkrieg und das Ende der deutschen Militärgeschichte, 1939 1945
1. Mit schnellen Erfolgen ins strategische Dilemma, 1939 1941
2. Kriegswende, 1941 1943
3. Totaler Krieg und totale Katastrophe, 1943 1945
VIII. Die beiden deutschen Staaten und ihr Militär in den Bündnissystemen des Kalten Krieges
1. Auferstanden aus Ruinen
2. Wiederbewaffnung
3. Der lange Weg zur Wende
IX. Ende offen. Sicherheitspolitik und Bundeswehr seit 1990
1. Enttäuschte Träume und harte Realitäten
2. Afghanistan und andere Abenteuer
3. Zeitenwende
Anhang
Anmerkungen
Abkürzungsverzeichnis
Auswahlbibliographie
Bildnachweis
Personenregister
Register geographischer Begriffe
I. Der schwierige Aufstieg des Staates. Militär und Kriegswesen in der Frühen Neuzeit
1. Ein neues Zeitalter: Das 16. Jahrhundert
2. Die Katastrophe: Der Dreißigjährige Krieg und seine Folgen
3. Absolutismus und unruhige Zeiten, 1649 1789
II. Das Zeitalter des Volkskriegs. Revolutionen und Reaktion, 1789 1849
1. Die Französische Revolution, Napoleon und die Radikalisierung des Krieges, 1789 1815
2. Reaktion und Revolution, 1815 1849
III. Der Weg in den industrialisierten Volkskrieg, 1850 1871
1. Wirtschaftsaufschwung, internationale Konflikte und Militärreformen, 1850 1864
2. Deutsche Kriege, 1864 1866
3. Das Menetekel: Der Deutsch-Französische Krieg, 1870/71
IV. Das Deutsche Kaiserreich und sein Militär, 1871 1914
1. Die bleierne Bismarckzeit, 1871 1890
2. Herrliche Zeiten: Das Militär im Wilhelminismus, 1890 1911
3. In der Sackgasse, 1911 1914
V. Der Erste Weltkrieg und die Totalisierung der Kriegführung, 1914 1918
1. Blutiger Herbst: Die ersten Monate des Krieges
2. 1915 /16: Am Rande des Abgrunds
3. Die Katastrophe
VI. Revanche. Das deutsche Militär zwischen Konterrevolution und Kriegsvorbereitung, 1918 1939
1. Weimar, die verachtete Republik
2. Der fatale Pakt: Das Militär, das NS-Regime und der Weg in den Krieg
VII. Der Zweite Weltkrieg und das Ende der deutschen Militärgeschichte, 1939 1945
1. Mit schnellen Erfolgen ins strategische Dilemma, 1939 1941
2. Kriegswende, 1941 1943
3. Totaler Krieg und totale Katastrophe, 1943 1945
VIII. Die beiden deutschen Staaten und ihr Militär in den Bündnissystemen des Kalten Krieges
1. Auferstanden aus Ruinen
2. Wiederbewaffnung
3. Der lange Weg zur Wende
IX. Ende offen. Sicherheitspolitik und Bundeswehr seit 1990
1. Enttäuschte Träume und harte Realitäten
2. Afghanistan und andere Abenteuer
3. Zeitenwende
Anhang
Anmerkungen
Abkürzungsverzeichnis
Auswahlbibliographie
Bildnachweis
Personenregister
Register geographischer Begriffe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
20. März 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
1294
Reihe
Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung
Autor/Autorin
Stig Förster
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit 21 Abbildungen in einem Farbtafelteil und 22 Karten
Gewicht
1390 g
Größe (L/B/H)
218/154/55 mm
ISBN
9783406829031
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Ein Standardwerk
CICERO, Alexander Grau
Försters Buch kommt zur rechten Zeit.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andreas Kilb
Was Försters Darstellung, die Konfessionskriege, Napoleon, Bismarck, die beiden Weltkriege und den Kalten Krieg mit Nato und Warschauer Pakt als Gesamtdarstellung als Lektüre gerade heute so wertvoll macht, ist ihr Anspruch, eine ebenso allgemeinverständliche wie ganzheitliche Abhandlung zu sein.
WELT am Sonntag, Marc Reichwein
Was sind die wichtigsten Entwicklungen deutscher Militärgeschichte? Diese Frage beantwortet Stig Förster, Historiker und Autor des Buches " Deutsche Militärgeschichte. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart" im Gespräch.
t-online, Marc von Lüpke
CICERO, Alexander Grau
Försters Buch kommt zur rechten Zeit.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andreas Kilb
Was Försters Darstellung, die Konfessionskriege, Napoleon, Bismarck, die beiden Weltkriege und den Kalten Krieg mit Nato und Warschauer Pakt als Gesamtdarstellung als Lektüre gerade heute so wertvoll macht, ist ihr Anspruch, eine ebenso allgemeinverständliche wie ganzheitliche Abhandlung zu sein.
WELT am Sonntag, Marc Reichwein
Was sind die wichtigsten Entwicklungen deutscher Militärgeschichte? Diese Frage beantwortet Stig Förster, Historiker und Autor des Buches " Deutsche Militärgeschichte. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart" im Gespräch.
t-online, Marc von Lüpke
 Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Die grausame Kunst des Sichelschnitts
Stig Förster zeichnet die deutsche Militärgeschichte vom sechzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart nach. Dabei gibt er dem historischen Panorama den Vorrang vor taktischen und technischen Details.
Von Andreas Kilb
Von Andreas Kilb
Im März 1992 äußerte sich der ehemalige amerikanische Präsident Richard Nixon in einem Interview zur Lage Russlands. Der Westen, heiße es, habe den Kalten Krieg gewonnen, sagte Nixon, aber das sei nur halb wahr. Denn jetzt stünden die Ideen der Freiheit in Russland auf der Probe, und wenn sie sie nicht bestünden, werde es einen Rückfall geben - "nicht in den Kommunismus, sondern in einen neuen Despotismus, der eine tödliche Bedrohung für den Rest der Welt darstellen würde, denn er wäre mit dem Virus des russischen Imperialismus infiziert". Zudem würden sich auch die Hardliner in China daran ein Beispiel nehmen und die weitere Demokratisierung ihres Landes stoppen.
Elf Jahre später, im Mai 2003, erließ der damalige Bundesverteidigungsminister Peter Struck eine Reihe von Richtlinien für die Bundeswehr, die Konsequenzen aus den Erfahrungen der NATO- und UNO-Einsätze auf dem Balkan und in Afghanistan ziehen sollten. Sie sahen die Neuaufteilung der Streitkräfte in eine zentrale "Eingreif-" und eine zusätzliche "Stabilisierungstruppe" vor, denen "Unterstützungskräfte" zur Seite gestellt werden sollten. Von Landesverteidigung war in dem Papier keine Rede mehr. Im Jahr darauf endete Wladimir Putins erste Amtszeit als russischer Präsident.
Weitere zehn Jahre später besetzten Putins Truppen die Krim, und in der Ostukraine begann der militärische Aufstand der prorussischen Separatisten. Anschließend dauerte es nur noch acht Jahre, bis die russische Armee zum Vernichtungsschlag gegen die Ukraine ausholte. In dem seither stattfindenden Eroberungskrieg werden Putins Truppen von China logistisch unterstützt. Nixons Prophezeiung ist Wirklichkeit geworden.
Der Historiker Stig Förster zitiert die Aussagen des amerikanischen Ex-Präsidenten und die folgenden Ereignisse in seiner Studie zur deutschen Militärgeschichte als Beleg dafür, wie stark militärische und politische Geschichtsschreibung ineinander verflochten sind. Und er hat recht: Militärgeschichte lässt sich nicht sinnvoll betreiben, ohne den politischen Kontext zu berücksichtigen, in dem bewaffnete Konflikte stattfinden; und die Historiographie der Staaten und Gesellschaften ist, zumindest in der Darstellung von Krisenzeiten, auf militärisches Fachwissen dringend angewiesen.
All das war lange Zeit in Deutschland nicht selbstverständlich. Unter akademischen Historikern galt es, zumal nach 1945, als unschicklich, sich mit Kriegen, Schlachten und Taktiken zu befassen, während die Praktiker des Militärischen, Generäle, Stabsoffiziere und Frontsoldaten, mit ihren Memoiren und strategischen Szenarien lieber unter sich blieben. Hans Delbrücks Versuch, mit seiner ab 1900 erschienenen "Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte" eine Brücke zwischen den Disziplinen zu schlagen, wurde von beiden Seiten abgeblockt. Erst mit der Gründung des Militärgeschichtlichen Forschungsamts der Bundeswehr im Jahr 1957 kam Bewegung in die erstarrten Fronten. Seither gibt es nicht nur eine offizielle bundesrepublikanische Kriegsgeschichtsschreibung - die in dem von 1979 bis 2008 publizierten dreizehnbändigen Werk "Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg" gipfelte -, sondern auch einen festen Kreis von Historikern, die sich wie ihre Kollegen in anderen Ländern der Militärgeschichte widmen.
Zu ihnen gehört in vorderster Reihe der in Berlin geborene und bis zu seiner Emeritierung 2016 in Bern lehrende Stig Förster. Förster hat als Wissenschaftler und als Herausgeber der Schriftenreihe "Krieg in der Geschichte" eine ganze Generation von Militär- und Globalhistorikern ausgebildet, und als Mitglied im Beirat des inzwischen in "Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften" umbenannten Forschungsamts nimmt er nach wie vor Einfluss auf dessen Ausrichtung. Eine "Deutsche Militärgeschichte" aus Försters Feder war deshalb, als Konsequenz einer lebenslangen Forschertätigkeit, fast unvermeidlich. Die Überraschung - für Förster mag es eine Enttäuschung sein - liegt darin, dass es nicht die Erste ihrer Art ist. Vor zwei Jahren hat der britische Historiker Peter Wilson eine ähnlich breit angelegte Studie zum deutschen Militär seit 1500 vorgelegt. Wilsons "Eisen und Blut", so der Titel des Buches (F.A.Z. vom 14. Oktober 2023), ließ viele Fragen offen, steckte aber den zeitlichen Rahmen ab, in dem sich auch Försters Darstellung bewegt.
Peter Wilson hatte eine klare These: Er wollte die deutsche Geschichte vom Stigma des "Sonderwegs" befreien, das ihr in der Forschung noch immer anhaftet, und konzentrierte sich deshalb besonders, wenn auch nicht sonderlich überzeugend, auf die Entwicklung des habsburgischen Militärs. Stig Förster verfolgt keine vergleichbare Strategie. Ihm geht es, wie zuvor Hans Delbrück, vor allem um die Einordnung kriegerischer Ereignisse in ihren politischen Rahmen. Deshalb nimmt in seinem Buch die Geschichte des deutschen Staates und seiner Vorläufer im Vergleich zu den eigentlich militärischen Aspekten den weitaus größeren Raum ein. "Taktik, Waffen und Soldaten" des Absolutismus werden auf nur fünf, die kriegstechnischen Innovationen des Revolutionszeitalters auf vier, die clausewitzschen Schriften zur Theorie des Krieges auf sieben Seiten abgehandelt. Der Dreißigjährige Krieg, das wichtigste militärische Ereignis der europäischen frühen Neuzeit, wird von Förster auf siebzig Seiten gewürdigt, ohne dass der durch ihn beschleunigte Wechsel von der Haufen- zur Linientaktik, der mit der Einführung des Steinschlossgewehrs möglich wurde, und das damit verbundene Aufkommen stehender Heere in ihrer zeitlichen Abfolge deutlich erkennbar würden.
Diese Unschärfe muss kein Schaden sein. Am Ende war das, was die Kabinette beschlossen, seinerzeit wichtiger als alles in den Kabinettskriegen Erkämpfte. Aber ein gewisses Manko bedeutet die allzu laxe Behandlung militärischer Detailfragen eben doch. So spricht Förster ausführlich über die Arbeit des preußischen Generalstabs, der im Kaiserreich zum "Großen Generalstab" avancierte, doch die Entstehung dieser Strategiebehörde in der nachfriderizianischen Übergangszeit bleibt bei ihm im Dunkeln. Dabei könnte man anhand der Professionalisierung der Kriegsplanungen eine ganze Sozialgeschichte des deutschen Militärs vom Barock bis zum Zweiten Weltkrieg erzählen - auch wenn die Armeen mit Pickelhaube und Stahlhelm bis zuletzt meist von Adligen geführt wurden. Doch die Generäle Jodl und Keitel, die 1945 die bedingungslose Kapitulation des Dritten Reiches unterzeichneten und später in Nürnberg hingerichtet wurden, waren nicht zufällig bürgerlicher Herkunft.
Der Schwerpunkt von Försters Buch liegt auf dem zwanzigsten Jahrhundert. Dabei vereint seine Darstellung alle Vorzüge und Nachteile einer Gesamtschau, sie ist klar, wo sie die großen Linien nachzeichnet, und unsicher in den kleinen Strichen, etwa bei der Beschreibung des wirtschaftlichen Chaos, das die De-facto-Militärdiktatur Hindenburgs und Ludendorffs ab 1916 im kriegsmüden deutschen Kaiserreich anrichtete, oder bei der Analyse der Mangelökonomie und der bröckelnden Fronten von Hitlers Wehrmacht nach Stalingrad und El Alamein.
Hier verlässt sich Förster zu sehr auf Bernd Wegners These von der "Choreographie des Untergangs", die dem tagtäglichen Wirrwarr des untergehenden Naziregimes einen festen Plan unterschiebt, während er in den Skizzen zum alliierten Bombenkrieg der moralisierenden Perspektive Jörg Friedrichs folgt, ohne auf die ökonomischen Aspekte der gescheiterten Reichsluftverteidigung einzugehen. Dabei gibt es genügend Studien - zuletzt Richard Overys "Weltenbrand" -, die den Anteil rüstungspolitischer Fehlentscheidungen an Hitlers Niederlage betonen. Die uniformierten Entscheidungsträger waren unternehmerische Amateure - auch das ein deutsches Leitmotiv.
"Wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nimmt, dem soll die Hand abfallen." So sprach der spätere Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß im Nachkriegsjahr 1947. Wir wissen, was kam, und wir ahnen dunkel, was kommen wird. Die misslungenen oder geglückten Pläne für den Angriff im Westen, von Schlieffens Super-Cannae bis Mansteins Sichelschnitt, denen Stig Förster einen guten Teil seiner mehr als eintausend Textseiten widmet, sind Geschichte, aber die Planungen des Kalten Krieges für die Vorwärtsverteidigung an Elbe und Oder und die Rückzugslinie am Rhein könnten bald wieder auf den Tischen der zuständigen Generäle liegen. Militärgeschichte hat Konjunktur, und Försters Buch kommt zur rechten Zeit. Nur darf man es nicht als Gebrauchsanweisung für die Gegenwart lesen. Der Autor hat sein Manuskript vor der Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten abgeschlossen, was der "Deutschen Militärgeschichte" selbst einen historischen Zug verleiht. Das ändert nichts daran, dass ihre großen Linien stimmen und Nixons Prophetie bestehen bleibt. Doch die feinen Striche malt die Zeitgeschichte in jedem Augenblick neu.
Stig Förster: "Deutsche Militärgeschichte".
Von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart.
C. H. Beck Verlag,
München 2025. 1294 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Deutsche Militärgeschichte" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









