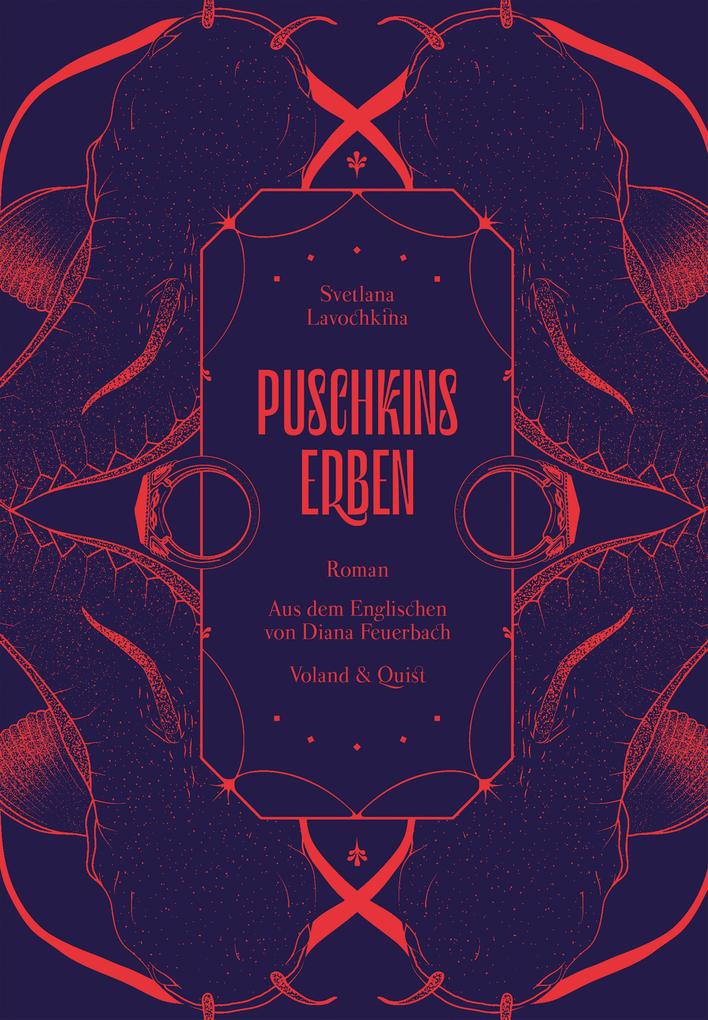
Zustellung: Do, 24.04. - Sa, 26.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Sommer 1820: Alexander Pusckin, auf dem Weg in die Verbannung, verliert beim euphorischen Bad im wilden Dnjepr bei Zaporoschje, einem langweiligen ukrainischen Nest, seinen wertvollen Türkisring und bekommt starkes Fieber. Neun Monate später gebärt die Wirtin des ihn beherbergenden Gasthauses ein Kind.
31. Dezember 1976, Zaporoschje: Die Familie Katz feiert in großer Runde Silvester, selbst die über Hemingway promovierende Alka hat den langen Weg aus Moskau auf sich genommen. Doch sie ist mal wieder enerviert ob der provinziellen Rückständigkeit ihrer Verwandten, einzig der schöne Schwarzmarktkaufmann Mark aus Odessa scheint sich abzuheben vom familiären Pöbel. Schließlich nutzt Möchtegernpoet Josik, Ehemann von Alkas Cousine Rita, die Gelegenheit, seine neueste bahnbrechende Entdeckung zu verkünden: Die Familie stammt vom großen russischen Dichter Alexander Puschkin ab!
31. Dezember 1976, Zaporoschje: Die Familie Katz feiert in großer Runde Silvester, selbst die über Hemingway promovierende Alka hat den langen Weg aus Moskau auf sich genommen. Doch sie ist mal wieder enerviert ob der provinziellen Rückständigkeit ihrer Verwandten, einzig der schöne Schwarzmarktkaufmann Mark aus Odessa scheint sich abzuheben vom familiären Pöbel. Schließlich nutzt Möchtegernpoet Josik, Ehemann von Alkas Cousine Rita, die Gelegenheit, seine neueste bahnbrechende Entdeckung zu verkünden: Die Familie stammt vom großen russischen Dichter Alexander Puschkin ab!
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. Oktober 2019
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
367
Autor/Autorin
Svetlana Lavochkina
Übersetzung
Diana Feuerbach
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
560 g
Größe (L/B/H)
147/204/31 mm
ISBN
9783863912420
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
" herrlich sprachverliebt [. . .] Ein rasantes Denkmal für die alte Sowjetunion von einer erstaunlich jungen Autorin."
Meike Schnitzler, Brigitte
"Ein hinreißender Roman."
Niels Beintker, Bayern 2 Diwan
"Mit viel Wortwitz verwebt Svetlana Lavochkina in ihrem Debütroman wahre historische Ereignisse mit der Geschichte einer erfundenen Familie, die einem beim Lesen immer mehr ans Herz wächst."
Yvonne Adamek, flow
"Wodka, Westjeans und Geheimsalons [. . .] Bitterkomisch."
Claudia Wahjudi, Westdeutsche Allgemeine Zeitung
". . . nicht nur ein burlesker Familienroman, sondern auch eine humorvolle und zutiefst tragische Parodie ganz im Stil der russischen Satire."
Ralf Julke, Leipziger Internet Zeitung
"Svetlana Lavochkina schlägt immer neue Volten beim Ritt über die Abgründe zwischen Realität und Wahn. [. . .] Ihr Roman ist ein großes höllisches Gelächter."
Karin Großmann, Sächsische Zeitung
Meike Schnitzler, Brigitte
"Ein hinreißender Roman."
Niels Beintker, Bayern 2 Diwan
"Mit viel Wortwitz verwebt Svetlana Lavochkina in ihrem Debütroman wahre historische Ereignisse mit der Geschichte einer erfundenen Familie, die einem beim Lesen immer mehr ans Herz wächst."
Yvonne Adamek, flow
"Wodka, Westjeans und Geheimsalons [. . .] Bitterkomisch."
Claudia Wahjudi, Westdeutsche Allgemeine Zeitung
". . . nicht nur ein burlesker Familienroman, sondern auch eine humorvolle und zutiefst tragische Parodie ganz im Stil der russischen Satire."
Ralf Julke, Leipziger Internet Zeitung
"Svetlana Lavochkina schlägt immer neue Volten beim Ritt über die Abgründe zwischen Realität und Wahn. [. . .] Ihr Roman ist ein großes höllisches Gelächter."
Karin Großmann, Sächsische Zeitung
 Besprechung vom 19.02.2020
Besprechung vom 19.02.2020
Ein Taucheranzug gegen die Welt
Svetlana Lavochkina zieht in ihrem Roman "Puschkins Erben" die Breschnew-Zeit durch den Kakao.
Wenn schon, denn schon. Wenn Puschkin 1820 auf der Reise nach Odessa schon als "künftiger Mozart der russischen Poesie" eingeführt wird, dann, voilà, bitte ebenso überspannt und exaltiert wie der Protagonist in Milos Formans Film "Amadeus". Der russische Salieri - wenn man so will -, Nikolai Karamsin, hat indes weniger Probleme mit dem eigenen Geniedefizit und schickt sich genügsam in die Rolle des Mentors und Förderers des künftigen Nationalliteraten: Er setzt sich dafür ein, dass die Verbannung des Dichters nach Sibirien in einen Aufenthalt an der Schwarzmeerküste umgewandelt wird.
Bei einem Aufenthalt in Saporoschje - heute Saporischschja und im Text aufgrund der englischen Vorlage etwas unglücklich als Zaporoschje wiedergegeben - erkrankt der Dichter. Der innigen Pflege seiner jüdischen Wirtin ist nicht nur die Genesung, sondern wohl auch ein Erbe zu verdanken.
Rund einhundertfünfzig Jahre später verfällt der Russischlehrer Josik Winter der fixen Idee, ein Nachfahre des verehrten Poeten zu sein. Immerhin hat er ein Schriftstück gefunden, bei dem es sich um eine Originalhandschrift handeln könnte. Doch während er sein genealogisches Glück mehr oder weniger geheim hält, posaunt die in Moskau lebende Cousine seiner Frau, Alka Katz, lauthals heraus, was sie sich in zunehmendem Wahn zusammenfabuliert hat: Hemingway ist nicht nur ihr Dissertationsthema, sondern auch ihr Vater.
Svetlana Lavochkina, eine Ukrainerin, die heute in Leipzig lebt und auf Englisch schreibt, spürt in ihrem Roman "Puschkins Erben" der Atmosphäre während der Breschnew-Zeit nach. Schauplatz ist eben Saporoschje, gelegen am Dnepr, eine Fahrt mit dem Nachtzug von Moskau und quasi einen Katzensprung von Odessa entfernt. Jüdische, russische und ukrainische Menschen, Kosaken und Zigeuner leben hier zusammen, einträchtig schon, aber mit allerlei verbalen Katzbalgereien, die auch im Flirt oder der Anmache derb sind. Da kann eine Russin in die Silvesterfeier einer jüdischen Familie platzen und erklären: ",So trinken wir ehrlichen Russen', sagte Swetka, ihr Glas hochhaltend, ,in einem Zug. Nicht wie ihr Juden mit euren Tricks. Ihr trinkt, ohne betrunken zu werden. Ich wette, ihr gießt euch den Wodka in die Ärmel, nicht wahr, Josik?'" Eine Stimmung, wie vielleicht eingefangen von Repin in seinem Gemälde der Saporoger Kosaken, die dem türkischen Sultan schreiben. Deftig und zotig. Bei Schmerzen oder Nebenwirkungen lese man daher die Seite des Impressums - "Die Verwendung einiger Begriffe im Text spiegelt nicht die Haltung des Verlages wider" - oder begebe sich direkt zur Buchhandlung des Vertrauens.
Nach einer kurzen Phase des Tauwetters leitet Breschnew die triste Ödnis der Stagnation und Gerontokratie ein. Visuell ist er bis heute präsent, als Mann, der mal mit einem ostdeutschen Politiker den sozialistischen Bruderkuss tauscht, mal mit einem westdeutschen in Brauenkonkurrenz treten könnte. Doch sonst? Der "aktive Wortschatz der Schaffnerin beinhaltete ,bitte' und ,selbstverständlich'" - aber nur weil sie in der ersten Klasse der Bahn eingesetzt wurde. Niemand ist in dieser Zeit besonders zimperlich. Die Mitglieder der jüdischen Familien Winter, Knoblauch und Katz wären so schrecklich gern mondän und promiskuitiv, aber am Ende landen immer wieder alle in einer höchst überschaubaren Zahl von Betten. Ein Reigen, wie er piefiger kaum sein könnte. Um angesichts der Tristesse nicht eine "komplexe subkutane Abfolge von Stimmungen" zu durchleiden, gibt es ein paar probate Mittel: in einen "wirklichkeitsabweisenden Taucheranzug" zu schlüpfen, sich die Realität durch etliche Botschaftsangehörige, die an jeder Ecke beharrlich auf das begehrte Stelldichein warten, schönzureden oder am Ende auszuwandern, nach Israel oder Amerika.
Lavochkina zieht die Nomenklatura der damaligen Zeit treffsicher durch den Kakao - Schuhfabriksdirektorentöchterchen Alka aus Moskau hält Kapern für zapplige Fische und Anchovis für Beeren aus dem Mittelmeerraum - und fängt die Atmosphäre mit ihrer Defizitwirtschaft und dem dauerhaften Schielen nach dem Westen bei gleichzeitiger offizieller Arroganz gegenüber dem Kapitalismus mit viel Phantasie ein. Das ist gute Unterhaltung. Gelegentlich gerät ihr ein Dialog etwas hölzern, gelegentlich gestattet sie sich eine Zote zu viel, am Ende entwirft sie unter dem Grau jedoch ein farbenreiches Bild. Antisemitismus, Frauenverachtung, das große Schweigen über die Stalin-Zeit und die Herabsetzung der Provinz - all das fängt sie ein. Und am Ende zeigt sich, dass dieser Roman sämtlichen derben Zoten zum Trotz sehr ernsthaft auch von geplatzten Träumen und Lebensentwürfen spricht und dass unter der rohen Oberfläche etwas Zartes liegt.
CHRISTIANE PÖHLMANN
Svetlana Lavochkina: "Puschkins Erben". Roman. Aus dem Englischen von
Diana Feuerbach. Verlag Voland & Quist,
Berlin / Dresden / Leipzig 2019. 368 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 19.01.2020
Dieses Buch erschien 2019 in der Verlag Voland & Quist GmbH und beinhaltet 364 Seiten.Zunächst befinden wir uns im Jahr 1820 und erfahren über den berühmten Dichter Alexander Puschkin,dass er auf seinem Weg in die Verbannung durch das ukrainische Nest Zaproschje reist und dort ungeahnte Spuren hinterlässt.Dann,150 Jahre später,versammelt sich die jüdische Familie Katz zur Silvesterfeier, und hinter verschlossenen Türen wird geflüstert, dass die Familie ganz sicher von Puschkin abstammt. Es handelt sich hier um eine dunkel schimmernde Familiensaga von verschrobenen Träumern, von unterdrückten Sehnsüchten, inniger Literaturverehrung und trotziger Selbstbehauptung angesichts einer profanen sowjetischen Realität.Die Autorin Svetlana Lavochkina hat einen ausgezeichneten Schreibstil. Zunächst dachte ich, dass es schwierig sein würde, dieses Buch zu lesen. Nachdem ich aber die ersten Seiten gelesen habe, konnte ich es nicht mehr aus den Händen legen. Zunächst erfahren wir etwas über Puschkin, der wohl ein Mensch zwischen Wahnsinn und Genie war. Ich fand es sehr interessant und beeindruckend, zu erfahren, wie er wohl so gewesen ist. Im nächsten Teil erfahren wir dann etwas über das Leben in der damaligen UdSSR. Ich fand die Sprache zunächst ziemlich derb, auch der Humor war sehr sarkastisch. Da ich selbst in der damaligen DDR gelebt habe, konnte ich jedoch einige Parallelen zu diesem Leben erkennen, was mich doch ziemlich zum Schmunzeln brachte. Ich finde, dass es sich hier um eine amüsante, aber auch sehr ernste Geschichte handelt, und ob die Familie Katz nun tatsächlich von Puschkin abstammt, das werdet ihr nur erfahren, wenn ihr dieses Buch selbst lest! Ich empfehle es euch auf jeden Fall! Das Leben in der damaligen Sowjetunion und auch im heutigen Russland war und ist nicht leicht. Ich war selbst schon in Sankt Petersburg, war fasziniert von der Schönheit der Stadt, von den lieben Menschen. Wenn man sich dann mit ihnen unterhält weiß man, dass sie ihr Land lieben, obwohl das Leben nicht leicht ist. Ich liebe dieses Buch und diese Geschichte, danke, Svetlana Lavochkina, für diese faszinierende, aufregende, humorvolle, aber auch ernsthafte Geschichte, die mich sehr gut unterhalten hat und mir Puschkin ein wenig näher brachte!
LovelyBooks-Bewertung am 29.12.2019
Im Sommer 1820 verweilt der berühmte Nationaldichter Alexander Puschkin auf seinem Weg in die Verbannung im ukrainischen Zaporoschje und hinterlässt dort seine Spuren. 150 Jahre später feiert die jüdische Familie Katz gemeinsam Silvester und es wird gemunkelt, dass diese von Puschkin abstammt. Puschkins Geschichte ist nur ein Nebenstrang der Hauptgeschichte, sozusagen die Einleitung. Diese führt uns heran an außergewöhnliche Personen, die sich an Skurrilität und Wahnwitz nichts schenken - Puschkins Erben. Knoblauch, Katz und Winter treffen aufeinander und liefern sich ein Wettrennen. Mark Knoblauch, der sich nach Amerika sehnt und sich der Sowjetunion entziehen möchte, Alka Katz - Hemingwayverehrerin und die Frau, die über allen anderen steht, wie es scheint - und Josik Winter, Puschkinverehrer durch und durch. Die Literatur lässt ihn sogar seine Ehepflichten vergessen. Aber nicht nur diese treiben die Geschichte voran, sondern auch noch die anderen Verwandten. Das Buch beginnt vielversprechend und hinterließ bei mir einige Wow-Effekte und das brauche ich auch beim lesen. Im Mittelteil hatte ich meine Schwierigkeiten überhaupt dabei zu bleiben. Der Wechsel zwischen den einzelnen Personen war mir zu schnell, zu wenig in die Tiefe gehend. Gegen Ende hin hatte mich dann die verrückte Geschichte der ganzen Familie wieder in seinen Bann gezogen. So unglaublich skurril und verrückt. Für mich befand sich jede einzelne Figur auf eine Art Selbstfindungstrip. Mit dem Sozialismus habe ich doch eher immer angestaubte langweilige und stereotype Menschen verbunden, die nicht frei sind in ihrem Denken. Dann doch auf so extreme und irre Personen zu stoßen - darauf war ich nicht gefasst. Das Ende war ganz nach meinem Geschmack - zusammen mit den verschiedenen Zeitungsartikeln und Mark's Briefen an Josik war der Schluss perfekt abgerundet. Begeistert bin ich auch von der Sprache der Autorin. Die Geschichte lässt mich mit sehr gemischten Gefühlen zurück, vor allem, weil es mich im Mittelteil leider nicht so sehr überzeugen konnte.









