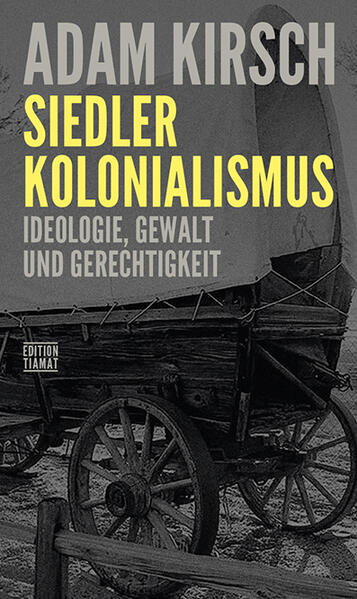
Zustellung: Sa, 05.04. - Di, 08.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Seit 10/7 macht ein neues Schlagwort die Runde: Siedlerkolonialismus. Es bezieht sich keineswegs nur auf ju dische Siedlungen außerhalb Israels, sondern auf den Staat selbst. Menschen europäischer Herkunft denn als solche gelten Israelis in diesem Konzept hätten kein Recht, irgendein Land anderswo in der Welt auf Kosten der dort lebenden Bevölkerung zu besiedeln.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. März 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
200
Reihe
Critica Diabolis
Autor/Autorin
Adam Kirsch
Übersetzung
Christoph Hesse
Nachwort
Tim Stosberg
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Produktart
kartoniert
Gewicht
256 g
Größe (L/B/H)
208/122/20 mm
ISBN
9783893203253
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Kolonisten überall
Adam Kirsch über einen israelfeindlich aufgerüsteten Begriff
Seit dem 7. Oktober 2023, als die Hamas in den Süden Israels einfiel und binnen weniger Stunden 1139 Menschen ermordete, ist das Wort "Siedlerkolonialismus" in aller Munde. Zwar ist es "seit zwei Jahrzehnten schon ein viel diskutierter Begriff, der weit über den Nahen Osten hinausreicht", wie der New Yorker Literaturkritiker Adam Kirsch in seinem neuen Buch betont, aber erst mit den weltweiten Protesten gegen den Gaza-Krieg sei das Konzept aus den Seminarräumen der Universitäten auf die Straßen geschwappt. Bei den Protesten ließ sich die Amalgamierung von postkolonialer Theorie und antiisraelischem Aktivismus geradezu mustergültig studieren. Zareena Grewal beispielsweise, Anthropologie-Professorin an der renommierten Yale University, bezeichnete Israel nur fünf Tage nach dem Massaker als "mörderischen genozidalen Siedlerstaat" und gestand den Palästinensern jedes Recht zu, "sich durch bewaffneten Kampf zu wehren". Kirsch zitiert viele weitere solche Beispiele, die die Zentralität des Siedlerkolonialismus-Paradigmas im gegenwärtigen antiisraelischen Diskurs belegen.
Es ist das erste politische Sachbuch von Adam Kirsch, der bisher vor allem mit seinen Gedichten sowie seinen Essays über moderne Literatur Bekanntheit erlangt hat. Dass er sich nun zu diesem Buch genötigt sah, zeigt den Ernst der Lage. "Von Anfang an war klar", heißt es in der Einleitung, "dass es sich hier um historische Ereignisse handelt, deren volle Auswirkungen sich erst nach langer Zeit bemerkbar machen und noch länger brauchen werden, um begriffen zu werden - abgesehen davon, dass es wie bei fast allen Ereignissen, die bedeutsam genug sind, um in die Geschichte einzugehen, weitaus besser wäre, wenn sie nie stattgefunden hätten." Sein stilistisch brillanter, aus sieben Kapiteln bestehender Langessay soll dazu beitragen, die Folgen des 7. Oktobers für den politischen Diskurs zu verstehen.
Kirsch zeichnet nach, wie ein geschichtswissenschaftlicher Ansatz, der ursprünglich die europäische Kolonisierung Nordamerikas und Australiens erklären sollte, zu einer eigenständigen Ideologie werden konnte. Über den deskriptiven und analytischen Nutzen der Kategorie des Siedlerkolonialismus als einer spezifischen Form des Kolonialismus erfährt der Leser leider wenig, denn Kirsch konzentriert sich auf dessen Inanspruchnahme für einen politischen Aktivismus, der darauf abzielt, "siedlerkolonialistische" Gesellschaften zu delegitimieren. Sowohl der Begriff des "Siedlers" als auch der des "Kolonialismus" erhielten in dieser aktivistischen Aneignung der Theorie einen neuen Sinn: Mit "Siedlern" seien dort nicht nur die historischen europäischen Siedler gemeint, die einst nach Nordamerika oder Palästina gekommen waren, sondern auch die heutigen Bürger der USA und Israels. "Neu am Begriff des Siedlerkolonialismus ist die Vorstellung", so Kirsch, das ursprüngliche Unrecht des Kolonialismus werde "stets aufs Neue verübt". Der einzige Weg, dieses Unrecht zu beenden, sei die "erlösende Zerstörung" des siedlerkolonialistischen Gebildes und die Deportation der "Siedler" in ihre "Herkunftsländer".
Doch während es unvorstellbar ist, dass die USA oder Australien aufgelöst und das gesamte Territorium der (größtenteils verdrängten und dezimierten) indigenen Bevölkerung zurückgegeben wird, sei die Vernichtung Israels, das "die bereits in Palästina lebenden Menschen zwar vertrieben, doch nicht ausgelöscht oder ersetzt hat", eine reale Möglichkeit. Postkoloniale Aktivisten arbeiteten sich daher geradezu obsessiv am jüdischen Staat ab, dessen Zerstörung ihren Wunschtraum der Dekolonisierung vollenden würde. Sie projizierten die Erbsünde des Siedlerkolonialismus auf Israel und stellten mit der Anklage ihre eigene Tugendhaftigkeit unter Beweis.
Adam Kirsch stellt dieser radikalen Israelfeindschaft eine fast schon altbackene liberale Forderung entgegen: die nach einer friedlichen Koexistenz von Juden und Arabern in zwei unabhängigen Staaten. Sein Buch ist keine Apologie der israelischen Regierung, und er erkennt das Elend der palästinensischen Situation explizit an. Doch die Ideologie des Siedlerkolonialismus führe nur dazu, "Hass auf die als Siedler Bezeichneten zu schüren und Hoffnung auf deren Verschwinden zu wecken". Sie trage somit nicht zur Lösung, sondern zur Verschärfung des Konflikts bei. Die Leidtragenden dieser Ideologie seien letztendlich die Menschen, die zwischen Jordan und Mittelmeer lebten. Ihnen wünscht Kirsch eine glücklichere Zukunft. PHILIPP LENHARD
Adam Kirsch: "Siedlerkolonialismus".
Ideologie, Gewalt und Gerechtigkeit.
Aus dem Englischen von Christoph Hesse. Nachwort von Tim Stosberg. Edition Tiamat, Berlin 2025. 200 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Siedlerkolonialismus" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.








