Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
Ihr 18% Rabatt11 auf ausgewählte Eurographics Puzzles mit dem Code PUZZLE18
Jetzt einlösen
mehr erfahren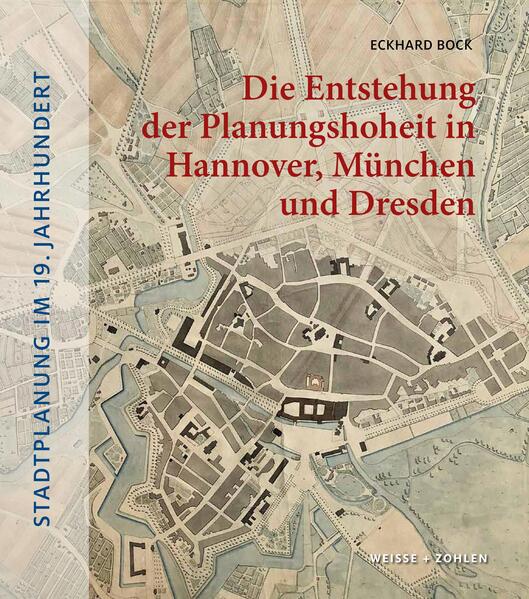
Zustellung: Di, 25.02. - Do, 27.02.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Im Zuge der Industrialisierung wuchsen die Städte im frühen 19. Jahrhundert rapide an, gegen Ende des Jahrhunderts sogar explosionsartig. Der Oberhofbaudirektor Georg Ludwig Friedrich Laves (1788 1864) hatte im Königreich Hannover das Planungsgeschehen steuernde Baukommissionen eingeführt und konnte bis 1864 die Stadtentwicklung beeinflussen. Er sah sich mit erheblichen Widerständen der Stadt Hannover konfrontiert, setzte aber städtebauliche Maßstäbe durch die Planung der Ernst-August-Stadt und des Steinthorfeldes. Als Reaktion auf soziale und gesundheitliche Missstände des Städtebaus, insbesondere in Berlin, versuchten Architekten, Ingenieure und Politiker ab ca. 1876 Einfluss auf die Stadtentwicklung und politische Rahmenbedingungen zu nehmen. Erste Ansätze für eine räumliche Entwicklung des Gemeinwesens und das Freihalten von großen Freiflächen sind ab 1850 auch in Dresden zu verzeichnen. Andere Städte unterstützten im Wesentlichen die Interessen von Grundstücksbesitzern. So wurden in Hannover erst 20 Jahre nach Laves` Tod und nach Überwinden einer am Grundbesitz orientierten Stadtpolitik Planungen für die Gesamtstadt auf den Weg gebracht und an seine Aktivitäten angeknüpft. Die neue Disziplin der Stadtplanung sah ab den 1890er-Jahren ihre Aufgabe darin, zu hohe Grundstücksausnutzung zu begrenzen, Stadterweiterungen zu ermöglichen, Genossenschaften zu fördern und für Infrastruktur und Freiflächen zu sorgen. Dresden kann als erste Stadt bezeichnet werden, die über eine kompetente Stadtplanung verfügte und die gemeinsam mit einer Aufsichtsbehörde grundlegende Planungsprinzipien verfolgte (Öffentlichkeitsbeteiligung, Offenlage von Plänen, Trennung von Gewerbegebieten und Wohnstandorten). Die Stadtentwicklung Münchens und Hannovers ist ab 1890 von den Ideen des künstlerischen Städtebaus nach Camillo Sitte beeinflusst worden; beide haben weitere bedeutsame Aufgaben erstmals wahr - genommen (Umlegung von Grundstücken, Definition von erhaltenswerten Gebäuden, Planungswertausgleich und Abtretung von Grundstücken für Freiflächen). Eckhard Bock vergleicht erstmals die frühe Planungstätigkeit der Städte München, Hannover und Dresden untereinander. Die später förmlich definierte städtische Planungshoheit wurde in ganz unterschiedlicher Weise wahrgenommen. Die Gestaltung von Stadterweiterungen und andere Planungsaufgaben wie die Wohnraumversorgung wurden - allerdings ohne konsistente rechtliche Grundlagen - in Angriff genommen. Allein in Dresden kann man von der bewussten Trennung von einer rein an der Gefahrenabwehr orientierten Bauaufsicht und einer über dieser angeordneten, unter der Fachaufsicht von Landesbehörden stehenden städtischen Planungsbehörde sprechen. Erst diese, in Sachsen gedanklich und praktisch vollzogene Trennung führte dann allerdings erst im Jahr 1960 zu der heute bekannten durch Städte und Gemeinden selbstständig wahrzunehmenden Planungshoheit und damit zur institutionalisierten Stadtplanung
Produktdetails
Erscheinungsdatum
30. September 2024
Sprache
deutsch
Auflage
Originalausgabe
Seitenanzahl
191
Autor/Autorin
Eckhard Bock
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
zahlreiche überwiegend farbige Abbildungen
Gewicht
964 g
Größe (L/B/H)
276/249/17 mm
ISBN
9783982581446
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 06.12.2024
Besprechung vom 06.12.2024
Breiter müssen die engen Straßen werden
Staatsrecht trifft Kommunalpolitik: Eckhard Bock über die Entstehung der städtischen Selbstverwaltung im neunzehnten Jahrhundert
Selten interessieren sich Staatsrechtler für Kommunalpolitik. Doch jüngst hielt der angesehene Staatsrechtslehrer Ulrich Battis im Berliner Werkbund ein energisches Plädoyer für die Basisarbeit der Städte und Gemeinden in Deutschland. Bei der Vorstellung des Buches "Stadtplanung im 19. Jahrhundert", in dem der ehemalige Berliner Stadtplaner und Kommunalpolitiker Eckhard Bock die Entstehung der kommunalen Planungshoheit in Deutschland untersucht, trat Battis als Ko-Referent auf und erinnerte an die mühsam erkämpfte städtische Selbstverwaltung. Und er warnte davor, dass neue Planungsrechte von Bund und Ländern - vor allem gut gemeinte Vorgaben in der Energie- und Umweltpolitik - zur Aushebelung der kommunalen Autonomie führen, der jüngsten und verletzlichsten Errungenschaft des bürgerlichen Verfassungsstaates.
Zwar zielte schon die steinsche Städteordnung 1808 auf den Aufbau selbstverwalteter Kommunen als Grundlage eines selbstbewussten neuen Staates. Doch erst nach Jahrzehnten restaurativer Rückschläge wurde die Planungshoheit der Städte und Gemeinden im Bundesbaugesetz 1960 festgeschrieben. Wie mühsam diese Emanzipation vom Absolutismus war, schildert Eckhard Bock in oft erschlagender Detailfülle am Beispiel von Hannover im Vergleich mit München und Dresden. Hannovers einstiges vordemokratisches Glück war der Oberhofbaudirektor Georg Ludwig Friedrich Laves (1788 - 1864), der "Schinkel von Hannover", der die Planung der königlichen Residenzstadt weitblickend steuerte.
Doch in der Hochphase der industriellen Revolution waren Laves und seine königlichen Baukommissionen überfordert. Zwar kamen mit den privaten Grundeigentümern neue liberale Urkräfte beim Bau von Stadtteilen und Mietshäusern hinzu, die aber wegen ihrer extremen Verwertungsinteressen keine Garanten für guten Städtebau waren.
Am Beispiel der Oststadt von Hannover schildert der Autor, wie zu enge Straßen und Höfe jedes Mal auf nutzbare Formate erweitert werden mussten. Denn die bis dahin ebenfalls tonangebende Baupolizei beachtete allein die Fluchtlinien der Straßen und die Feuersicherheit. Doch beim Entwurf der Häuser und ihrer Nutzungstypen bis hin zur städtebaulichen Ensemblebildung fehlte den Hofbeamten jede Erfahrung. Zudem wuchs Hannover früher als alle anderen deutschen Städte durch Eingemeindungen flächenmäßig bereits 1859 um das Fünfzehnfache, was den Bedarf an städtischer Planungsexpertise steigerte.
Als Reaktion auf soziale und gesundheitliche Missstände hatten Architekten, Ingenieure und Kommunalpolitiker nach der Annexion des Königreichs Hannover durch Preußen 1866 dem Hof die Planungshoheit abgerungen und auch die Grundeigentümer ins Stadtregiment eingebunden. Erstmals wurde die Daseinsvorsorge zur Amtsaufgabe, die damals noch "Wohlfahrtspflege" hieß. Zum Bau der technischen Infrastruktur und der Verkehrswege kamen die Neuordnung von Baugrundstücken, das Enteignungsrecht und die Abschöpfung von Bodenwertsteigerungen als kommunale Aufgaben hinzu. Vor allem die "Wertzuwachssteuer", die die privaten Profite dämpfte und mit der Hannover nach 1900 sogar reichsweit führend war, fand den Zuspruch des Staatsrechtlers Hugo Preuß, der ihre Überführung in ein Reichsgesetz 1911 scharf kritisierte: "Die Steuer war in sicherem Vordringen. Da führte sie das Reichsgesetz zum scheinbaren Sieg, und das war ihr Ruin; losgerissen von ihrem kommunalen Mutterboden ist sie jetzt im Verdorren."
Dagegen waren bayerische Gemeinden seit 1869 eigenständig, kannten aber laut Eckhard Bock noch keine Enteignungen oder Wertabschöpfungen; vielmehr stellte die Bauordnung derlei Einbußen "dem Übereinkommen der Gemeinden mit den Beteiligten" anheim. Mit solchen Konsensmethoden vermochte etwa die Münchner Verwaltung die Grundeigentümer an der Theresienwiese freiwillig zu Baueinschränkungen zugunsten eines Stadtparks zu bewegen. Insgesamt schuf die Bündelung der Kompetenzen für Planungspolitik und Baurechte bei den Stadtverwaltungen, so generalisiert der Autor treffend, die von allen Beteiligten gleichermaßen akzeptierte Basis für rechtssichere Eingriffe in das Privateigentum.
Besondere Beachtung schenkt der Autor dem Vorbild Dresden, wo mit dem Sächsischen Baugesetz 1900 erstmals eine klare Aufgabentrennung zwischen dem Sicherheitsbestreben der Baupolizei und dem Gestaltungswillen der Stadtplaner entstand. Überdies schrieben die Sachsen die Beteiligung der Öffentlichkeit bei Planungsfragen fest und sicherten den Kommunen eine erweiterte Selbstverwaltung, die von keiner übergeordneten Stelle mehr eingeschränkt wurde. Aus dem Dresdner Vorbild entstand nach langer Inkubationszeit das Bundesbaugesetz 1960, dem die deutschen Städte ihre Selbständigkeit verdanken - bislang noch. MICHAEL MÖNNINGER
Eckhard Bock: "Stadtplanung im 19. Jahrhundert". Die Entstehung der Planungshoheit in Hannover, München und Dresden.
Weisse + Zohlen Verlag, Berlin 2024. 192 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Stadtplanung im 19. Jahrhundert" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









