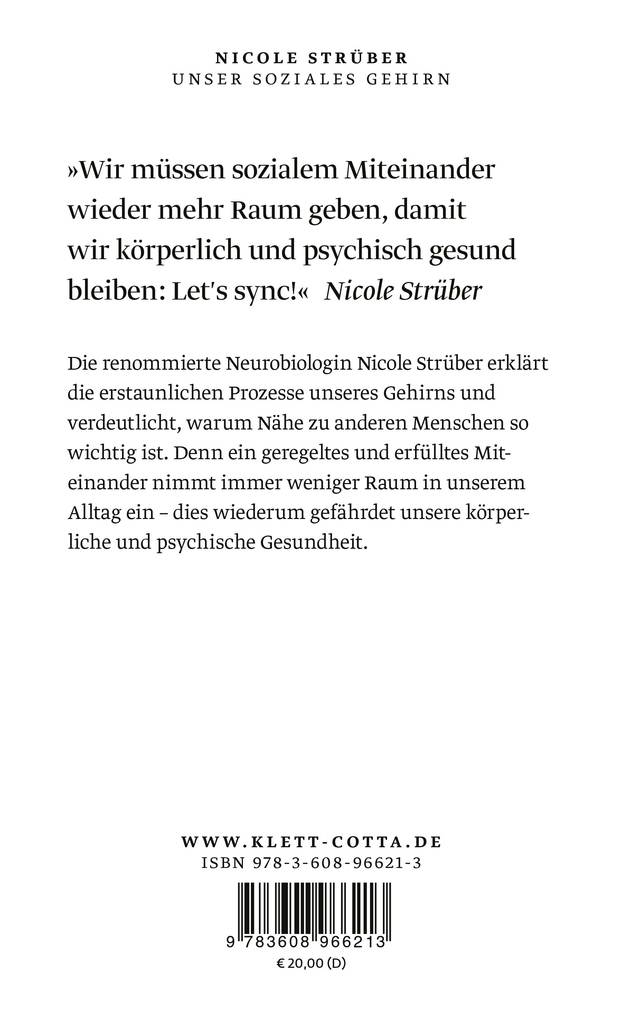Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
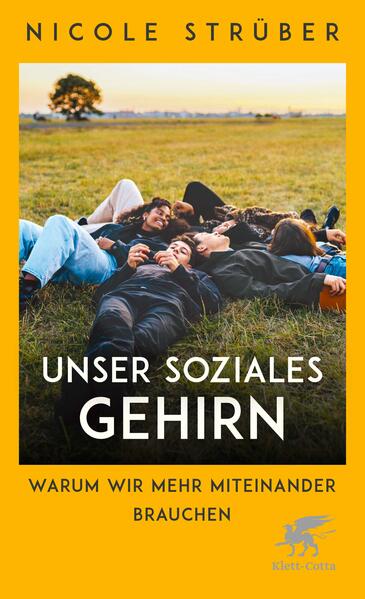
Zustellung: Do, 06.02. - Sa, 08.02.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
»Wir müssen sozialem Miteinander wieder mehr Raum geben, damit wir körperlich und psychisch gesund bleiben: Let's sync! « Dr. Nicole Strüber
Die renommierte Neurobiologin Nicole Strüber erklärt die erstaunlichen Prozesse unseres Gehirns und verdeutlicht, warum Nähe zu anderen Menschen so wichtig ist. Denn ein geregeltes und erfülltes Miteinander nimmt immer weniger Raum in unserem Alltag ein - dies wiederum gefährdet unsere körperliche und psychische Gesundheit.
Wir erleben es überall: Kinder in unzureichend betreuten Kitagruppen, auf Effizienz getrimmtes Familienleben, WhatsApp-Nachrichten statt spontanem Besuch, Videokonferenz statt persönlicher Besprechung, mit Stoppuhr ablaufende Arzttermine und Pflegebehandlungen - wir verbringen immer weniger Zeit in einem wirklichen Miteinander. Unser Gehirn benötigt diesen Austausch jedoch. Wir synchronisieren uns, und es werden Botenstoffe wie Oxytocin ausgeschüttet. All dies fördert unsere Entspannung, unsere Gesundheit, unsere Bereitschaft zu Veränderung, unsere Empathie und unser Vertrauen in andere. Und es lässt uns im Miteinander andere verstehen und mit ihnen kooperieren. Miteinander fördert Miteinander: Let's sync! Nicole Strüber vereint neuestes Forschungswissen mit der aktuellen Situation - und fordert ein politisches und gesellschaftliches Umdenken.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
07. September 2024
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage 2024
Ausgabe
Ungekürzt
Seitenanzahl
375
Autor/Autorin
Nicole Strüber
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
3 Abb.
Gewicht
425 g
Größe (L/B/H)
208/126/32 mm
Sonstiges
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur, Klappenbroschur
ISBN
9783608966213
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Es ist sehr angenehm, dass die Autorin [ ] die Mühen wissenschaftlicher Forschung mit all ihren empirischen und theoretischen Widersprüchen ernst nimmt und transparent macht. Obwohl sie sehr verständlich und praxisorientiert schreibt, liefert sie zugleich umfangreiches Hintergrundwissen und ermöglicht durch viele Einschübe und Verweise ein tieferes Eintauchen in die Materie. [ ] Unser soziales Gehirn ist ausgezeichnet aufgebaut und gestaltet. «
Ronald Sladky, Spektrum der Wissenschaft, 14. Januar 2025 Ronald Sladky, Spektrum der Wissenschaft
»Neben vielen Ausflügen in die Welt der Wissenschaft, gibt es auch immer Seiten über Unsere Welt! . Dabei wagt die Autorin einen ehrlichen Blick in unsere Gesellschaft. «
Natascha Heidenreich, Frankfurter Neue Presse, 02. Dezember 2024 Natascha Heidenreich, Frankfurter Neue Presse
Ronald Sladky, Spektrum der Wissenschaft, 14. Januar 2025 Ronald Sladky, Spektrum der Wissenschaft
»Neben vielen Ausflügen in die Welt der Wissenschaft, gibt es auch immer Seiten über Unsere Welt! . Dabei wagt die Autorin einen ehrlichen Blick in unsere Gesellschaft. «
Natascha Heidenreich, Frankfurter Neue Presse, 02. Dezember 2024 Natascha Heidenreich, Frankfurter Neue Presse
 Besprechung vom 22.01.2025
Besprechung vom 22.01.2025
Streicheln Sie bitte mit dem richtigen Tempo
Nicole Strüber zieht Schlüsse aus den Erkenntnissen der Neurowissenschaft für unser soziales Miteinander
Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir werden in soziale Gemeinschaften hineingeboren und sind, während wir aufwachsen, durch Lernerfahrungen in einer sozialen Umwelt geprägt. Wie sind die entsprechenden sozialen Funktionen in unserem Gehirn verankert? Und welche Rückschlüsse lassen sich aus neurowissenschaftlichen Erkenntnissen über diese Funktionen für das Zusammenleben in modernen Gesellschaften ziehen? Das sind die Fragen, denen Nicole Strüber in ihrem Buch "Unser soziales Gehirn" nachgeht.
Der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit den Hirnmechanismen sozialer Funktionen. Nachdem die Neurowissenschaften im vergangenen Jahrhundert noch fast ausschließlich damit beschäftigt waren, die Funktionsweise einzelner Gehirne zu erforschen, haben sie in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend die Mechanismen zwischenmenschlicher Interaktionen in den Blick genommen. Beginnend mit den neuronalen Grundlagen von Emotionen und Empathie bis hin zu den Hirnmechanismen von Kooperation und interaktiver Entscheidungsfindung hat diese Forschung eine Reihe wichtiger Erkenntnisse geliefert. Strüber liefert zahlreiche gut verständliche Kurzbeschreibungen aktueller Studien aus den sozialen Neurowissenschaften und lässt es sich nicht nehmen, ihre Begeisterung für diese Forschung zu teilen.
Eine zentrale Rolle spielt dabei Oxytocin, ein Hormon, das neben Gebärmutterkontraktionen unter der Geburt auch die Bindung der Mutter zum Kind verstärkt, aber auch sonst prosoziales Verhalten begünstigt. Seine Ausschüttung wird durch körperliche Nähe und Berührungen ausgelöst (Streichelbewegungen mit einer Geschwindigkeit von drei Zentimetern pro Sekunde sind besonders wirksam), es reduziert Stress, fördert Nähe und Vertrauen.
Ein neurophysiologischer Mechanismus sozialer Interaktion, den Oxytocin begünstigt, ist die Synchronisierung zwischen Personen, die sich nicht nur an deren Verhalten, sondern auch an ihrer Hirnaktivität ablesen lässt. Je stärker die Synchronisierung, desto verbundener fühlen wir uns, desto besser kooperieren wir - und desto mehr Oxytocin schütten wir wiederum aus. So wird unter anderem die synchronisierte Regulation von Emotionen verbessert, eine wichtige Grundlage für ein vertrauensvolles Miteinander.
Sollte uns also täglich eine Dosis Oxytocin verabreicht werden, und schon lägen wir uns alle nur noch in den Armen? Leider ist dem nicht so, und Strüber verschweigt die Kehrseite der Oxytocinmedaille nicht: Im Gegensatz zu den prosozialen Verhaltensweisen innerhalb einer Gruppe schürt es gegenüber Angehörigen anderer Gruppen Vorurteile, Ausgrenzung und Aggression. Oxytocin ist nicht nur Kuschel-, sondern auch Konflikthormon.
Der zweite Teil des Buches nimmt Lebensbereiche in den Blick, für welche die Erkenntnisse der sozialen Neurowissenschaften von Bedeutung sein könnten - von der Familie über Schule, Freundschaften, Partnerschaft, Geschäftswelt und interkulturelle Begegnungen bis hin zur Psychotherapie. Besonders eindrucksvoll sind in dieser Hinsicht die Forschungsergebnisse zur Synchronität von Hirnaktivität, zum Beispiel zwischen Lehrerinnen und Schülern. Je stärker deren Hirnaktivität während des Unterrichts synchronisiert ist, desto besser wird der Lernstoff behalten. Ähnliches gilt für die Psychotherapie: Je stärker die Synchronisierung zwischen Therapeut und Patientin, desto besser die therapeutische Allianz und desto wirksamer die Behandlung.
Solcherlei Befunde sind faszinierend. Und doch stellt sich die Frage, inwieweit sie für die Gestaltung unseres Zusammenlebens relevant sein können. Zweifellos wird die Bedeutung zwischenmenschlicher Nähe für unsere psychische und körperliche Gesundheit durch Forschungsergebnisse zu ihren neurobiologischen Grundlagen unterstrichen. So werden aufmerksame Leser im Falle einer neuerlichen Viruspandemie sicher eine kritische Haltung zu Besuchsverboten in Altersheimen und Krankenhäusern einnehmen. Aber müssen wir wirklich erst lernen, dass Berührungen Oxytocinausschüttung auslösen, um zu wissen, dass körperliche Nähe guttut? Brauchen wir neurowissenschaftliche Erkenntnisse über die Synchronisierung von Gehirnen, um zu verstehen, dass eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung den Erfolg von Psychotherapie begünstigt?
"Wir sollten unser soziales Gehirn nicht vergessen", schreibt Strüber. "Es hat uns zuverlässig durch die Evolution getragen, es wäre beleidigt, wenn wir es nun ignorieren." Was ist die Botschaft dieser vermutlich augenzwinkernd gemeinten Aussage? Sollen uns die Erkenntnisse über unser Gehirn dazu bringen, mehr Wert auf das Miteinander zu legen? Aus naturwissenschaftlichen Befunden Verhaltensnormen abzuleiten ist verführerisch, aber unzulässig, und der Fall Oxytocin zeigt, warum. Oxytocin ist eben nicht nur das nette Gutmenschenhormon, das uns händchenhaltend über sonnige Blumenwiesen tanzen lässt. Es kann uns gegenüber Menschen, die wir nicht als Teil unserer Gruppe betrachten, auch zu ziemlich unangenehmen Zeitgenossen machen.
Gerade das Thema Oxytocin wäre daher eine Steilvorlage für eine kritische Reflexion über die Konsequenzen neurowissenschaftlicher Befunde für unser Zusammenleben gewesen. Unser soziales Gehirn sagt uns eben nicht immer, dass wir miteinander reden und einander helfen sollen, wie von Strüber nahegelegt. Es sagt oft genug auch das Gegenteil. Das Kapitel über das Miteinander der Kulturen hätte zum Beispiel eine Chance geboten, diesen Punkt kritisch zu diskutieren. Stattdessen werden wieder und wieder die prosozialen Eigenschaften von Oxytocin herangezogen, um für mehr Miteinander zu werben.
Die Schlussfolgerungen sind dann bisweilen wenig originell, zum Beispiel wenn zur Verbesserung von medizinischem Behandlungserfolg und Patientenzufriedenheit ein positives Miteinander zwischen Ärzten und Patienten empfohlen wird. Für solche Empfehlungen, so berechtigt sie sein mögen, brauchen wir die Erkenntnisse der sozialen Neurowissenschaften ebenso wenig wie für die Einsicht, dass uns zärtliche Berührungen oder Gespräche mit Freunden guttun. Nichtsdestotrotz hat "Unser soziales Gehirn" verblüffende Einblicke in die noch junge Disziplin der sozialen Neurowissenschaften zu bieten. PHILIPP STERZER
Nicole Strüber: "Unser soziales Gehirn". Warum wir mehr Miteinander brauchen.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2024.
384 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.