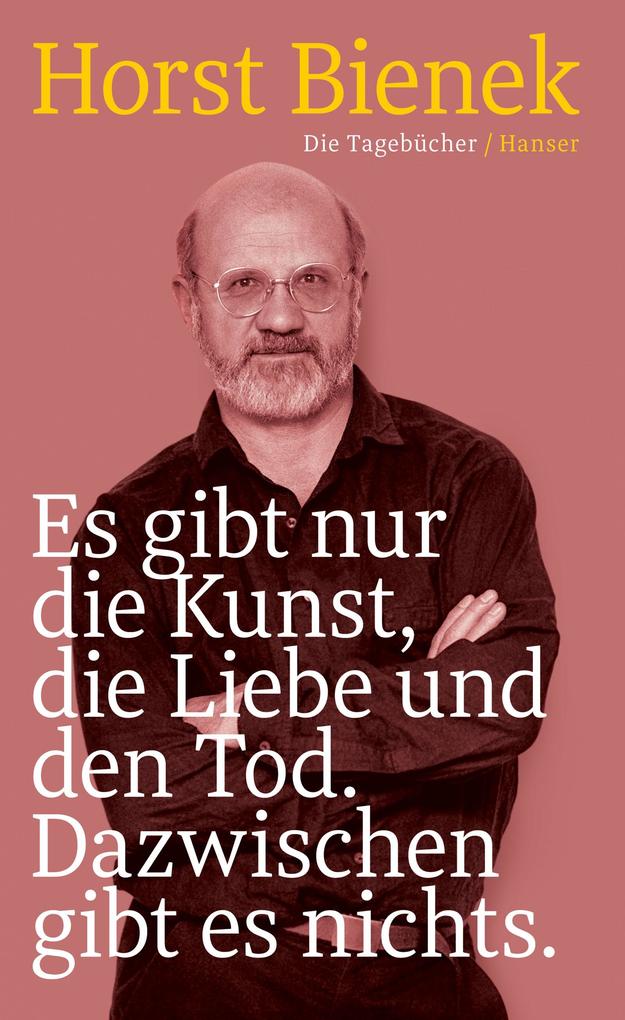
Sofort lieferbar (Download)
"Literatur hat etwas mit Leben zu tun. Literatur allein ist nichts." - Die wilden Künstlertagebücher von Horst Bienek
Als Kritiker, Romancier, Lyriker war Horst Bienek eine bestimmende Figur im Kulturbetrieb. Vierzig Jahre führte er Tagebuch. Es ist das wilde, pikareske Epos eines Getriebenen und liest sich wie der Roman seines Lebens: Mitreißend und lebendig schreibt er über Literatur, Kunst und Musik und über seine Sex-Ausflüge in die Klappen und Schwulenlokale, zwischen Lebenslust und Enttäuschung. Er trifft die Größen seiner Zeit, von Borges bis Yourcenar und begegnet den Protagonisten der Nachkriegsliteratur, von Reich-Ranicki bis Joachim Kaiser, von Bachmann bis Frisch. Ein Künstlertagebuch von radikaler Offenheit, ein großes Gesellschaftspanorama und seine ganz persönliche Lebensgeschichte.
Als Kritiker, Romancier, Lyriker war Horst Bienek eine bestimmende Figur im Kulturbetrieb. Vierzig Jahre führte er Tagebuch. Es ist das wilde, pikareske Epos eines Getriebenen und liest sich wie der Roman seines Lebens: Mitreißend und lebendig schreibt er über Literatur, Kunst und Musik und über seine Sex-Ausflüge in die Klappen und Schwulenlokale, zwischen Lebenslust und Enttäuschung. Er trifft die Größen seiner Zeit, von Borges bis Yourcenar und begegnet den Protagonisten der Nachkriegsliteratur, von Reich-Ranicki bis Joachim Kaiser, von Bachmann bis Frisch. Ein Künstlertagebuch von radikaler Offenheit, ein großes Gesellschaftspanorama und seine ganz persönliche Lebensgeschichte.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
21. Oktober 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
1712
Dateigröße
6,32 MB
Autor/Autorin
Horst Bienek
Herausgegeben von
Daniel Pietrek, Gisela vom Bruch, Michael Krüger
Nachwort
Michael Krüger
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783446297760
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 20.03.2025
Besprechung vom 20.03.2025
Die Aufzeichnungen eines vom Trieb Getriebenen
Und gleichwohl eine künftig unentbehrliche Quelle zur deutschen Literatur der Achtzigerjahre: Die Tagebücher des Schriftstellers Horst Bienek
Noch in den Achtzigerjahren wurden die Romane von Horst Bienek viel gelesen, vor allem seine schlesische Tetralogie, eine ganz eigene Suche nach der verlorenen Zeit und der untergegangenen Welt. Bienek wurde 1930 in Gleiwitz geboren. Am Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte er dort den Todesmarsch der Auschwitz-Häftlinge und das Inferno beim Einmarsch der Roten Armee. Auch davon handeln die vier Romane, allerdings ist die Leserschaft schlesischer Tetralogien inzwischen stark rückläufig. Nun aber kehrt Horst Bienek überraschend zurück mit einem wuchtigen Band, seinem 1700 Seiten starken Tagebuch. Es ist ein brisantes, zumutungsvolles, faszinierendes Werk, wie es in der deutschen Literatur nicht seinesgleichen hat.
Bienek war nicht nur selbst Romancier, sondern auch ein leidenschaftlicher Kritiker (unter anderem für diese Zeitung) und ein sehr erfolgreicher Organisator von Literaturveranstaltungen. Deshalb ist im Tagebuch, das er, mit Ausnahme einiger früher Aufzeichnungen, von 1980 bis kurz vor seinem frühen Tod 1990 führte, viel vom Literaturbetrieb die Rede. Einen Namen hatte Bienek sich bereits um 1960 gemacht, als er das amerikanische Format der "Werkstattgespräche" nach Deutschland übertrug und mit vielen wichtigen Autoren große Interviews führte, die wiederholt im Radio gesendet wurden und dann auch in Buchform zum literaturkritischen Referenzwerk wurden.
Bieneks Skizzen und Betriebsinterna sind nicht nur eine Fundgrube für Literaturhistoriker, sondern auch sehr unterhaltsam zu lesen. 1981 erhält mit Elias Canetti ein deutschsprachiger Autor den Nobelpreis. Bienek ist an diesem Tag in der Akademie der Künste und notiert: "Mendelssohn wurde ganz höhnisch, Unseld giftete, Reich-Ranicki bebte vor Zorn, und Sternberger schrie über alle Tische hinweg: Was für eine monströse Fehlentscheidung!" Das Tagebuch enthält viele scharfsichtige, bisweilen auch schonungslose Porträts von Autoren, etwa von Walter Kempowski, Günter Kunert, Christa Reinig oder Uwe Johnson. Bienek registriert dessen "hartes verschlossenes, ja verriegeltes Gesicht, in dem sich niemals auch nur der Anflug eines Lächelns zeigt; seine tiefe barbarisch tiefe Stimme: damit ich dich besser fressen kann . . . Sie lässt ihn übrigens alt, sehr alt wirken."
Von großer Zuneigung geprägt sind dagegen die vielen Beschreibungen des Eheunglücks und der sonstigen existenziellen Miseren Wolfgang Koeppens, mit dem Bienek sich regelmäßig trifft. Er ist für ihn der liebenswürdigste Schnorrer, der je Verleger und Kritiker hingehalten hat mit den Verheißungen eines nie geschriebenen großen Romans. Bienek ließ sich dagegen nicht zum Narren halten: "Ich weiß, dass er seit langem nichts mehr schreibt, nicht mehr schreiben kann." Kein Koeppen-Biograph wird fortan ohne die reichhaltigen Auskünfte dieses Tagebuchs auskommen.
In den Achtzigerjahren schämte er sich, ein Deutscher zu sein
Als junger Mann war Bienek Meisterschüler bei Brecht am Berliner Ensemble. Nach wenigen Wochen wurde er jedoch Opfer einer Denunziation. Brecht sah tatenlos zu, wie sein Mitarbeiter 1951 verhaftet und wegen antisowjetischer Hetze und Spionage zu zwanzig Jahren Zwangsarbeit nach Workuta deportiert wurde. Als er 1955 vorzeitig aus dem Gulag entlassen wurde, hatte Bienek mit dem Sozialismus abgeschlossen. Gerade deshalb aber befasste er sich fortan intensiv mit Schriftstellern wie Solschenizyn. Und mit geradezu fiebernder Aufmerksamkeit verfolgte der Tagebuchschreiber in den Achtzigerjahren die Umbrüche in Polen, als die Gewerkschaft Solidarnosc zur Organisation des Widerstands wurde. Es ärgerte ihn, dass die westdeutschen Intellektuellen kaum Anteil nahmen an den Geschehnissen im Nachbarland. Maßgebliche Linke wie Günter Grass oder Egon Bahr riefen die Polen gar zur Ordnung, damit die "Entspannungspolitik" nicht gefährdet werde. Bienek schreibt: "Es ist erschreckend, wie wenig den Westen die Tragödie Polens tangiert. Dagegen riesige Protestmärsche gegen die Junta in El Salvador. (...) Ich schäme mich, ein Deutscher zu sein."
Von schwerer Krankheit gezeichnet, erlebte er noch, wie das sozialistische Imperium kollabierte: "Das war bewegend!!! Ich habe geheult. In drei Monaten ist der ganze kommunistische Block zusammengebrochen", notierte er am 31. Dezember 1989. Allerdings mischte sich wenige Tage später bereits Sorge in die Euphorie: "Gestern war eine Großkundgebung (nach altem Muster) gegen den Faschismus . . . Dass da 250.000 Menschen zusammenkommen, verblüfft mich." Was war passiert? Man hatte in Berlin-Treptow Schmierereien am sowjetischen Ehrenmal entdeckt. Bienek sah, dass die SED die erste Gelegenheit nutzte, um "sich wieder aufzumendeln", indem sie ihre letzte Waffe, die "Ideologie des Antifaschismus", zur Geltung brachte. Die Westmedien "fallen darauf rein", klagt er.
Seine Homosexualität hat Bienek aus den Romanen weitgehend herausgehalten. Für solche Zugeständnisse machte er sich selbst Vorwürfe und verpflichtete sich im Tagebuch darauf, explizit zu sein. Der Rezensent kennt denn auch kein anderes Werk, in dem so offen und so obsessiv über schwulen Sex geschrieben wird. Schon 1959 hatte Bienek, womöglich in der Erinnerung an Erlebnisse in russischer Gefangenschaft, die Formel vom "Eros als religiöse Ekstase" gefunden. 1983 notierte er dann weniger bildungsbürgerlich: "Es war ein unmittelbarer Weg von meinem Arschloch bis zum Himmel. Das klingt jetzt so blasphemisch, aber es war so, es gab Exaltationen meines Körpers, da war ich nicht mehr ich selbst, da trat ich aus mir hinaus, da vereinigte ich mich mit Gott." Wo immer jemand sich mit der Mystik der Ausschweifung und der metaphysischen Kompetenz der Geschlechtsorgane auskennt, wie etwa der junge Indienfahrer Peter Sloterdijk, ist Bienek entflammt.
Notizen eines Opfers seiner sexuellen Hörigkeit
Profaner könnte man feststellen, dass er sexsüchtig ist: "Bin völlig ausgeliefert; manchmal frage ich mich, bin ich ein Schriftsteller - oder nur noch Opfer meiner sexuellen Hörigkeit. Allerdings ein fantastischer Fick an der Friedhofsklappe. Ein Traumschwanz; Gesangsstudent." Ob in seiner Wahlheimat München, ob in Berlin, Rom, Toronto, New York oder New Orleans - in jeder Stadt sucht Bienek sogleich die einschlägigen Schwitzbäder, Parks, Gebüsche und Bars auf, und meist dauert es nur Minuten, bis er Sexpartner findet. Eher selten kommt es vor, dass sich - wie in einer Dortmunder Sauna - seine Erwartungen nicht erfüllen: "Ganz leer; nur ältere, betuliche Herrschaften - wo sind denn die jungen, geilen Ruhr-Arbeiter? Bin geflohen." Krassheit und Komik verbinden sich in diesen Aufzeichnungen eines vom Trieb Getriebenen, die sich bisweilen lesen wie ein Thomas Mann auf Poppers. Die mal lakonischen, mal detailfreudigen Protokolle der Ausschweifung könnten die heterosexuelle Leserschaft irritieren. Bienek ist davon überzeugt, dass es die Schwulen "leichter" haben: "Ja, die haben es, Gottseidank, besser! Diese leidenschaftlichen Ficks mit Td. - mein Gott, das können sich Heteros gar nicht vorstellen, geschweige denn praktizieren." Wenn ohne die Geduldsproben des heterosexuellen Werbens und Verführens männliches Verlangen auf männliches Verlangen treffe, komme die Sexualität erst ins Stadium "der reinen Freiheit, der reinen Lust, der reinen Ekstase". Für die Einblicke dieses Bandes gilt, was Bienek einmal in anderem Zusammenhang feststellt: "Die Heteros müssten das lesen - seltsam, fremd, exotisch ist doch das Leben der Schwulen."
Der Mitherausgeber Michael Krüger bezeichnet die Tagebücher in seinem exzellenten Nachwort sogar als Bieneks zweites großes Romanwerk, was Berechtigung auch darin findet, dass Bienek gelegentlich in die Er-Form wechselt, als wollte er die Umwandlung in die Romanform ausprobieren. Eine pikante Pointe besteht übrigens darin, dass Krüger, der Freund, Lektor und Verleger Bieneks, selbst oft als Figur im Tagebuch auftaucht - und nicht immer schmeichelhaft gezeichnet wird. Das hindert Krüger aber nicht, den Menschen Bienek mit großer Sympathie zu porträtieren: "dieser seltsame, freche Typ im modischen Ringelpullover, der kein Blatt vor den Mund nahm, laut lachte und vor keiner Obszönität zurückschreckte . . . Er saß mir dann gegenüber, hatte die Beine auf meinen Schreibtisch gelegt und telefonierte ohne Scheu stundenlang mit Marcel Reich-Ranicki oder Hans Werner Henze oder auch mit seinen Geliebten, mit denen er ausführlich die intimsten Erfahrungen austauschte."
Ein dunkles, immer mehr hervortretendes Thema des Tagebuchs ist Aids. Auch daher ist es ein repräsentatives Werk der Achtzigerjahre. Anfangs spricht Bienek noch von einem "publizistischen Virus"; da werde eine Pogromstimmung gegen Schwule geschürt. Das wechselt bald mit Panikattacken, weil er mit seinem Lebensstil hochgefährdet ist. Auf einer Reise nach Guatemala legt er noch einmal alle Hemmungen ab, weil es dort noch kein Aids gebe. "Ich fühlte mich zurückversetzt in alte, ungehemmte Zeiten! (...) Mein Gott, war das schön, wie früher, wie in paradiesischer Zeit. So waren die siebziger Jahre!!!"
Dann aber gibt es immer mehr Aids-Tote in seinem Umkreis. Es mangelt im Tagebuch nicht an guten Vorsätzen und Selbstermahnungen, er will sein Leben ändern, gar zum Asketen werden - aber bei der nächsten Gier ist das vergessen. Immer häufiger wechselt der hyperaktive Hedonismus mit Katzenjammer. Im März 1987 bekommt er den positiven Befund. Seitdem wartet er auf die Vollstreckung des Todesurteils. Jedes Schwitzen, jeder Husten, jede Pilzerkrankung kann der Anfang vom Ende sein. 1990 stirbt Horst Bienek, nicht lange nach den Ehrungen zum sechzigsten Geburtstag. 35 Jahre später erreicht uns sein Tagebuch - ein grandioses Werk, prallvoll mit Leben, Liebe, Lust und Literatur. WOLFGANG SCHNEIDER
Horst Bienek: "Es gibt nur die Kunst, die Liebe und den Tod. Dazwischen gibt es nichts". Die Tagebücher 1951 bis 1990.
Hrsg. von Daniel Pietrek, Gisela vom Bruch und Michael Krüger. Nachwort von Michael Krüger. Hanser Verlag, München 2024.
1710 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Es gibt nur die Kunst, die Liebe und den Tod. Dazwischen gibt es nichts" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









