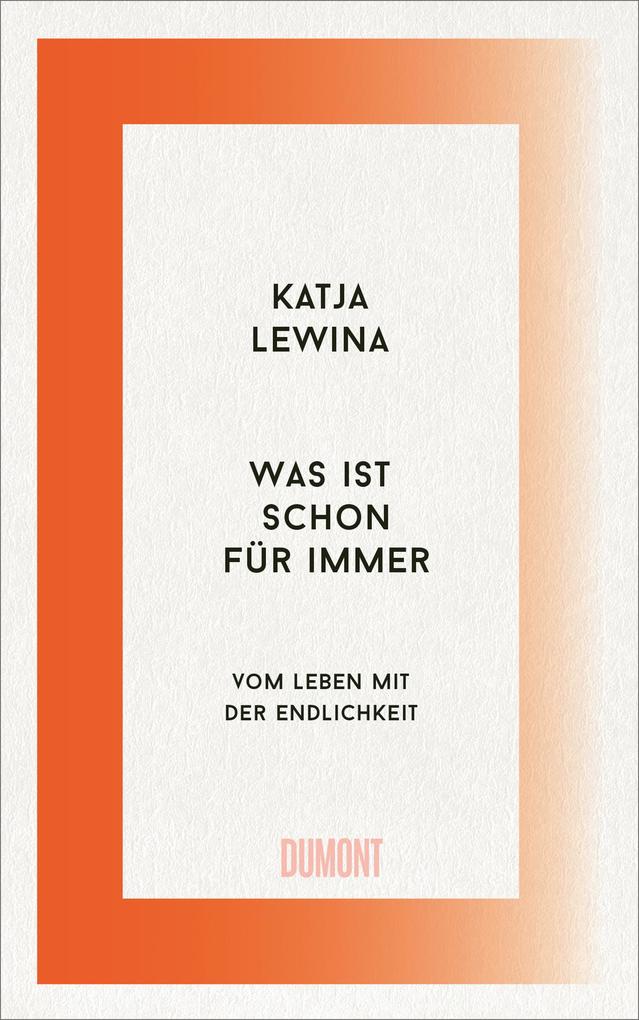
Sofort lieferbar (Download)
»Berührend und brillant, ernst und trotzdem beschwingt und so gut geschrieben: Katja Lewina führt uns mit kühner Leichtigkeit durch die schwersten Gefilde des Lebens. Kann man ein schönes Buch über das Sterben schreiben? Eigentlich nicht. Katja Lewina ist es trotzdem gelungen. « DANIEL SCHREIBER
Sterben - das tun doch immer die anderen. Die Alten vielleicht, die Kranken. Aber was, wenn der Tod näher ist als gedacht? Und unser Leben unwägbarer, als wir annehmen? Seit zwei Jahren weiß Katja Lewina von ihrer Herzerkrankung und dass sie ihr jederzeit das Leben kosten kann. Die Diagnose bekam sie kurz nach dem plötzlichen Tod ihres siebenjährigen Sohnes. Mit einem Mal wurde die Möglichkeit zu sterben Teil ihres Alltags.
In >Was ist schon für immer< beschäftigt sich Katja Lewina mit dem Thema Sterblichkeit und Verlust. Ausgehend von ihrer eigenen Situation, erkundet sie eine Erfahrung, die uns am Ende alle betrifft. Was macht unsere Endlichkeit mit der Liebe? Wie erklärt man sie den Kindern? Was wollen wir hinterlassen? Was holen wir aus unserem Leben raus - sollen wir der Gesundheit zuliebe es ruhig angehen lassen und damit eine Menge verpassen oder ganz im Gegenteil aufs Gas treten? Wie reagiert das Umfeld auf Krankheit und Tod? Gibt es richtige und falsche Worte? Was gehört geklärt und was vergessen? Diesen Fragen stellt sich Katja Lewina in elf Essays ohne die üblichen Carpe-diem-Plattitüden, aber mit dem unliebsamen Reminder: Sterben geht uns alle an.
Sterben - das tun doch immer die anderen. Die Alten vielleicht, die Kranken. Aber was, wenn der Tod näher ist als gedacht? Und unser Leben unwägbarer, als wir annehmen? Seit zwei Jahren weiß Katja Lewina von ihrer Herzerkrankung und dass sie ihr jederzeit das Leben kosten kann. Die Diagnose bekam sie kurz nach dem plötzlichen Tod ihres siebenjährigen Sohnes. Mit einem Mal wurde die Möglichkeit zu sterben Teil ihres Alltags.
In >Was ist schon für immer< beschäftigt sich Katja Lewina mit dem Thema Sterblichkeit und Verlust. Ausgehend von ihrer eigenen Situation, erkundet sie eine Erfahrung, die uns am Ende alle betrifft. Was macht unsere Endlichkeit mit der Liebe? Wie erklärt man sie den Kindern? Was wollen wir hinterlassen? Was holen wir aus unserem Leben raus - sollen wir der Gesundheit zuliebe es ruhig angehen lassen und damit eine Menge verpassen oder ganz im Gegenteil aufs Gas treten? Wie reagiert das Umfeld auf Krankheit und Tod? Gibt es richtige und falsche Worte? Was gehört geklärt und was vergessen? Diesen Fragen stellt sich Katja Lewina in elf Essays ohne die üblichen Carpe-diem-Plattitüden, aber mit dem unliebsamen Reminder: Sterben geht uns alle an.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
13. August 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
144
Dateigröße
1,57 MB
Autor/Autorin
Katja Lewina
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783755810520
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Berührend und brillant, ernst und trotzdem beschwingt und so gut geschrieben: Katja Lewina führt uns mit kühner Leichtigkeit durch die schwersten Gefilde des Lebens. Kann man ein schönes Buch über das Sterben schreiben? Eigentlich nicht. Katja Lewina ist es trotzdem gelungen. «
Daniel Schreiber
»Weise Worte«
Stella Brikey, EMOTION
»Sehr große Buchempfehlung«
Mirella Precek, MIRELLATIVEGAL
»[Das Buch] ist ein Plädoyer für eine radikale Akzeptanz der Endlichkeit. «
Matthias Kalle, TAZ
»Zeit ist kostbar, diese 144 Seiten erinnern uns daran. «
Christina Vettorazzi, FALTER
»Ein äußerst lebensbejahendes Buch über die Tabuthemen Tod und Sterben. «
Carolin Burchardt, REDAKTIONSNETZWERK DEUTSCHLAND
»Lewina erkundet eine Erfahrung, die uns alle betrifft, Sterblichkeit und Verlust. «
FREUNDE DER ZEIT
»[Dieses Buch] bleibt trotz (oder wegen) der persönlichen Tiefe weit entfernt von jeder Rührseligkeit. Dass [das Buch] so tröstlich und warm sein kann, hat mich unendlich berührt. «
Maria Christina Piwowarski, MCP NEWSLETTER
»Ihre offene und ehrliche Art, über die tiefe Trauer und Glück zur gleichen Zeit zu sprechen, ist beeindruckend. «
Konstantin Sacher, ÜBER DAS ENDE - CHRISMON PODCAST
»Eine bewegende und lebensbejahende Lektüre, die sich ernsthaft aber leichtfüßig dem Sterben und dem Tod widmet. «
Carolin Oberheide, BESTATTUNG - DAS BRANCHENMAGAZIN
»In ihrer lebendigen [. . .] Sprache nimmt [Katja Lewina] die Lesenden mit auf eine Reise tief in eigene Glaubenssätze zum Thema Leben, Sterben und Tod. Ich kann nur eines sagen: unbedingt lesen! «
Susanne Steppat, HEBAMMENFORUM
Daniel Schreiber
»Weise Worte«
Stella Brikey, EMOTION
»Sehr große Buchempfehlung«
Mirella Precek, MIRELLATIVEGAL
»[Das Buch] ist ein Plädoyer für eine radikale Akzeptanz der Endlichkeit. «
Matthias Kalle, TAZ
»Zeit ist kostbar, diese 144 Seiten erinnern uns daran. «
Christina Vettorazzi, FALTER
»Ein äußerst lebensbejahendes Buch über die Tabuthemen Tod und Sterben. «
Carolin Burchardt, REDAKTIONSNETZWERK DEUTSCHLAND
»Lewina erkundet eine Erfahrung, die uns alle betrifft, Sterblichkeit und Verlust. «
FREUNDE DER ZEIT
»[Dieses Buch] bleibt trotz (oder wegen) der persönlichen Tiefe weit entfernt von jeder Rührseligkeit. Dass [das Buch] so tröstlich und warm sein kann, hat mich unendlich berührt. «
Maria Christina Piwowarski, MCP NEWSLETTER
»Ihre offene und ehrliche Art, über die tiefe Trauer und Glück zur gleichen Zeit zu sprechen, ist beeindruckend. «
Konstantin Sacher, ÜBER DAS ENDE - CHRISMON PODCAST
»Eine bewegende und lebensbejahende Lektüre, die sich ernsthaft aber leichtfüßig dem Sterben und dem Tod widmet. «
Carolin Oberheide, BESTATTUNG - DAS BRANCHENMAGAZIN
»In ihrer lebendigen [. . .] Sprache nimmt [Katja Lewina] die Lesenden mit auf eine Reise tief in eigene Glaubenssätze zum Thema Leben, Sterben und Tod. Ich kann nur eines sagen: unbedingt lesen! «
Susanne Steppat, HEBAMMENFORUM
 Besprechung vom 11.01.2025
Besprechung vom 11.01.2025
Radikale Akzeptanz
Bloß keine Ratschläge: Katja Lewina denkt über den Tod nach
Dass der Tod nur die anderen trifft, ist eine beliebte Spielart magischen Denkens. So hält man die eigene Sterblichkeit zumindest auf Abstand. Diese Flucht in die Illusion funktioniert umso besser, je weniger man mit dem Tod konfrontiert wird. Die 1984 in Moskau geborene Autorin Katja Lewina aber kann sich nicht in Wunschwelten abschotten, denn sie lebt täglich mit ihrem kranken Herzen und dem Wissen, dass ihr Leben im nächsten Augenblick vorbei sein kann.
Den drohenden plötzlichen Herztod soll ein implantierter Defibrillator (der durchaus auch mal aussetzen kann) abwenden. Wie dünn ihr Lebensfaden ist, hat Katja Lewina jedoch erst erfahren, nachdem ihr Sohn Edgar gestorben war, unerwartet, im Alter von sieben Jahren. Gerade noch flitzte er durch die Wohnung, und dann war er tot. "Einfach so", schreibt Katja Lewina in "Was ist schon für immer".
Man kann dieses Buch über das Leben und den Tod auch als Versuch lesen, dem doppelten Schicksalsschlag durch das Erzählen seine niederdrückende Kraft zu nehmen. Katja Lewina weiß um die Abwehrmechanismen, die beim Thema Tod aktiviert werden: "Der Tod an sich ist ja schon ein unbegreifliches Monstrum. Aber der Tod eines Kindes? Ich kann da jeden emotionalen Fluchtreflex verstehen. Und deshalb will ich Sie auch gar nicht so irre lang mit diesem schicksalhaften Winter behelligen." Aber der Leser soll wissen, woher ihr Interesse "an diesem crazy little thing called Sterben kommt".
Katja Lewina schreibt feinfühlig, ohne ins Klischeehafte zu kippen, bisweilen flapsig, ohne abgeklärt zu wirken, liebevoll, ohne kitschig zu sein. Keine selbstmitleidige Zeile. Hier spricht eine Frau, die zu viel Schreckliches erlebt hat, um sich weiterhin mit "bullshit" herumzuschlagen. Anders formuliert: Warum sich das Leben dort unnötig schwer machen, wo es einfacher ginge? Kalenderspruch? Keineswegs. Ein Blick auf die Verstrickungen des Alltags genügt, um zu erkennen, wie oft man aus Nichtigkeiten Probleme konstruiert.
Was ihre "durch und durch miese" Herzkrankheit betreffe, so Lewina, würde sie sich zu der kühnen Behauptung hinreißen lassen, dass sie ihr eine Lebensqualität beschert habe, von der sie nie zu träumen wagte. Sie betrachte ihr Leben durch eine Art Filter und stelle sich stets die Frage: Was ist wirklich wichtig? Ihre beiden Töchter seien es, weitere Herzensmenschen, Freunde, Familie. Außerdem Ehrlichkeit statt Spielchen, Konflikte auszufechten - und für die eigenen Bedürfnisse einzustehen.
Lewina verharrt nicht bei ihrer eigenen Geschichte, sie weitet den Blick, betrachtet den Umgang von Freunden und Bekannten mit dem Tod, der bei all seiner Schrecklichkeit sogar als "schön" erlebt werden könne. Sie zitiert Philosophen, Wissenschaftler und Literaten - Seneca, Epikur, Montaigne, Freud, Joan Didion. Als eine Freundin die Mutter über deren nahenden Tod im Unklaren lässt, fragt sie, ob die Wahrheit dem Todgeweihten verschwiegen werden dürfe. Ratschläge erteilt sie nie, was der Leser aus Sätzen wie diesem macht, bleibt ihm überlassen: "Gegen unsere Vergänglichkeit ankämpfen bedeutet gegen das Leben ankämpfen. Alles, was dabei herauskommen kann, ist Unglücklichsein."
Und Edgar, Katja Lewinas toter Sohn? Sie hält ihn im Familienalltag präsent, am Kleiderhaken im Flur hängt seine Jacke, auf seinem Platz am Tisch brennt eine Kerze, und im Küchenschrank steht seine T-Rex-Trinkflasche. "Unser totes (Geschwister-)Kind ist für uns inzwischen ebenso selbstverständlich wie unsere anderen, lebenden (Geschwister-)Kinder." Die radikale Akzeptanz, so Lewina, habe die Familie gerettet.
Eine Zeit lang erinnerte Katja Lewina täglich eine App mit den Worten "Don't forget, you're going to die" an ihre Sterblichkeit, doch bald ging ihr dieser Satz auf die Nerven. Noch sei sie schließlich hier und quicklebendig. Noch ruft das Leben und will gefeiert werden - ohne den Tod beiseitezuschieben. MELANIE MÜHL
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 03.03.2025
¿Wenn ich eins gelernt habe aus alldem, dann das: Wir haben wirklich gar nichts in der Hand. Weder unsere Gesundheit noch die unserer Lieben, weder unser Leben noch unseren Tod. Alles, was uns bleibt, ist, uns an dem zu freuen, was wir in diesem Moment haben. Denn es kann jederzeit vorbei sein.' (Seite 16)Katja Lewina hat eine lebensbedrohliche Herzerkrankung und sich deshalb mit dem Thema Tod beschäftigt bzw. beschäftigen MÜSSEN. Wenige Monate vor ihrer eigenen Diagnose, die alles verändert, war ihr siebenjähriger Sohn Edgar plötzlich gestorben.Lewina spricht in ihrem Buch von dem Einstehen für sich, von der Kommunikation von Gefühlen und Bedürfnissen, von Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und anderen, von Vergebung und Reue, vom Sinn des Lebens, von Testament und Patientenverfügung, von Altern, Religion, Organspende und von Suizid.Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das Buch einen nicht runterzieht. Das tut es. Aber ich finde die Beschäftigung mit dem Thema Tod und Sterben wichtig, obgleich extrem unangenehm.Lewina erzählt sehr einfühlsam, sehr ehrlich und offen vom Tod, vom Sterben, von ihren Gedanken und Gefühlen. Ich empfand das Buch als extrem berührend, als eindringlich erzählt und als etwas, das zum Nachdenken anregt.Ein kluges Buch, das ich jedem empfehle. Denn dieses Thema geht uns alle an.¿Wir waren hier. Und das allein ist genug.' (Seite 72)
LovelyBooks-Bewertung am 21.02.2025
Kurz nach dem Tod ihres siebenjährigen Sohnes vor zwei Jahren wird bei Katja Lewina eine erblich bedingte, tödliche Herzerkrankung festgestellt, infolgedessen bekam sie einen Defibrillator implantiert und musste ihr Leben radikal umstellen. Statt Achterbahnen und Alkohol gibt es nun gemütliche Abende auf der Couch, Kräutertee - und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod.In ihrem Buch "Was ist schon für immer: Vom Leben mit der Endlichkeit" bringt sie diese Auseinandersetzung in elf Essays auf den Punkt. Von der Frage nach dem, was von uns bleiben soll über das Sprechen mit Kindern über den Tod bis zu den Dingen, die man vor dem eigenen Ableben geklärt haben sollte bespricht sie in lockerem und humorvollem Ton mit den Leser*innen all ihre Gedanken zum Sterben - und ich habe jeden dieser Gedanken gebraucht und geliebt. Seit mein Onkel kurz nach Weihnachten 2023 viel zu früh gestorben ist, setze ich mich intensiv mit dem Thema Tod auseinander - sowohl mit dem eigenen, als auch mit dem geliebter Personen. Das ist nicht immer angenehm, vor allem weil das Sterben immernoch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist. Gerade Bücher wie die Essaysammlung von Katja Lewina tun mir da einfach gut. Deshalb danke ich der Autorin sehr, dass sie ihre Geschichte mit uns Lesenden teilt - und uns zeigt, wie lebensbejahend die Beschäftigung mit dem Tod sein kann!









