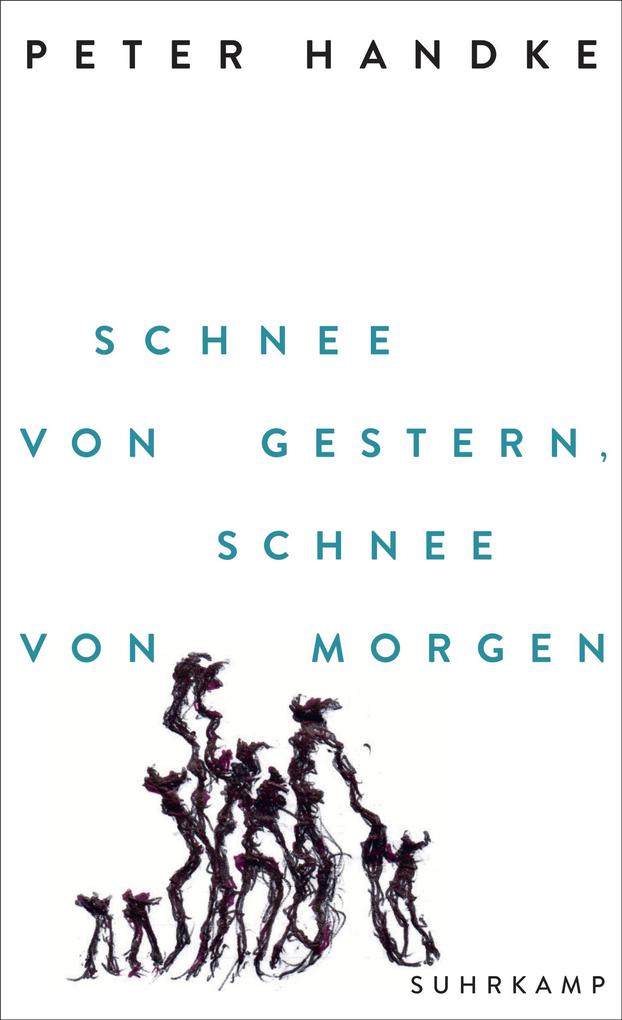
Sofort lieferbar (Download)
Ein Stück für die Bühne, ein Drama ohne Rednerwechsel, ein Lied ohne Kehrvers
Im Gehen trägt er zusammen, was ihm begegnet, Tag für Tag, Schritt für Schritt: zwei Raben zu seinen Füßen, ein angebissener Apfel am Wegrand, der Fliegenschwarm, »der auf der Stelle fliegt«. Dazwischen Gedanken an den durch Weltgeschehen und -geschichte irrenden Odysseus, Erinnerungen an die Schlange am Kindswaldrand, der Klang der Regentropfen im Laub, das Bild der Wolkenschatten. Dann das »Lachen von Kindern am Horizont«, ihr ausgelassenes Spiel, das den Krach am Straßenrand übertönt. Dort findet er den Frieden, den es nicht gibt, »im Mundschwung des Kindes, dort herrscht er«. Bis der eine, der da unentwegt spricht, aufbricht und ein anderer kommentiert: »Angeblich soll er vor einiger Zeit noch gesehen worden sein, als letzter Fahrgast hinten zusammengekauert im allerletzten Nachtbus. «
Schnee von gestern, Schnee von morgen ist ein Stück für die Bühne, ein Drama ohne Rednerwechsel, ein Lied ohne Kehrvers. Als ob Peter Handkes Figur sprechend und singend versucht, sich in die Stille einzuhören, also zugleich wegzuhören, Welt und Welterfahrung gerecht zu werden. Der Sprecher fällt sich selbst ins Wort, setzt neu an, und er sammelt nicht nur auf, was ihm im Gehen begegnet, sondern folgt auch den »Nachbildern bei geschlossenen Augen«.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
13. Januar 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
74
Dateigröße
1,23 MB
Autor/Autorin
Peter Handke
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783518782088
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Schnee von gestern, Schnee von morgen legt als Titel die hintersinnige Fährte in den 74-seitigen Text, der für Prosa eigentlich unmöglich keinen einzigen schwachen, überzähligen Satz enthält und beglückenderweise nichts mit dem poetisch Armseligen zu tun hat, was ansonsten oft unter literarischer Prosa firmiert. « Friederike Gösweiner, Die Presse, Wien
»[Eine] radikal entschlackte Kunst, zugeschnitten auf die Wirkung der Stimme, befreit von Tand und Flitter, erleichert um Erlerntes und Methode. . . . Ein zärtlicher Nachruf auf einen ewigen Spaziergänger, vielleicht sogar auf sich selbst . . . « Arno Frank, DER SPIEGEL
»Handke ist ein Virtuose der Sprache und der Reflexion, des Spiels mit beiden; ein Dichter, der die Möglichkeiten auslotet, sich auszudrücken, in fein formulierten Bildern und vermeintlichen Wahrheiten, die im nächsten Moment schon wieder angezweifelt werden. « Gerd Schumann, junge Welt
»Originäre Handke-Literatur zum Lesen, zum Erspüren und Ausdeuten, zum Nachsinnen, zudem ein Stück für die Bühne. In diesen literarischen Kristallen des Altmeisters gibt es viel zu entdecken. « Michael Ernst, SAX Literatur
»[Handke] tanzt mit der Sprache, er lässt seinen Assoziationen die Zügel schießen. « Andreas Kilb, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Beim Lesen empfinde ich mich ungemein stärker und offener, als ich es gewöhnlich bin. . . . Eine Ahnung von Leichtigkeit, jener größten Radikalität, die sich denken lässt. « Hans-Dieter Schütt, neues deutschland
»Ein kleines, kluges Buch. « Roland Gutsch, Prog & Prosa, Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern
»[Schnee von morgen, Schnee von gestern gliedert] sich perfekt in das Spätwerk des großen Autors ein. « ORF
»[Eine] radikal entschlackte Kunst, zugeschnitten auf die Wirkung der Stimme, befreit von Tand und Flitter, erleichert um Erlerntes und Methode. . . . Ein zärtlicher Nachruf auf einen ewigen Spaziergänger, vielleicht sogar auf sich selbst . . . « Arno Frank, DER SPIEGEL
»Handke ist ein Virtuose der Sprache und der Reflexion, des Spiels mit beiden; ein Dichter, der die Möglichkeiten auslotet, sich auszudrücken, in fein formulierten Bildern und vermeintlichen Wahrheiten, die im nächsten Moment schon wieder angezweifelt werden. « Gerd Schumann, junge Welt
»Originäre Handke-Literatur zum Lesen, zum Erspüren und Ausdeuten, zum Nachsinnen, zudem ein Stück für die Bühne. In diesen literarischen Kristallen des Altmeisters gibt es viel zu entdecken. « Michael Ernst, SAX Literatur
»[Handke] tanzt mit der Sprache, er lässt seinen Assoziationen die Zügel schießen. « Andreas Kilb, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Beim Lesen empfinde ich mich ungemein stärker und offener, als ich es gewöhnlich bin. . . . Eine Ahnung von Leichtigkeit, jener größten Radikalität, die sich denken lässt. « Hans-Dieter Schütt, neues deutschland
»Ein kleines, kluges Buch. « Roland Gutsch, Prog & Prosa, Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern
»[Schnee von morgen, Schnee von gestern gliedert] sich perfekt in das Spätwerk des großen Autors ein. « ORF
 Besprechung vom 13.02.2025
Besprechung vom 13.02.2025
Odyssee in einer Schneekugel
Gezielter literarischer Kontrollverlust: Peter Handkes Prosaband "Schnee von gestern, Schnee von morgen" nimmt das Verschwinden in den Blick.
Wer den Dichter im September in Berlin bei der Vorstellung der Online-Edition seiner frühen Notizhefte erlebt hat, wird vom Ton, den dieser Band anschlägt, nicht überrascht sein. Denn dort, im Haus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, wirkte Peter Handke so tiefenentspannt, wie man ihn selten erlebt hat. Er saß auf der Bühne, als hätte er nie ein Problem mit der Öffentlichkeit gehabt - etwa nach seinen Äußerungen zum Jugoslawienkrieg -, und staunte: über die Freundlichkeit des Publikums, über die liebevolle Betreuung durch seine Frau Sophie Semin und vor allem über sich selbst. Was er einst geschrieben hatte, schien dem Zweiundachtzigjährigen weit entrückt und auch vertraut; "dieser seltsame Enthusiasmus, alles zu erleben", war ihm geblieben. Gerührt und altersmilde blickte er aus weiter Ferne und zugleich größter Nähe zurück auf sein Leben.
So auch in "Schnee von gestern, Schnee von morgen". Ein Buch möchte man das schmale Bändchen nicht nennen, auch wenn es der Verlag durch Großdruck und Taschenformat auf gut siebzig Seiten aufgeblasen hat. Aber auch eine Notizensammlung wie die vor drei Jahren erschienenen "Inneren Dialoge an den Rändern" ist es nicht, dafür wirkt seine Prosa zu kompakt und konzentriert. Man könnte es eine Selbstbefragung nennen: Ein Ich hält sich den Spiegel vor. Aber es schaut, typisch für Handke, nicht direkt hinein, sondern aus dem Augenwinkel. So mischt sich seine Wahrnehmung des eigenen Ausdrucks mit den Eindrücken der Welt.
Gleich auf der ersten Seite schickt sich der Autor selbst in die Küche, wo er "dein Sollen erzählen" will, "dein Gesolltes": die Pflicht seines Dichtertums. Aber auf dem Weg dorthin fällt ihm sein Tageshoroskop ein ("Sie haben sich heute verirrt auf dem Mond"), ein Ausruf des Kaisers Augustus (in dem er "Varus, Varus" durch "Elvis, Elvis" ersetzt), ein Nonsensspruch aus der Steiermark ("Ante pante populore") und sein "Nachtgebet" von gestern: "Nachtschwarz, umschwärze mich!" Derart abgelenkt, kommt er nie an dem Ort an, wo die Geschichten ausgekocht werden, sondern irrt immer weiter durch die Erinnerungslandschaft des eigenen Ichs. Von dieser Irrfahrt, die einer Odyssee in der Schneekugel gleicht, handelt das Buch.
Jene Leser, die mit Handke schon viele Male durch seine Ich-Landschaften gewandert sind, werden in "Schnee von gestern, Schnee von morgen" reichlich Altbekanntes finden - und zugleich etwas Neues: einen neuen Ton, einen anderen Rhythmus. Denn Handke, der seit seinem Literaturnobelpreis vor sechs Jahren keinen irdischen Ruhm mehr erringen muss, ist nicht etwa dabei, sich in sein eigenes Denkmal zu verwandeln, im Gegenteil: Er tut alles, um nicht zum Klassiker zu erstarren. Er tanzt mit der Sprache, er lässt seinen Assoziationen die Zügel schießen. Er reiht Filmtitel, Sprichwörter, Theatersätze und Werbesprüche aneinander. Und er pfeift darauf, ob die Monologe, die so entstehen, einen diskursiven Sinn ergeben.
Das Risiko dieses Verfahrens liegt, wie oft bei Handke, in der Belanglosigkeit: Sätze wie "ah, du liebes Bißchen, wo bleibst du nur, wo steckst du nur" hätte das Lektorat bei einem Debütanten gestrichen. Der Gewinn des gezielten literarischen Kontrollverlusts lässt sich schwerer beziffern. Man muss die Wortkaskaden des Bändchens ein zweites Mal an sich vorbeirauschen lassen, um die Melodie herauszuhören, die unter ihnen verborgen liegt. Es ist der Gesang des Abschieds. Der hier spricht, stellt sich nicht nur die gewohnten Fragen zur Person ("Der Menschenfreund als Amokläufer: Bin das etwa ich?"), kämpft die gewohnten Kämpfe gegen seinesgleichen ("Der Krieg von uns Unheilbaren gegen euch Ausgeheilte") und erteilt sich die gewohnten Ermahnungen ("Nie wieder Ausschau halten nach Bundesgenossen"), er nimmt auch wie sonst nie sein eigenes Verschwinden in den Blick.
Auf den letzten beiden Seiten des Buchs sieht er sich selbst als letzten Fahrgast "im allerletzten Nachtbus", dann als Kreisgänger, der "einen angebissenen Apfel" zum Himmel reckt, "als trage er da eine olympische Flamme", und schließlich als "einen Schemen ein ums andere Mal quer über die Steppe stolpern", bis die Gestalt außer Sicht gerät. Und schon bei früherer Gelegenheit hat er einen Jubelton angestimmt, den der an verbale Ekstasen gewöhnte Handke-Leser bei diesem Autor noch nicht gehört hat: "Welch ein Glück in diesem deinem Leben, und was für ein Glück erst wird dich erwarten im nächsten!" Es ist, als wäre Handke tatsächlich versöhnt mit den Dämonen seines Schreibens - oder als stimmte er wenigstens seine Prosa schon einmal vorsorglich auf den Klang der erhofften Versöhnung ein.
Bis dahin aber hat der Dichter noch etwas vor: "Hinein ins Getümmel, hinein ins Chaos, hinein in die panische Welt" und dann "frisch wieder dorthinaus". Das ist sein künstlerischer Antrieb seit vielen Jahrzehnten - und "mir bis zum heutigen Tag noch keinmal so recht gelungen". Solange dieses Weltverschmelzungsprojekt noch nicht beendet ist, dürfen wie auf weitere Bücher von Peter Handke hoffen. Sein Blick geht schon zum Himmel, aber er ist immer noch unterwegs. ANDREAS KILB
Peter Handke:
"Schnee von gestern, Schnee von morgen".
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2025.
74 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








