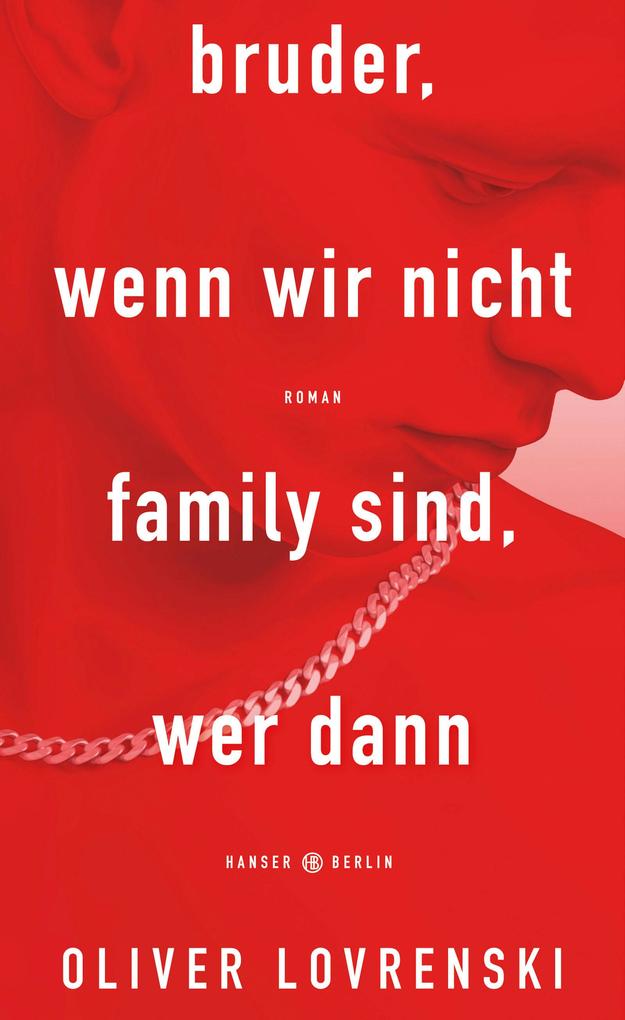
Sofort lieferbar (Download)
»Lovrenski zu lesen ist, als belausche man einen Fremden bei seiner nächtlichen Beichte - ein zartes, brutales, wahres Buch. « Tijan Sila
Sie sind jung, voller Ängste, Pillen und Hoffnung. Ihre Eltern leben in der Peripherie, Polizei und Jugendamt sitzen ihnen im Nacken, die Schule ist ein Angebot, das sie dankend ausschlagen. Ivor, Marco, Jonas und Arjan sind rastlos, zwischen den schicken Bars und hyggeligen Cafés Oslos gibt es keinen Platz für sie. Also treiben sie sich auf den Straßen, in improvisierten Gyms und einem maroden Einkaufszentrum herum und geraten Tag für Tag, line für line tiefer in eine Welt des Rauschs, der Gewalt und Kriminalität. Die Liebe zueinander macht sie unbesiegbar - bis einer von ihnen zu weit geht und ihre unheile Welt vollends zerbricht. Oliver Lovrenski, der zwanzigjährige Sensationsautor aus Norwegen, zieht uns hinein in eine atemlose, brutale Jugend und offenbart Zärtlichkeit, wo niemand sie erwartet.
Sie sind jung, voller Ängste, Pillen und Hoffnung. Ihre Eltern leben in der Peripherie, Polizei und Jugendamt sitzen ihnen im Nacken, die Schule ist ein Angebot, das sie dankend ausschlagen. Ivor, Marco, Jonas und Arjan sind rastlos, zwischen den schicken Bars und hyggeligen Cafés Oslos gibt es keinen Platz für sie. Also treiben sie sich auf den Straßen, in improvisierten Gyms und einem maroden Einkaufszentrum herum und geraten Tag für Tag, line für line tiefer in eine Welt des Rauschs, der Gewalt und Kriminalität. Die Liebe zueinander macht sie unbesiegbar - bis einer von ihnen zu weit geht und ihre unheile Welt vollends zerbricht. Oliver Lovrenski, der zwanzigjährige Sensationsautor aus Norwegen, zieht uns hinein in eine atemlose, brutale Jugend und offenbart Zärtlichkeit, wo niemand sie erwartet.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
18. Februar 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
256
Dateigröße
1,99 MB
Autor/Autorin
Oliver Lovrenski
Übersetzung
Karoline Hippe
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
norwegisch
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783446284050
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Oliver Lovrenski schreibt eindringlich, lässig und lyrisch zugleich; ohne unnötige Erklärungen oder Groß- und Kleinschreibung, ehrlich und meist mit Pointe Die glaubwürdige Sprache verleiht der Erzählung ihre unmittelbare Kraft. Deborah von Wartburg, Kulturtipp, Februar 2025
Lovrenski gelingt ein beeindruckendes Debüt, das nach seinem beispiellosen Erfolg in Norwegen nun weltweit übersetzt wird. Der junge Autor wird auch auf der Leipziger Buchmesse Stargast sein. Wer bereit ist, sich auch den unkonventionellen Stil einzulassen, wird mit einem intensiven und nachhallenden Leseerlebnis belohnt. Alexandra Höfle, Buchkultur, Februar 2025
Lovrenski gelingt ein beeindruckendes Debüt, das nach seinem beispiellosen Erfolg in Norwegen nun weltweit übersetzt wird. Der junge Autor wird auch auf der Leipziger Buchmesse Stargast sein. Wer bereit ist, sich auch den unkonventionellen Stil einzulassen, wird mit einem intensiven und nachhallenden Leseerlebnis belohnt. Alexandra Höfle, Buchkultur, Februar 2025
 Besprechung vom 23.03.2025
Besprechung vom 23.03.2025
Hinterhof-Jargon aus Oslo
Viel mehr als bloß ein Roman über eine harte Jugend: Oliver Lovrenskis Debüt setzt auf Punchlines und Straßen-Esperanto. Von Louis Pienkowski
Mittags Drogen ballern, abends die Reste verticken und nachts plötzlich die "feels kriegen" - das ist der Alltag in Oliver Lovrenskis Debüt "bruder, wenn wir nicht family sind, wer dann". Der Roman des damals 19-Jährigen gewann 2023 den Preis der norwegischen Buchhändler, jetzt erscheint er bei Hanser Berlin auf Deutsch vor. Lovrenski erzählt darin von Ivor, der kroatische und polnische Wurzeln hat, dem Somalier Marco, dem indischstämmigen Arjan und der "kartoffel" Jonas. Aus 13-jährigen Schulschwänzern werden suchtkranke Dealer, die sich mit 14 Messer besorgen, dann Pistolen. Der Plot klingt nach gesellschaftskritischer Aufklärungsprosa, was aus jungen Männern am Rande der Gesellschaft werden kann. Doch darin steckt mehr: Lovrenski verzahnt Gangster-Klischees gekonnt mit männlicher Sensibilität. Sprachliche Spitzen durchbrechen den Hinterhofjargon in Ivors Bewusstseinsstrom.
Die vier flüchten sich aus ihren kaputten Familien in ihren Männerbund, Gewaltexzessen stehen zärtliche Passagen gegenüber, selbst Stichwunden und Suizidgedanken lachen sie gemeinsam weg. Wer beim Lesen über die plumpe Frauenverachtung hinwegsehen kann, lacht dabei mit. Lovrenski schreibt Popliteratur. Keine, die durch Verweise auf Musik, Marken oder Social Media besticht, obwohl all das vorkommt, sondern durch Leichtigkeit. Pop, genau genommen Hip-Hop, steckt hier in der Form: den schnellen Wechseln zwischen Straight Lines und Punchlines und im Sound.
Die Übersetzerin Karoline Hippe hat den Sprachenmix exzellent ins Deutsche übertragen. Ihn zu lesen, macht großen Spaß. Amerikanische und arabische Idiome treffen auf kroatische Weisheiten und somalischen Slang. Einiges davon wird im Glossar übersetzt. Wie etwa "tishare", somalisch für "Wichser". So heißen andere Drogendealer oder zahlungsunwillige Kunden, welche die Gruppe "klatschen" geht. Spätestens durch eigene Begriffe der vier, wie "candy flip" - eine Kombination bestimmter Drogen - betritt man dann aber eine Welt neuer Zeichen.
Kommt der Autor selbst aus einer solchen Welt? Lovrenski, Jahrgang 2003 und stark tätowiert, wirkt wie eine Idealbesetzung für Straßen-Autofiktion. Wie Ivor, die Hauptfigur seines Buchs, wuchs er als Sohn einer Kroatin in Oslo auf, aber anders als sein Protagonist nicht in der migrantisch geprägten Peripherie, sondern im schicken Westend Oslos und mit seinem Vater, dem Schriftsteller Håvard Rem. Vielleicht ähnelt Lovrenski eher seinen Lesern aus der Mittel- und Oberschicht, die sich fragen, wie sich eine so brutale Jugend anfühlen könnte.
Die Frage der Street-Credibility des Autors tritt sowieso hinter der Form der Erzählung zurück, mit der Lovrenski Neuland betritt. Sein Werk besteht aus rund zweihundert Fragmenten, die er nach eigenen Angaben überwiegend auf seinem Smartphone geschrieben hat. Sie erinnern an Social-Media-Posts oder Rap-Songs. Mal sind sie nur einen Satz lang, mal eine ganze Seite und scheinen wie gemacht für die kurze Aufmerksamkeitsspanne der Generation Tiktok. Die Fragmente kommen ohne Punkte und Großbuchstaben aus. Dafür hat jede von ihnen einen Titel, wie "polo", "junge dumme liebe" oder "pretty fly". Bilden sie einen Roman?
Ja, denn Lovrenski erzählt, wie aus den vier Schulfreunden Erwachsene werden. Gleich der erste Satz nimmt den Tod einer der Figuren vorweg. Zwischendurch geht es zurück in die Kindheit der Jungs. Als Ivor seine geliebte "baba" (Großmutter) verliert, verwirft er seinen Traum, Profiboxer zu werden, und später die Idee, es als Anwalt zu Reichtum zu bringen. Eine der schönsten Geschichten schildert, wie er und Marco durch gemeinsames Stören des Schulunterrichts zu Brüdern werden. Marco heißt eigentlich Liban und ist mit seinen Stimmungsschwankungen der Star des Buchs. Die zwei erinnern an das Rap-Duo Celo & Abdi. Auf Alben wie "Mietwagen Tape" oder "Hinterhofjargon" mischten sie in ihren Hymnen auf die Frankfurter Drogenszene bosnischen und marokkanischen Slang.
Ivor und Marco stellt Lovrenski Arjan zur Seite, der vermutlich schwul ist und mit einer suchtkranken Mutter aufwächst. Dann ist da noch Jonas. Der stotternde Norweger muss die Schläge seines Vaters und den Spott seiner drei Freunde einstecken. Die vier lassen Schule, Sportverein und Sozialarbeiter links liegen, ziehen lieber Handys von Jugendlichen im Park ab oder verticken Koks via Snapchat. Die Chance auf "para" (Arabisch: Geld) gibt den Takt vor. Lovrenski lässt seine Figuren wie in einer Sitcom auftreten. Während Jonas einen "macker" mit einer Machete bedroht, sagt er seiner Oma am Telefon: "Hab dich auch lieb".
Wie im Rap steht am Ende der meisten Miniaturen eine Punchline, eine Pointe, die den Sinn des zuvor Gesagten umkehrt oder andere beschimpft. In der Erzählung "lammkeule und alltagsrassismus" wird die Frage, was die vier essen wollen, zum "basically fettesten beef der menschheitsgeschichte", zum "krieg ums beste heimatland". Indisch, Somalisch, Kroatisch? Jonas fordert mit "seiner cuten Piepsstimme" beleidigt: "lammkeule ist n-nationalgericht ihr rassisten." Auch wenn sich der Überraschungseffekt dieses Aufbaus abnutzt, wiederholt er doch die Beziehungsdynamik der vier. Verzweiflung, Einsamkeit und Glück dürfen sie voreinander nur durch Jokes ausdrücken. Man muss nicht auf der Straße aufgewachsen sein, damit einem dieses Muster männlicher Freundschaft bekannt vorkommt.
Es ist eine Macho- und Gangsterwelt. Frauen treten nie als platonische Freundinnen auf, nur als besorgte Mütter, nette Großmütter und am häufigsten schlicht als "chayas" (Mädchen), die man aufreißen will. "Kapitalchayas" heißen reiche Mädchen: "wir sind auf einer party bei einer kapitalchaya in der villa ihrer eltern mit sauna und fettem garten, es ist winter, überall schnee im garten und den nasen." Marco tritt besonders misogyn auf, hat auf Partys mehrere "pillen danach" dabei, weil er Kondome hasst. Ivor behauptet, Romantiker zu sein, lässt seinen besten Freund aber gewähren.
Manchmal buchstabiert Lovrenski Deutungen kitschig aus: "wir sagen muttern, dann müssen wir nicht mama sagen, muttern meckert... mama hat angst um mich." Die Studentin Ayla, in die sich Ivor verliebt, sagt: "was du erinnerungen nennst, sind traumata." Doch die Rap- Lines weichen einer einfühlsam-langweiligen Sozialpädagogik immer wieder aus wie die vier Jungs ihren Drogentests. Dennoch macht Lovrenski keinen Hehl daraus, dass diese auf liebenswürdige Weise vertrottelten Typen rücksichtslose Schläger sind. Sie wollen Täter, nicht Opfer sein: "du wirst hopsgenommen, oder bist der der hopsnimmt, fertig, khalas." Oliver Lovrenski formt aus Fetzen von Jugendsprache mal brutale, mal zärtliche Textminiaturen, verbunden durch eine verblüffend stimmige poetische Linie. Wenn man am Ende nicht mehr über Ivors Flachwitze lacht, blicken die drei übrig gebliebenen Jungs zurück auf die Scherben ihrer Jugend.
Oliver Lovrenski: "bruder, wenn wir nicht family sind, wer dann". Aus dem Norwegischen von Karoline Hippe. Hanser Berlin, 256 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 01.04.2025
Absolutes Highlight, klassischer Coming-of-age-Roman, gleichzeitig aber irgendwie auch kein Vergleich. Hätte noch ewig weiterlesen können.
LovelyBooks-Bewertung am 26.03.2025
Ein Buch wie der Swipe auf TikTok









