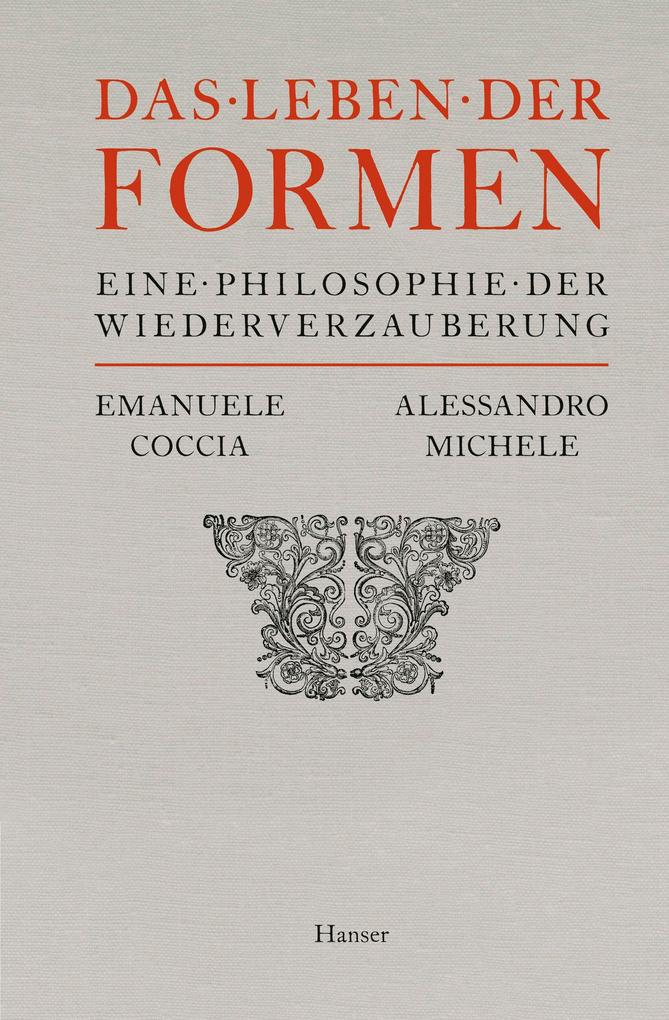
Sofort lieferbar (Download)
"Coccia und Michele besingen die Mode als intensivste Kunst einer verkörperten Freiheit." Barbara Vinken
Mode ist Philosophie. Star-Philosoph Emanuele Coccia und Mode-Ikone Alessandro Michele stellen traditionelle Annahmen über Kleidung auf den Kopf. Denn ein Outfit ist für sie viel mehr als ein Konsumgut: Es ist ein Kunstwerk, das jede:r von uns trägt. Alles, was lebt, gibt und entdeckt Formen. Diese philosophische Annahme verkörpert die Mode für sie und ist damit die radikalste unter den Kunstformen, denn sie findet jeden Tag auf der Straße statt. Die Vielfalt des Lebens, die Micheles Kreationen zeigen und die Coccias Philosophie feiert, bildet den Ausgangspunkt für einen radikal neuen Blick auf Kleidung, Identität und Freiheit. Die Freundschaft der beiden ist ein philosophischer Glücksfall.
Mode ist Philosophie. Star-Philosoph Emanuele Coccia und Mode-Ikone Alessandro Michele stellen traditionelle Annahmen über Kleidung auf den Kopf. Denn ein Outfit ist für sie viel mehr als ein Konsumgut: Es ist ein Kunstwerk, das jede:r von uns trägt. Alles, was lebt, gibt und entdeckt Formen. Diese philosophische Annahme verkörpert die Mode für sie und ist damit die radikalste unter den Kunstformen, denn sie findet jeden Tag auf der Straße statt. Die Vielfalt des Lebens, die Micheles Kreationen zeigen und die Coccias Philosophie feiert, bildet den Ausgangspunkt für einen radikal neuen Blick auf Kleidung, Identität und Freiheit. Die Freundschaft der beiden ist ein philosophischer Glücksfall.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
18. März 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
256
Dateigröße
3,71 MB
Autor/Autorin
Emanuele Coccia, Alessandro Michele
Übersetzung
Thomas Stauder
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
italienisch
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783446284333
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 23.03.2025
Besprechung vom 23.03.2025
Der Kopf ist auch nur eine Form
Zwei Koryphäen ihres Fachs, der Philosoph Emanuele Coccia und der Modeschöpfer Alessandro Michele, wollen mit ihrem gemeinsamen Buch Theorie und Praxis der Mode revolutionieren
Von Tania Martini
Dass Mode mehr ist als Kleidung und Konsum, hat sich mittlerweile weitgehend herumgesprochen. Eine Kultur- und Kunstform sei sie, heißt es oft, wenn der Vorwurf der Oberflächlichkeit gekontert werden soll. Oder dass sie den Zeitgeist zum Ausdruck bringe. Aber was heißt das eigentlich?
Das versucht die Modetheorie nicht erst seit gestern zu analysieren. Ob Balzac, Baudelaire oder Mallarmé (der sogar eine Modezeitschrift mit dem Titel "La dernière mode" herausgebracht hatte) - bereits seit dem 19. Jahrhundert beschäftigt Kleidung und Mode nicht nur Designer, sondern auch Denker und Denkerinnen. Und dennoch wissen zwar viele, dass der Soziologe Georg Simmel Geld und Urbanisierung in Zusammenhang mit sozialen Strukturen untersucht hat, aber noch immer wenige, dass er als einer der Begründer der Modetheorie gilt.
Dabei ist offenbar, dass Mode Gegenstand der Soziologie und auch der Philosophie sein kann, gar muss, und längst gibt es ganz unterschiedliche Untersuchungsansätze - soziologische, sozialpsychologische oder kulturwissenschaftliche etwa.
Es sollte also nicht überraschen, wenn ein Modemacher und ein Philosoph sich zusammentun, um über Mode nachzudenken. Wie nun geschehen. Emanuele Coccia, Philosoph an der Pariser École des Hautes Études en Sciences Sociales und bekannt geworden mit Büchern zur Philosophie der Natur, und Alessandro Michele, einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Designer der Gegenwart, der von 2002 bis 2022 der Marke Gucci außerordentlichen Erfolg bescherte und nun für Valentino arbeitet, haben ein gemeinsames Buch geschrieben. Ein Jahr nach dem Original liegt es nun auch auf Deutsch vor. "Das Leben der Formen. Eine Philosophie der Wiederverzauberung" ist der Titel. Und der ist Programm.
Mit Pathos und Hingabe gehen die beiden der Verzauberung durch Mode nach. Eine größere Feier der Mode hat es nie gegeben.
Coccia und Michele haben eine interessante Form für ihr Buch gefunden. Neben längeren philosophischen Texten von Coccia gibt es Texte von Michele, die, um das Dialogische zu betonen, aufgebaut sind wie die Manuskriptseiten des Talmuds: ein Haupttext, oft ein biographischer, wird an den Rändern von Kommentaren und Hinweisen Coccias ergänzt.
Doch was hat es mit dem "Leben der Formen" auf sich? Das ist einigermaßen kompliziert. Coccia treibt schon lange die Frage um, wie die Formen unsere Wahrnehmung prägen. Er möchte das verdrängte Sinnliche in die Philosophie zurückholen. "Wir können nur durch das Sinnliche leben", lautet einer seiner Grundsätze, mit dem er an den Grundpfeilern des modernen Rationalismus rüttelt.
Er knüpft an die antike Metaphysik an, geht aber darüber hinaus, weil er Formen als eine dynamische Kraft versteht, die die Welt gestaltet; das hat nichts mehr zu tun mit der traditionellen Trennung von Subjekt und Objekt. Am ehesten gibt es eine Nähe zur Netzwerktheorie Bruno Latours. Formen strukturieren Coccia zufolge Materielles wie auch Immaterielles. Auch biologische Lebensformen - Tiere, Pilze oder Pflanzen - sind Formen. "Jede Materie spricht, und deshalb leben alle Formen", erklärt er. Oder: "Wenn jede Form lebt, gibt es keinen Unterschied zwischen menschlichen Artefakten, Pflanzen und Tieren."
Es geht also darum, der Verbindung zwischen Form und Leben in der Mode nachspüren. Das ginge auch in anderen ästhetischen Kontexten, aber Coccia konzentriert sich auf die Mode, weil er in ihr "die radikalste Kunstform unseres Jahrhunderts" erkennen will. An dieser Stelle wird sein Konzept der Formen und des Lebens vielleicht erst verständlich. Die radikalste Kunstform sei die Mode nämlich in dem Sinn, dass sie die Forderung der künstlerischen Avantgarden verwirkliche, die Kunst und das Leben eins werden zu lassen, behaupten beide Autoren.
Das war vor allem das Programm der Situationistischen Internationalen um Guy Debord, die angesichts einer entfremdeten Kultur, so die Diagnose, die Wiederaneignung von Kunst als Aufhebung der Kunst forderte. Die Kunst sollte nicht mehr als getrennte Sphäre existieren, sondern stattdessen in der Konstruktion von Situationen im Alltag aufgehoben werden.
Es ist einigermaßen überraschend, dass diese subversive Praxis einer Avantgardebewegung bei einem der erfolgreichsten Designer eines der größten Konzerne auftaucht. Alessandro Michele möchte vielleicht nicht nur als einer der erfolgreichsten, sondern auch als einer der intellektuellsten Designer in die Geschichte eingehen, denn er zitiert nicht nur die Situationisten, sondern fährt ein ganzes Arsenal gegenkultureller Theoriestars auf - von Walter Benjamin über Roland Barthes bis Giorgio Agamben und Donna Haraway.
Das alles wirkt mitunter ziemlich eklektizistisch, so wie Micheles maximalistische Mode selbst. Menschen, die über den Minimalismus eines Martin Margiela, Yohji Yamamoto oder Rei Kawakubo in den Modediskurs eingestiegen sind, dürften mit seiner Mode, die überreich an Farben, Mustern und Details ist, ohnehin etwas fremdeln.
"Die Mode ist ein Mysterium", schreibt Michele, und in diesem Mysterium sind Kleidungsstücke Portale oder "Fluchtwege, die dem Körper die Befreiung aus Rollenzwängen und Identitätszuschreibungen ermöglichen". Selbsterfindung, Identitätsvervielfachung, Mehrdeutigkeit und sogar Freiheit, das alles suchen die beiden in der Mode, brechen aber radikal mit einer ganzen Tradition von Modetheorie, die Mode seit der Industrialisierung als Mittel zur sozialen Distinktion interpretiert hat.
Mode ist mit das einfachste Mittel, um Geschlechter, soziale Klassen, gesellschaftliche Stellungen oder Gruppenzugehörigkeiten auszuweisen. Mode war auch immer ein Mittel zur Politik: Der Schillerkragen brachte eine antiabsolutistische Haltung zum Ausdruck, dem Dandy war sein Stil Mittel zur Selbstbestimmung, die Suffragetten symbolisierten mit Hüten ihren Widerstand, die Punks schissen mit Outfit und Haltung auf das große Ganze.
Coccias Feststellung, dass, seitdem Coco Chanel und Yves Saint Laurent Frauen in typisch männliche Kleidung gesteckt hatten, die Geschlechtsidentität die Klassenidentität als Thema verdrängt hat, ist richtig. Aber Coccia und Michele gehen noch einen Schritt weiter. Weder Klasse noch Geschlecht interessiert sie. "Es geht nicht mehr darum, ein männliches Kleidungsstück mit einem weiblichen Körper zu kreuzen oder umgekehrt, sondern darum, Kleidung zu kreieren, die Binarität ablehnt und gleichzeitig männlich und weiblich ist." Mehrdeutigkeit ist das Zauberwort, und tatsächlich gelingt es Michele, die binären Grenzen auf dem Laufsteg zu verwischen. Paradigmatisch ist da der Einsatz der Lavallière, der Schleifenkrawatte, ein, man kann sagen, geschlechtlich umkämpftes Accessoire, das ursprünglich männlich, dann weiblich konnotiert war und bei Michele immer wieder auftaucht.
Die ständige Behauptung von Mehrdeutigkeit hat bei Michele jedoch auch auf dem Laufsteg einen ziemlich großen Überbau. In seinen Defilees stellt er kleine Welten her, in die das Publikum - auch immer mal wieder immersiv - einbezogen wird, oder er lässt die Models ein Abbild ihres Kopfes als Tasche tragen, um, ja, dann hat es auch der letzte kapiert, auf die Bearbeitung des Themas Identität hinzuweisen.
Das wirkt nicht unbedingt so, als wäre für Michele Mode nichts anderes als "der radikalste Ausdruck einer intimen Beziehung zwischen Form und Leben", wie im Buch mehrfach behauptet wird. Aber sogar diese Sichtweise, ganz zu schweigen von den Objekten, muss man sich leisten können. Wie losgelöst hier Mode von sozialen Strukturen, Gegenwart und Zeitgeist gedacht wird, zeigt auch Micheles Affinität zur Konstruktion einer Wahrheit, "die keiner Epoche mehr eindeutig zugeordnet werden kann". Tatsächlich gräbt er jedoch meist in der Vergangenheit, um Ideen für seine Silhouetten und nostalgisch anmutenden Details zu finden. Aber wer mag von sozialen Strukturen sprechen, wo der Mensch nicht mehr das Maß der Dinge ist: "Kleidung entwerfen zu können, entspricht also der Fähigkeit, die Stimmen der Tiere zu vernehmen und zu erkennen", heißt es im Buch. Und der Rest passiert dann ganz von allein?
Coccias und Micheles Überlegungen sind mit einem soziologischen Blick kaum vereinbar. Dennoch ist ihre Perspektive auf die Formen bedenkenswert. Wie auch ihr Versuch, der Dekonstruktion von Binaritäten und der Modetheorie als solcher eine völlig neue Volte zu verleihen, lesenswert ist.
Emanuele Coccia/Alessandro Michele, "Das Leben der Formen. Eine Philosophie der Wiederverzauberung". Aus dem Italienischen von Thomas Stauder. Hanser, 253 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Das Leben der Formen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









