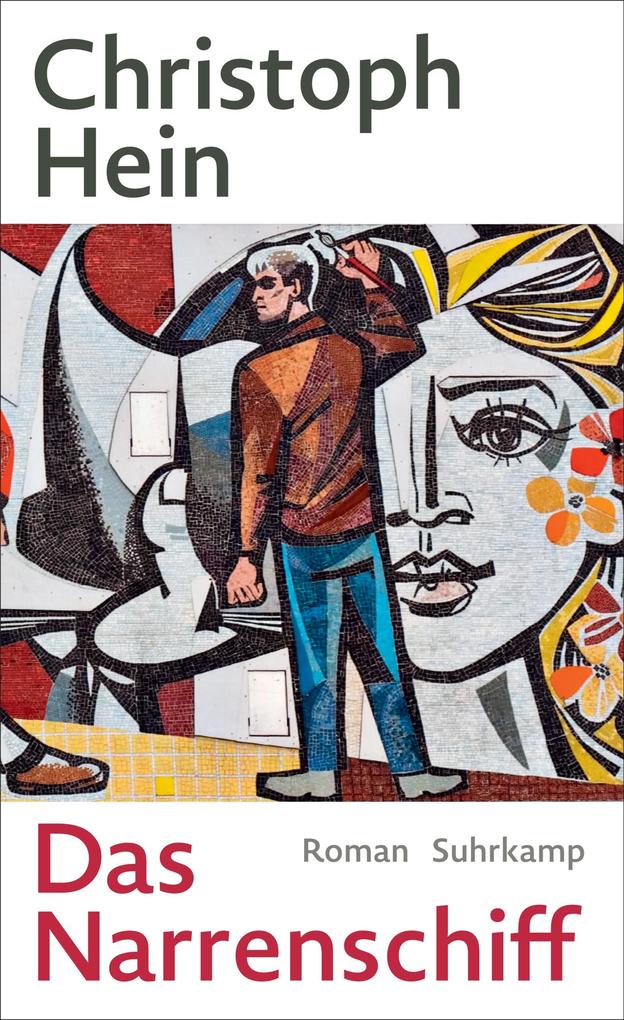
Sofort lieferbar (Download)
Ein Staat wird - wie alle Staaten - gegründet für alle Ewigkeit und verschwindet nach vierzig Jahren nahezu spurlos. Sind die Menschen, die dort einmal lebten, dem Vergessen anheimgefallen und ihre Träume nur ein kurzer Hauch im epochalen Wind der Zeitläufte?
In seinem fulminanten Gesellschaftsroman lässt Christoph Hein Frauen und Männer aufeinandertreffen, denen bei der Gründung der DDR unterschiedlichste Rollen zuteilwerden, begleitet sie durch die dramatischen Entwicklungen einer im Werden befindlichen Gesellschaft, die das bessere Deutschland zu repräsentieren vermeint und doch von einem Scheitern zum nächsten eilt.
Überzeugte Kommunisten, ehemals begeisterte Nazis, in Intrigen verstrickte Funktionäre, ihre Bürgerlichkeit in den Realsozialismus hinüberrettende Intellektuelle, Schuhverkäufer, Kellner, Fabrikarbeiter, Hausmeister und selbst ein hoher Stasi-Mann erkennen auf die eine oder andere Art ihre Zugehörigkeit zu einer unfreiwilligen Mannschaft an Bord eines Gemeinwesens, das sie zunehmend als Narrenschiff wahrnehmen und dessen Kurs auf immer bedrohlichere historische Klippen ausgerichtet ist.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
16. März 2025
Sprache
deutsch
Auflage
Originalausgabe
Seitenanzahl
600
Dateigröße
2,32 MB
Autor/Autorin
Christoph Hein
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783518782095
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Wer verstehen will, warum auch die Gutwilligen, auch die Funktionsträger scheiterten, die Deutsche Demokratische Republik zu einem Land zu machen, in dem man sich nach seinen Interessen und Fähigkeiten entfalten kann, das wirtschaftlich erfolgreich ist und in der Weltgemeinschaft seinen Platz hat, der kann jetzt diesen bestechenden Roman lesen. « Cornelia Geißler, Berliner Zeitung
»[Hein] erweist sich als der unbestechlichste Chronist [der DDR]. . . . Mit lakonischer . . . Sprache entwickelt Hein aus der Kraft der Ruhe sein Opus magnum eines Gesellschaftsromans. « Ulrich Steinmetzger, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Es bleibt dabei: Christoph Hein zu lesen, lohnt sich immer. « Welf Grombacher, Märkische Oderzeitung
»[Eine] spannend gefügte Galerie aus Schicksalen und Konflikten. . . . Hein umkreist die Kräfteverhältnisse [in der DDR] sorgsam, umsichtig kühl, mit intelligenter Vorsicht und Besonnenheit. « Hans-Dieter Schütt, neues deutschland
»[Es] gelingt Hein, die eigentliche Absurdität des Systems zu verdeutlichen. . . . Inhaltlich dicht ist dieser Roman, angefüllt mit unzähligen historischen Details. « Marlen Hobrack, WELT AM SONNTAG
»Christoph Hein erfüllt mit seinem neuen Roman Das Narrenschiff seinen Ruf als Chronist der deutschen Nachkriegsgeschichte mit großer Opulenz. « Erik Heier, Tip Berlin
». . . der Autor [vermittelt] so viele historische Details . . . , dass von ferne das Nachschlagewerk SBZ von A-Z winkt . . . Alle diese Informationen machen neben den feingesponnenen Dialogen die Fülle dieses außergewöhnlichen Logbuches aus. Auch dadurch, dass Zahlen und Daten im Text ausgeschrieben sind, bleibt die mitreißende Zeit-Prosa immer im Fluss. « Katrin Hillgruber, Der Tagesspiegel
»Christoph Hein hat einen starken Roman über das Leben der Angepassten und der Funktionäre in der DDR geschrieben. « Jana Hensel, DIE ZEIT
» ein fulminantes Werk mitreißend und erschütternd. « Roland Mischke, Aachener Zeitung
»[Hein] erweist sich als der unbestechlichste Chronist [der DDR]. . . . Mit lakonischer . . . Sprache entwickelt Hein aus der Kraft der Ruhe sein Opus magnum eines Gesellschaftsromans. « Ulrich Steinmetzger, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Es bleibt dabei: Christoph Hein zu lesen, lohnt sich immer. « Welf Grombacher, Märkische Oderzeitung
»[Eine] spannend gefügte Galerie aus Schicksalen und Konflikten. . . . Hein umkreist die Kräfteverhältnisse [in der DDR] sorgsam, umsichtig kühl, mit intelligenter Vorsicht und Besonnenheit. « Hans-Dieter Schütt, neues deutschland
»[Es] gelingt Hein, die eigentliche Absurdität des Systems zu verdeutlichen. . . . Inhaltlich dicht ist dieser Roman, angefüllt mit unzähligen historischen Details. « Marlen Hobrack, WELT AM SONNTAG
»Christoph Hein erfüllt mit seinem neuen Roman Das Narrenschiff seinen Ruf als Chronist der deutschen Nachkriegsgeschichte mit großer Opulenz. « Erik Heier, Tip Berlin
». . . der Autor [vermittelt] so viele historische Details . . . , dass von ferne das Nachschlagewerk SBZ von A-Z winkt . . . Alle diese Informationen machen neben den feingesponnenen Dialogen die Fülle dieses außergewöhnlichen Logbuches aus. Auch dadurch, dass Zahlen und Daten im Text ausgeschrieben sind, bleibt die mitreißende Zeit-Prosa immer im Fluss. « Katrin Hillgruber, Der Tagesspiegel
»Christoph Hein hat einen starken Roman über das Leben der Angepassten und der Funktionäre in der DDR geschrieben. « Jana Hensel, DIE ZEIT
» ein fulminantes Werk mitreißend und erschütternd. « Roland Mischke, Aachener Zeitung
 Besprechung vom 18.03.2025
Besprechung vom 18.03.2025
Vom Richtungsverlust
Unbestechlichster Chronist der DDR: Christoph Heins neuer Roman "Das Narrenschiff"
Sie wollen ein besseres Deutschland gestalten, nachdem sie aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt sind. Oder aus dem Exil. Oder aus der Umerziehung im Lager Workuta. Und sie haben ihre Überzeugungen, wie das gehen soll. Johannes Goretzka hat sein Bein und damit seinen Hurrapatriotismus verloren, um zum Parteisoldaten des Neuen zu werden: Vom glühenden Nationalsozialisten wandelt er sich zum Bewunderer Stalins. Er lernt bei Rudolf Herrnstadt vom Nationalkomitee Freies Deutschland. Dessen Leiter Arthur Pieck, der Sohn des späteren Präsidenten der DDR, macht ihn zu seinem persönlichen Referenten. Als sehr frühes SED-Mitglied und promovierter Techniker steigt Goretzka auf zum Abteilungsleiter im Ministerium für Schwermaschinenbau. Mit den Eltern im Bochumer Pfarrershaushalt hat er sich überworfen, denn seinen Idealen folgt er humorlos bis zum Starrsinn.
Goretzka lernt die alleinerziehende Yvonne kennen, die den achtzehn Jahre Älteren wegen des Nachkriegsmännermangels zum Mann nimmt, auch weil er ihr als sicherer Versorger erscheint. Liebe sieht anders aus. Selten hat man in einem Roman von einem hölzerneren Kennenlernen gelesen. Als Prinzipienreiter drängt er sie zu einer Parteikarriere, ohne auch nur entfernt zu ahnen, wie schnell er selbst in Ungnade fallen wird. Er hat eigene Vorstellungen vom Dienst an der Sache, das bringt ihn 1954 zu Fall. Dauerhaft und unverdient.
Der Ökonomieprofessor Karsten Emser ist beim Berliner Magistrat für das Wirtschaftsressort zuständig und wird Mitglied des Zentralkomitees der SED. Die Nazis hatten ihm 1935 seine Professur in Kassel genommen, später verlor er Frau und Kind ans Fleckfieber. Auch er heiratet eine deutlich jüngere Frau: Rita. Sie wird Yvonne Goretzkas Vorgesetzte, sexuelle Feldforschungen inklusive. Und wie Johannes Goretzka hat auch Karsten Emser zu manchem seine eigene Meinung. Nachdem er diese Mitte der Sechzigerjahre öffentlich vertreten hat, wird er zum großen Schweiger gemacht.
"Man darf nie gegen die Partei recht haben, denn sie allein hat immer recht." Das weiß auch Benaja Kuckuck. Er ist von diesen drei männlichen Protagonisten aus Christoph Heins Roman "Das Narrenschiff" der eloquenteste, ein kleiner Mann mit Glatze, der gern ein bisschen provoziert. Der Shakespeare-Experte hatte wegen seines jüdischen Vaters 1935 die Universität in Tübingen verlassen müssen, war ins Exil nach Frankreich und England gegangen und erfuhr viel Anerkennung und noch mehr Ablehnung, weil er früh in die Kommunistische Partei eintrat. In Ost und West ist er nach dem Krieg verdächtig, geht aber in die DDR, die ihn auf einem Abstellgleis des Kulturbetriebs parkt, weil in seinem Denken Klassenkampf stets in Richtung Klassenkrampf changiert. Damit jemand ein Auge auf ihn hat, wird Yvonne Goretzka seine Stellvertreterin. Des Lebensstandards wegen bleibt er der Sache treu - und auch weil er nicht auffallen will mit seiner Neigung zu Männern.
In regelmäßigen Abständen treffen sich diese drei ins Abseits geratenen Desillusionierten mit ihren Angehörigen zur Tafelrunde. Hier erklären sie einander sich und die Welt, wobei keiner ganz die Vorsicht vergisst in einem Land, in dem sich jeder vor jedem in Acht nimmt bis in den privatesten Winkel. Aus diesen Tischgesprächen und um sie herum lässt Christoph Hein mit vielfältigem Personal die Geschichte eines gewesenen Landes als großes Panoramabild erstehen.
Wenn in jüngster Vergangenheit die DDR immer wieder Gegenstand von teils fragwürdigen Romanen geworden ist, erweist sich Hein als deren unbestechlichster Chronist im Breitwandformat. Markante historische Zäsuren rückt er ins Bild: vom 17. Juni 1953 über Chruschtschows Geheimrede zur Entstalinisierung, den Mauerbau, das Kahlschlagplenum 1965, den Prager Frühling und den Gipfel der Machtspiele zwischen Honecker und Ulbricht bis hin zu den Hunderttausenden Demonstranten auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November 1989, wo Christoph Hein selbst eine Rede hielt, in der er den Begriff "Heldenstadt" für Leipzig vorschlug und warnte: "Die Kuh ist noch nicht vom Eis."
Gemäß dem goetheschen Motto, wonach der treuliche Protokollant antritt gegen die Leugnungen der Nachwelt, erfüllt Christoph Hein seinen Auftrag, die Perversion eines Menschheitstraums chronologisch in einen erzählerischen Rahmen zu zwingen. Dazu häuft er oft viele Fakten auf engem Raum, bändigt den Stoff mit Tempo und baut historische Ereignisse in seine Handlung ein, wobei ihm manchmal die Dialoge einen Tick zu didaktisch geraten. Doch er schafft es souverän, keine seiner Figuren zu denunzieren.
Mit lakonischer, geradezu kunstfreier Sprache entwickelt der mittlerweile achtzigjährige Hein aus der Kraft der Ruhe sein Opus magnum eines Gesellschaftsromans. Dabei ist es faszinierend, wie man sich von seinem scheinbar biederen Erzählfluss widerstandslos einfangen lässt. So wird Hein ein weiteres Mal und in so noch nicht da gewesener Üppigkeit zum scharfsichtigen Protokollanten ostdeutscher Verhältnisse.
Wieder bringt er dazu seinen schnörkellos lapidaren, schmuckfreien Stil in Stellung. Diese Prosa liest sich, als blieben die jeweils ersten Attribute und Verben stehen. Die Notdurft wird verrichtet, protestiert wird heftig, der Arbeit wird nachgegangen, das Zimmer schluchzend verlassen, das Essen eingenommen und so weiter. Irgendwann begreift man jedoch beim faszinierten Lesen, wie präzise aus dieser kargen Art des Erzählens die Objektivität des Berichts erwächst, dem auf diese Weise nachträglich Geschöntes verweigert wird. Vielleicht entspringt genau hier die Quelle für die Genauigkeit des Textes? Und irgendwann spürt man, wie gekonnt reibungsfrei dieses Erzählen abschnurrt.
Es handelt vom Verschwinden der Ideale, von Bestrafungen für Abweichlertum und den Verquickungen von Gesellschaftlichem und Privatem, driftet ins Klischee, wenn es um die neue bundesrepublikanische Wirklichkeit geht. Und doch ist Christoph Hein bis dahin ein unbedingt geeigneter Kronzeuge.
Irgendwann war die schön übersichtliche Trennung in Freund und Feind verschwunden. Irgendwie machte die Zeit aus allen Narren. Irgendwo saßen sie auf dem titelgebenden Narrenschiff. Christoph Hein tritt das Erbe seines mittelalterlichen Kollegen Sebastian Brant an, der ebenfalls seine Helden auf dem Weg in ein erträumtes Land die Richtung verlieren ließ. ULRICH STEINMETZGER
Christoph Hein: "Das Narrenschiff". Roman.
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2025.
751 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








