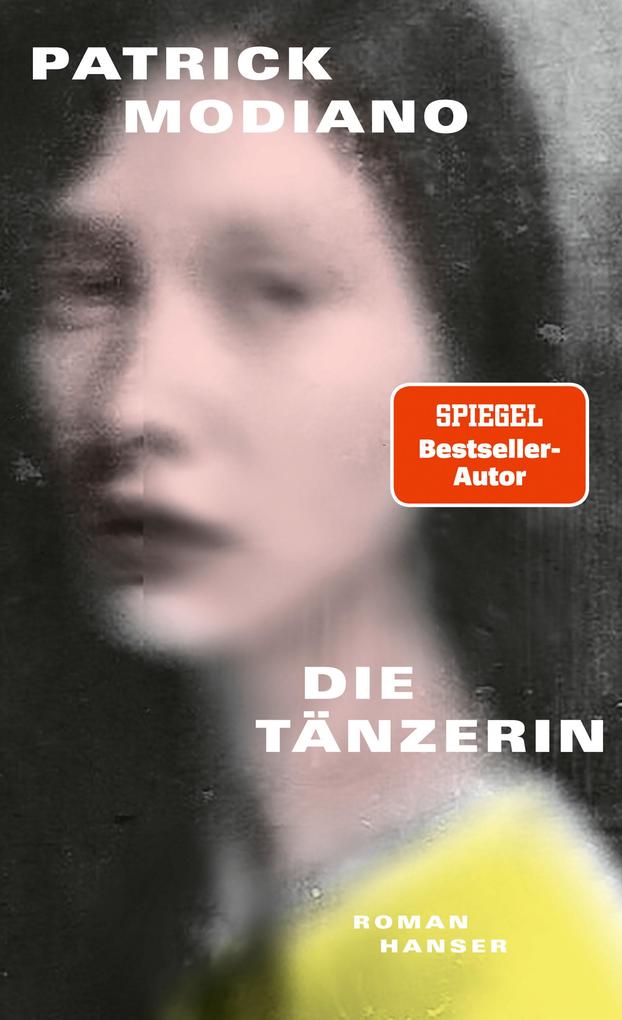
Sofort lieferbar (Download)
Eine schwebend schöne Liebesgeschichte von Patrick Modiano. »Der zarteste, grazilste und lichteste seiner Romane. « Le Nouvel Obs
Eine zufällige Begegnung auf der Straße und sie ist wieder da: die längst vergangene Zeit, als er, jung und voller Schriftstellerambitionen, in Paris eine Balletttänzerin kannte und vielleicht auch liebte. Da waren ihr scheuer Sohn Pierre, um den er sich kümmerte, die charismatische Pola Hubersen und Serge Verzini, in dessen "Zauberkasten" sie sich trafen und unter die Pariser Nachtgestalten mischten. Doch wer war die Tänzerin wirklich und welch schweigsame Verbundenheit teilte er mit ihr? Modiano erzählt schwebend schön von zwei Menschen, die ihre Herkunft hinter sich lassen und ein neues, freies Leben beginnen können.
Eine zufällige Begegnung auf der Straße und sie ist wieder da: die längst vergangene Zeit, als er, jung und voller Schriftstellerambitionen, in Paris eine Balletttänzerin kannte und vielleicht auch liebte. Da waren ihr scheuer Sohn Pierre, um den er sich kümmerte, die charismatische Pola Hubersen und Serge Verzini, in dessen "Zauberkasten" sie sich trafen und unter die Pariser Nachtgestalten mischten. Doch wer war die Tänzerin wirklich und welch schweigsame Verbundenheit teilte er mit ihr? Modiano erzählt schwebend schön von zwei Menschen, die ihre Herkunft hinter sich lassen und ein neues, freies Leben beginnen können.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
18. März 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
96
Dateigröße
1,51 MB
Autor/Autorin
Patrick Modiano
Übersetzung
Elisabeth Edl
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
französisch
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783446283657
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 05.04.2025
Besprechung vom 05.04.2025
Nicht mehr wiederzuerkennen
Patrick Modianos Sepia-Paris bekommt im Kurzroman "Die Tänzerin" neuen Reiz
Es ist ein charmantes Paradox: Patrick Modianos berühmt-berüchtigte "kleine Musik", die den Leser ins Paris von früher entführt und mit dem Charme einer längst vergangenen Jugend betört, steigt nicht spontan und frei in die Luft. Das Lesen und Wiederlesen der Romane, die Modiano seit 1968 im Zweijahresrhythmus veröffentlicht, legt vielmehr eine literarische Kombinatorik nahe, eine stets neue Abwandlung einiger weniger Motive und Verfahren. Wie Figuren eines blau getönten Schachspiels bringt der Romancier sie auch in "Die Tänzerin" zum Einsatz: einen Mann an der Schwelle zum Erwachsenenleben, eine Frau mit Vergangenheit, kriminelle Männer, unsichere Wohn- und Lebensverhältnisse im Paris der Nachkriegszeit, mit festen Ankerpunkten wie der Place Blanche. Wichtiger noch: die versagende Erinnerung an all das, die Suche nach Anhaltspunkten, das Auflisten von Details - und natürlich die Nostalgie.
Dieses Mal erzählt Modiano von der Beziehung eines Chansonschreibers mit einer Tänzerin. Sie nimmt Kurse bei Tanzlehrer Boris Kniaseff im Studio Wacker (beide sind historisch verbürgt) und liest in ihrer Freiheit Krimis oder Klassiker der Mystik, die eine Ärztin ihr überlassen hat. Er beginnt eine Arbeit als Lektor für englischsprachige Bücher und kümmert sich um ihren siebenjährigen Sohn Pierre; dessen Vater war nur ein Intermezzo und hat sich längst verabschiedet. Das Paar geht mit anderen Tänzern in den "Zauberkasten", ein Restaurant, das Serge Verzini betreibt, eine etwas zwielichtige Figur, die eine "leicht suspekte Eleganz" zeigt. Verzini ist nicht nur der Vermieter des Chansonschreibers, sondern auch ein Freund von Pierres verschollenem Vater und Beschützer der Tänzerin. Schließlich wäre da Pola Hubersen, eine wohlhabende Mäzenin und Whiskytrinkerin, die das junge Paar in ihr enges Bett einlädt und ihre Wohnung fürs Stelldichein zur Verfügung stellt.
Ein zufälliges Wiedersehen mit Verzini löst die Erinnerung an jene ein halbes Jahrhundert zurückliegende Zeit aus. Der Erzähler ruft sich eine unbestimmte Existenz in Erinnerung: "Aber damals lebte ich in den Tag hinein, ohne mir Fragen zu stellen über all jene, mit denen ich durch Zufall in Berührung kam. Ich ließ mich treiben von der Strömung. Ich machte den toten Mann." Eine heikle Lage - "Es war die unsicherste Zeit in meinem Leben" -, aus der ihn die Beziehung rettet: "Und ich glaube wirklich, mich hat das Beispiel der Tänzerin, ohne dass es mir deutlich bewusst war, dazu gebracht, mein Verhalten langsam zu ändern und diese Unsicherheit und dieses Nichts in mir schließlich abzuschütteln." Die Tänzerin nämlich gibt sich eine "Disziplin", sie arbeitet hart für Aufführungen, etwa am Théâtre des Champs-Élysées. Kniaseff hält sie für seine begabteste Schülerin.
Dank ihrer Willenskraft hat sich die junge Frau neu entworfen, fern von Saint-Leu-la-Forêt, jener Kleinstadt im Nordwesten von Paris, wo sie mit Pierres Vater "ein paar Monate" zusammenlebte ("er hatte ihr nicht viel bedeutet") - und in schlechte Gesellschaft geriet. Die Geister der Vergangenheit holen sie dennoch ein, in Gestalt der Barise-Brüder, die sie als Jugendliche belästigt haben. André Barise macht sie nun, acht Jahre später, ausfindig, lauert ihr auf, bis sie Verzini um Hilfe bittet. Erzählerisch sind die entsprechenden Passagen sowie eine Liebschaft zwischen der Tänzerin und ihrem Partner isoliert: Der Bericht erfolgt hier in der dritten Person, und man fragt sich, wie der Ich-Erzähler Kenntnis davon erlangt haben könnte. Auch die knappen Andeutungen zur Vorgeschichte in Saint-Leu-la-Forêt und die völlige Offenheit der späteren Entwicklung sorgen dafür, dass die junge Frau mit fortschreitender Handlung immer rätselhafter wird.
Jene Tage sind sehr fern, und Modiano müht sich wie stets, "das Durcheinander und die Fallstricke des Gedächtnisses auszutricksen". Das ist eigentlich unmöglich: "Übrig sind ein paar Puzzlesteine, für immer auseinandergerissen." Was dem Kind Pierre in seinem Spiel ohne Weiteres gelingt, will dem alternden Erzähler nicht von der Hand gehen. Er müht sich darum, "bruchstückhaft Bilder aus einer sehr fernen Zeit meines Lebens ins Gedächtnis" zu rufen, die "Eisschicht" aufzubrechen. Seine üblichen Techniken, etwa Auflistungen und Recherchen, deutet Modiano diesmal nur an.
Das Enigmatische der Tänzerin, die entgleitende Vergangenheit: Modiano variiert Figuren des Unverfügbaren, die man von ihm zur Genüge kennt. Neu ist zweierlei. Erstens wird die Tänzerin deutlicher als frühere Figuren zu einem Symbol der Literatur. Schließlich orientiert sich ein Schriftsteller in spe an ihrem Selbstentwurf, an ihrer Methode, ihrer Kunst: "Ja, es ging darum, durch ständige Übungen 'die Knoten zu entknoten', und das tat weh, doch waren sie einmal 'entknotet', verspürte man Erleichterung, man war befreit von den Gesetzen der Schwerkraft, genau wie in Träumen, wo der eigene Körper in der Luft schwebt oder im leeren Raum." Man meint, eine Beschreibung von Modianos eigener traumtänzerischer Leichtigkeit zu lesen.
Der zweite Punkt betrifft die Schilderung eines Paris, das Modiano fremd geworden ist: "Und warum geschah das heute in einer Stadt, die sich so sehr verändert hatte, dass sie keinerlei Erinnerungen mehr in mir wachrief? Eine fremde Stadt." Modianos Sepia-Paris grenzte immer schon ans Klischee. Neu ist allerdings, wie radikal er den Gegensatz zwischen Einst und Heute entwirft, die Entfremdung von der Gegenwart zeichnet. Er sieht die französische Metropole gestürmt von einer "kopflos flüchtenden Armee": "Mehr Menschen auf den Straßen, als ich je zuvor gesehen hatte. Die Leute trotteten in Zehnergruppen, zogen Rollkoffer hinter sich her, und die meisten trugen Rucksäcke. Woher kamen diese Hunderttausende von Touristen, bei denen man sich fragte, ob inzwischen nicht sie allein die Pariser Straßen bevölkerten?" Man sieht Modiano förmlich fortgerissen von den Menschenmassen.
Die Tänzerin als Bild der Literatur und der herbe Kontrast mit dem aktuellen Übertourismus verleihen dem neuen Roman, der Novellenkürze hat, einen eigenen grazilen Reiz. Modianos Kombinatorik, welche die Eleganz der Tänzerin mit dem Verstand des Schachspielers vereint, hat sich noch nicht erschöpft. NIKLAS BENDER
Patrick Modiano:
"Die Tänzerin". Roman.
Aus dem Französischen von Elisabeth Edl.
Hanser Verlag,
München 2025.
94 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Tänzerin" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









