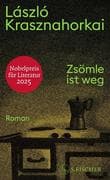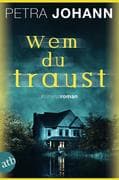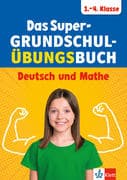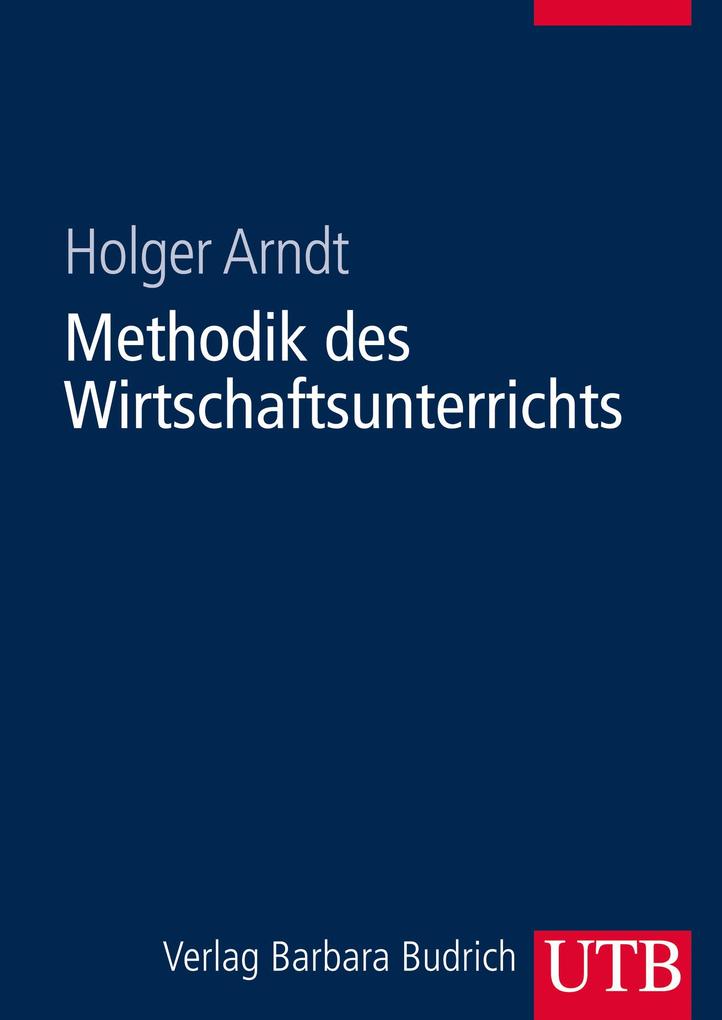Wirtschaft unterrichten mit Methode
Vom Projektunterricht bis zum WebQuest: Lehramtsstudierende und Referendare lernen in diesem Buch bewährte und innovative Methoden des Wirtschaftsunterrichts kennen und erfahren, wie man sie erfolgreich einsetzt.
Der Band ist eine echte Arbeitshilfe: Alle Methoden werden mit Vor- und Nachteilen dargestellt, die eigenständige Vorbereitung auf das Unterrichten wird durch vertiefende Aufgaben und Beispiele erleichtert.
Abgerundet werden die Ausführungen von zwei beispielhaften Unterrichtsentwürfen.
Methoden im Wirtschaftsunterricht gezielt einsetzen lernen - auf dem neuesten Stand und praxisorientiert.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 5
1. Theoretische Grundlagen 17
1. 1 Was ist unter "Methodik" zu verstehen? Eine begriffliche Annäherung 17
1. 2 Ziele des Wirtschaftsunterrichts 18
1. 2. 1 Varianten von Lernzielen 18
1. 2. 2 Begründung und Legitimation von Lernzielen 23
1. 2. 3 Verortung von Lernzielen in Gesetzen, Curricula und Bildungsstandards 25
1. 3 Lernerfolgskontrolle 30
1. 4 Ordnungsmöglichkeiten zentraler (Methodik-)Begriffe 32
1. 5 Didaktische Modelle, Unterrichtskonzepte und didaktische Prinzipien Überblick und Zusammenhänge 35
1. 5. 1 Didaktische Modelle 36
1. 5. 2 Unterrichtskonzepte 40
1. 5. 3 Didaktische Prinzipien 52
1. 6 Unterrichtsverfahren 56
1. 7 Phasenschemata 59
1. 8 Sozialformen 63
1. 8. 1 Frontalunterricht 64
1. 8. 2 Gruppenarbeit 66
1. 8. 3 Partnerarbeit 68
1. 8. 4 Einzelarbeit 69
1. 9 Aktionsformen 69
1. 9. 1 Lehrvortrag 70
1. 9. 2 Unterrichtsgespräch 71
1. 10 Methodenüberblick 75
1. 11 Vertiefung 77
1. 12 Aufgaben 77
2. Projekt 79
2. 1 Gegenstand 79
2. 2 Entwicklung der Methode 80
2. 3 Verlauf 80
2. 4 Ziele 82
2. 5 Voraussetzungen 83
2. 6 Vorteile, Nachteile und Probleme 84
2. 7 Beispiel: Schüler arbeiten und wirtschaften für einen Markt (7. Jahrgangsstufe Hauptschule, Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik in Bayern) 85
2. 8 Vertiefung 90
2. 9 Aufgaben 91
3. Forschendes Lernen 93
3. 1 Gegenstand 93
3. 2 Grundlagen empirischer Sozialforschung 93
3. 2. 1 Forschungsvarianten und Ziele 93
3. 2. 2 Der Prozess empirischer Sozialforschung im Überblick 95
3. 2. 3 Die wesentlichen Datenerhebungsinstrumente empirischer Sozialforschung 97
3. 2. 4 Grundlagen der Datenerfassung und -auswertung 106
3. 3 Geschichte der Methode 129
3. 4 Verlauf 130
3. 5 Ziele 130
3. 6 Einsatzvoraussetzungen 131
3. 7 Vorteile und Probleme 131
3. 8 Vertiefung 132
3. 9 Aufgaben 132
4. Spiele 135
4. 1 Merkmale von Spielen 135
4. 2 Vorteile spielerischen Lernens 136
4. 3 Inhalte und Ziele des Lernens mit Spielen 137
4. 4 Integration von Spielen in den Lernprozess 138
4. 5 Vorstellung ausgewählter Spiele 139
4. 5. 1 Komplexe Simulationsspiele 139
4. 5. 2 Bis 21 zählen 151
4. 5. 3 Teppich umdrehen 151
4. 5. 4 Kennenlernspiele 151
4. 5. 5 Tabu 152
4. 5. 6 Activity 152
4. 5. 7 Was bin ich? 153
4. 5. 8 Kreuzworträtsel 153
4. 5. 9 Luftballons 153
4. 5. 10 Ballwerfen Inhalte 154
4. 5. 11 Bälle werfen Aktivierung 154
4. 5. 12 Huhn und Ei 155
5. Rollenspiele 157
5. 1 Gegenstand 157
5. 2 Verlauf 158
5. 3 Varianten 159
5. 4 Ziele 161
5. 5 Voraussetzungen 161
5. 6 Vorteile, Nachteile und Probleme 161
5. 7 Aufgaben der Lehrkraft 162
5. 8 Beispiele 163
5. 8. 1 Beispiel Tarifverhandlungen 163
5. 8. 2 Beispiel Bewerbungsgespräch 166
5. 9 Vertiefung 167
5. 10 Aufgaben 167
6. Planspiel 169
6. 1 Gegenstand 169
6. 2 Entwicklung der Methode 170
6. 3 Verlauf 170
6. 4 Planspielvarianten 173
6. 5 Ziele 174
6. 6 Vorteile und Probleme 175
6. 7 Aufgaben der Lehrkraft 177
6. 8 Beispiel: Piece of Cake 177
6. 9 Vertiefung 184
6. 10 Aufgaben 185
7. Fallstudie 187
7. 1 Gegenstand 187
7. 2 Geschichte 188
7. 3 Verlauf 188
7. 4 Varianten 190
7. 5 Ziele 191
7. 6 Vorteile und Probleme 191
7. 7 Aufgaben der Lehrkraft 192
7. 8 Beispiel: Fallstudie zur Rentag GmbH 193
7. 9 Vertiefung 198
7. 10 Aufgaben 199
8. System-Dynamics 201
8. 1 Überblick 201
8. 2 Zur Relevanz systemischen Denkens Schlechte Entscheidungen in komplexen Situationen 201
8. 3 Lernen in komplexen Systemen: Double-loop-learning: Lernen als Feedbackprozess 203
8. 4 Lernbarrieren in komplexen Systemen 205
8. 5 Verbessertes Lernen mit System-Dynamics Modelle als Lernhilfe bei komplexen Problemen 206
8. 6 Voraussetzungen zur Arbeit mit System-Dynamics 207
8. 6. 1 System-Dynamics-Kompetenz I: Fluss- und Bestandsgrößen unterscheiden 208
8. 6. 2 System-Dynamics-Kompetenz II: Die Elemente der Notation kennen 209
8. 6. 3 System-Dynamics-Kompetenz III: Ein Softwaretool beherrschen 210
8. 7 Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht 210
8. 7. 1 Expressive Modellierung 210
8. 7. 2 Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht: Explorative Modellierung 211
8. 7. 3 Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht: Simulationen 212
8. 8 Einsatz im Unterricht: Die ersten Schritte 212
8. 9 Lernziele 213
8. 10 Vorteile und Probleme 213
8. 11 Anwendung und Beispiele 214
8. 11. 1 Softwaretools 214
8. 11. 2 Powersim-Tutorial: Lisa-Sophies Taschengeld 215
8. 11. 3 Unterrichtsbeispiel: Markt und Preisbildung 220
8. 11. 4 Unterrichtsbeispiel: Wirtschaftspolitische Maßnahmen und ihre langfristigen Folgen 226
8. 12 Vertiefung 239
8. 13 Aufgaben 239
9. Schülerfirma 241
9. 1 Gegenstand 241
9. 2 Entwicklung der Methode 242
9. 3 Varianten 243
9. 4 Verlauf 244
9. 5 Lernziele 247
9. 6 Vorteile und Probleme 247
9. 7 Aufgaben der Lehrkraft 249
9. 8 Beispiele 249
9. 9 Vertiefung 249
9. 10 Aufgaben 250
10. Expertenbefragung 251
10. 1 Gegenstand und Varianten der Methode 251
10. 2 Verlauf 252
10. 3 Ziele und Inhalte 253
10. 4 Voraussetzungen 254
10. 5 Vorteile und Probleme 255
11. Erkundungen 257
11. 1 Gegenstand 257
11. 2 Entwicklung der Methode 257
11. 3 Verlauf 258
11. 4 Varianten 259
11. 5 Ziele und Inhalte 261
11. 6 Voraussetzungen 261
11. 7 Vorteile und Probleme 262
11. 8 Aufgaben der Lehrkraft 263
12. Betriebspraktikum 265
12. 1 Gegenstand 265
12. 2 Entwicklung der Methode 265
12. 3 Verlauf 266
12. 4 Varianten 269
12. 5 Ziele und Inhalte 271
12. 6 Voraussetzungen 271
12. 7 Vorteile und Probleme 272
13. Leittextmethode 275
13. 1 Gegenstand 275
13. 2 Entwicklung der Methode 275
13. 3 Verlauf 276
13. 4 Varianten 277
13. 5 Ziele und Inhalte 278
13. 6 Vorteile und Probleme 278
13. 7 Voraussetzungen 279
13. 8 Beispiel: Eigenfertigung oder Fremdbezug? 280
13. 9 Vertiefung 287
13. 10 Aufgaben 287
14. WebQuest 289
14. 1 Gegenstand 289
14. 2 Entwicklung der Methode 289
14. 3 Verlauf 290
14. 4 Ziele und Inhalte 291
14. 5 Voraussetzungen 291
14. 6 Vorteile und Probleme 292
14. 7 Aufgaben der Lehrkraft 293
14. 8 Vertiefung 293
14. 9 Aufgaben 294
15. Zukunftswerkstatt 295
15. 1 Gegenstand 295
15. 2 Verlauf 296
15. 3 Ziele 297
15. 4 Vorteile und Probleme 298
15. 5 Vertiefung 298
15. 6 Aufgaben 299
16. Pro- und Kontra-Debatte 301
16. 1 Gegenstand 301
16. 2 Verlauf 301
16. 3 Ziele 303
16. 4 Aufgaben 303
17. Mikromethoden 305
17. 1 Lernkonzert 305
17. 2 Brainstorming 306
17. 3 Mind-Map 307
18. Schülerfeedback mit OPUS 309
18. 1 Einführung 309
18. 2 Schüler als Datenlieferanten zur Evaluation von Unterricht 309
18. 3 Die Schülerfeedbackmethode OPUS 310
18. 4 Durchführung eines Schülerfeedbacks mit OPUS 311
18. 5 Erfahrungen 314
18. 6 Lernziele, Probleme und Vorteile der Methode 314
18. 7 Auswahlliste mit möglichen Kriterien zum Schülerfeedback 315
Rückschau und Ausblick 317
Anhang A: Unterrichtsentwurf zum Thema "Die Ökosteuer - (k)ein Irrweg?" 319
A1. Lehrplanbezug und Stundenlernziel 319
A2. Lernvoraussetzungen 320
A2. 1 Klasse 320
A2. 2 Vorwissen und Folgestruktur 320
A3 Lerninhalte 320
A3. 1 Analyse der Lerninhalte 320
A3. 2 Auswahl der Lerninhalte 322
A4. Lernziele 323
A4. 1 Feinlernziele 323
A4. 2 Fachspezifisch allgemeine Lernziele 323
A5. Lernorganisation: Gliederung des Unterrichts und Methodenwahl 324
Anhang B: Unterrichtsentwurf zum Thema "Die optimale Bestellmenge" 329
B1. Lehrplanbezug und Stundenlernziel 329
B2. Lernvoraussetzungen 329
B3. Lerninhalte 330
B3. 1 Strukturanalyse 330
B3. 2 Auswahl, Reduktion und Anordnung der Inhalte 331
B4. Lernziele 332
B4. 1 Feinlernziele 332
B4. 2 Fachspezifisch allgemeine Lernziele 332
B5. Lehr- und Lernorganisation 333
B5. 1 Begründung methodischer Entscheidungen und eingesetzter Medien 333
B5. 2 Darstellung des Unterrichtsverlaufs 333
19. Literaturverzeichnis 339
Webseiten 343
Stichwortverzeichnis 345