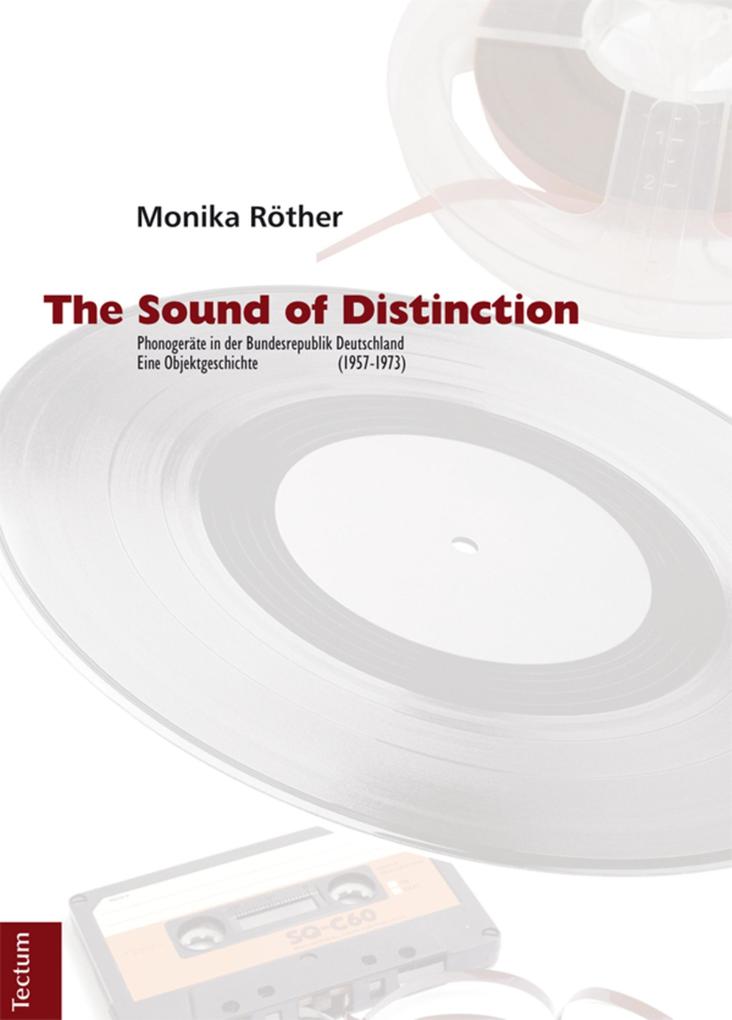
Sofort lieferbar (Download)
Im digitalen Medienzeitalter erleben die analogen Musikmedien ein Revival. Musikliebhaber bevorzugen den vollen Klang der Vinyl-Schallplatten, mit nostalgischen Gefühlen erinnern sich viele an die altgediente Musikkassette. Monika Röther schaut zurück in die Zeit der späten Fünfziger- und der Sechzigerjahre, als Musikschränke und Stereoanlagen, Plattenspieler, Tonbandgeräte und Kassettenrekorder ihren Platz in der westdeutschen Gesellschaft eroberten. Der luxuriöse Musikschrank im Wohnzimmer der Eltern bekam Konkurrenz durch den farbenfrohen, tragbaren Kofferplattenspieler der Jugendlichen. Technikliebhaber fachsimpelten über die beste Zusammenstellung der neuesten Stereoanlagen oder widmeten sich technischen Basteleien am Tonbandgerät. Die jüngeren Rockmusik-Fans zeichneten die neuesten Hits auf Tonband und Kassette auf. Die Objektgeschichten der Phonogeräte erzählen eine facettenreiche Geschichte der "wilden Sechziger", die in der sozialhistorischen Forschung als Umbruchphase gelten: Der Gebrauch der Phonogeräte zuhause und unterwegs stellte eingeübte Muster des Musik- und Technikkonsums in Frage und beförderte neue Formen des sozialen Miteinanders.
Inhaltsverzeichnis
A Einleitung
I Thesen und Ziele
II Forschungsstand
III Theoretische Anleihen und Methode
III.1 Eine historische Betrachtung der Phonogeräte-Dispositive
III.2 Sozial konstruierte Artefakte. Social Construction of Technology, user configurations, scripts und user designs
III.3 Bedeutungsreiche und gezähmte Artefakte. Kulturgeschichte der Dinge, material culture studies, cultural studies und Domestication
IV Aufbau und Darstellungsperspektiven der Arbeit
IV.1 Objekte. Möglichkeiten und Widerständigkeiten, Technik, Design und Choreografie der Nutzung
IV.2 Vermarktung. Inszenierung von Zielgruppen und Hörsituationen
IV.3 Diskussion. Warentester, HiFi-Experten und Konsumentenmagazine als Wegbereiter und Kritiker der Geräteentwicklung
IV.4 Aneignungen. Objekte der Abgrenzung und Distinktion
V Quellen
V.1 Objekte
V.2 Hersteller und Händler
V.3 Kritiker und Nutzer
B Die "langen Sechzigerjahre" in der Bundesrepublik: Lebens-, Konsum- und Medienwelten im Umbruch
I Einführung in bewegte Zeiten
II Auf dem Weg in eine ausdifferenzierte Konsumgesellschaft
III Familiäre Häuslichkeit zwischen traditionellem Hochglanz und modernem Wohndesign
IV Die Ausbildung eines vielseitigen massenmedialen Ensembles
C Phonogeräte als Zentrum der privaten Lebenswelt I Der Musikschrank - Prunkstück deutscher Wohlstandshäuslichkeit
I.1 Tonmöbel in allen Formen, Farben, Hölzern und Preislagen
I.1.1 Die bescheidene Phonokommode verliert gegen den prächtigen Musikschrank
I.1.2 Der Phonoschrank als "kleiner Bruder" des Musikschranks
I.1.3 Ein Rundum-Paket für den Musikgenuss - der Musikschrank Arabella
I.2 Dem Käufer geht es "um Farbe, Form und Klang". Die Vermarktung der Tonmöbel
I.2.1 Musikmöbel als Schmuckstück des kultivierten Heims
I.2.2 Das heimische Konzert auf Knopfdruck
I.3 Möbeldesign und Klangqualität im Wettstreit
I.3.1 Musikmöbel vereinen wohnliche Form und guten Klang
I.3.2 "Der angeberische Musikschrank" - Kritik am Möbeldesign auf Kosten des Klangs
I.4 Die Aneignung der Musikschränke: Vom "Heiligtum der Wohnung" zum altmodischen Apparat
I.4.1 Erinnerungen an den Musik-Altar
I.4.2 Der Musikschrank wird ausgemustert
II Stereofonie und High Fidelity - Technik und Sound als Antrieb der Ausdifferenzierung und Merkmal der Abgrenzung
II.1 Stereo-Klang von Schallplatte und Tonband. Lautstarke Vermarktung, leise Verbraucher und hörbare Kritik
II.1.1 Stereo und HiFi - Das neue Klangwunder
II.1.2 Von Stereo überrumpelt - der verwirrte Verbraucher wartet ab
II.1.3 Kritik an leeren Versprechen zu überhöhten Preisen
II.2 Der Stereo-Rundfunk und die HiFi-Norm führen zum Erfolg
II.2.1 Besser spät als nie - Das Radio macht die Stereofonie bekannt
II.2.2 Die HiFi-Norm bietet Orientierung
II.2.3 Stereo und HiFi ziehen immer mehr Nutzer in ihren Bann
III Der Musikschrank zerfällt in seine Bausteine: Die Stereoanlage als perfekte Lösung für Auge und Ohr
III.1 Flexible Alternativen machen dem Musikschrank Konkurrenz
III.1.1 Individuelle Bausteinanlagen
III.1.2 Die Steuertruhe als Hybrid - eine Übergangslösung für den Musikschrankliebhaber
III.2 Das Ziel der Produzenten: Eine Stereoanlage in jedem Haus
III.2.1 Technik und Design nach Wunsch
III.2.2 Bedienungsfreundliche und bezahlbare Stereoanlagen für jedermann
III.3 HiFi-Enthusiasten als Vorreiter der gestiegenen Anforderungen an Sound und Design
III.3.1 Wahre Musik- und Technikliebhaber verlangen HiFi-Stereoanlagen
III.3.2 Das Stereoanlagen-Fieber greift um sich
III.4 Basteln, Stückeln und Sparen als Wege zu den begehrten Stereoanla gen - die Nutzerperspektive
IV Zwischenfazit: Umbruch im Wohnzimmer
D Einzelgeräte entflechten die familiäre Hörgemeinschaft und ermöglichen allgegenwärtigen Musikkonsum Der Plattenspieler erobert neue Hörräume und gewinnt treue Anhänger
I.1 Flexible und günstige Geräte erfüllen neue Wünsche
I.1.1 Koffergeräte machen die Schallplatte mobil
I.1.2 Günstige und moderne Heimgeräte für neue Nutzer
I.2 Inszenierte Nutzerfreuden: Was die Hersteller versprechen
I.2.1 Musik und Freude überall und jederzeit
I.2.2 Plattenspieler für dynamische junge Leute
I.2.3 Modische Plattenspieler liefern nach wenigen Handgriffen eine erstaunliche Klangfülle
I.3 Schallplattenmusik und junge Käufer setzen neue Trends auf dem Plattenspielermarkt
I.3.1 Die Schallplatten geben den Ton an
I.3.2 Die kaufkräftige junge Zielgruppe spaltet den Markt
I.4 Abgrenzen und Dazugehören - Jugendliche Bedeutungszuschreibungen an den Plattenspieler
I.4.1 Teens und Twens als mächtige Trendsetter
I.4.2 Plattenspieler als Ausdruck der Abgrenzung, Zugehörigkeit und Distinktion
I.5 Zwischenfazit: Durch Mobilisierung zur selbstbestimmten Hörgemeinschaft - Das Plattenspieler-Dispositiv
II Das Tonbandgerät als Instrument kreativer Intermedialität
II.1 Das Gerät der unbegrenzten Möglichkeiten
II.2 Die Elite: Tonbandamateure als Kritiker der Geräteentwicklung und Zugpferde des Umsatzes
II.2.1 Das Selbstverständnis der Tonbandfreunde - die technische Elite
II.2.2 Das Magnetophon 77 - komplexe Technik für den Tonbandfreund
II.2.3 Tonbandamateure und Industrie im Gespräch
II.2.4 Tonbandeln als schöpferische Freizeitgestaltung - Die kreativen Klangwelten der Amateure
II.3 Die Mehrheit: Hitjäger bannen Musik auf Band
II.3.1 Die Plattenindustrie diskutiert den Tonraub der Laien
II.3.2 Hitparade statt Hörspiele - Die intermedialen Musikwelten der Jugend
II.4 Zwischenfazit: Das Tonbandgerät - Die Kreativität behauptet sich
III Der Kassettenrekorder vereint unbeschwerte Mobilität und unkomplizierte Intermedialität
III.1 Fast Forward: Kassetten-Nostalgie im Jahr 2003
III.2 Rewind: Der Philips Taschen-Recorder 3300 von 1963
II.3 Pause - Ein Blick auf Kassette und Abspielgerät
III.3.1 Die "Rangelei der Systeme" und der Sieg des Compact Cassetten-Standards
III.3.2 Das Telefunken magnetophon cc alpha von 1969
III.4 Play - Soundtrack of Success: Die Aushandlung eines erfolgreichen Kassettenrekorder-Dispositivs
III.4.1 Seite A - On Tour: Kassettenrekorder machen mobil
III.4.2 Seite B - Easy listening and recording: Intermedialität leicht gemacht
III.5 Stop & Eject - Zwischenfazit: Zielgruppengerechte Intermedialität
E Fazit I Raum- und Tonkultur 1956 und 1973
II Eine Objektgeschichte der Ausdifferenzierung und Abgrenzung
III Ergebnisse der historischen Betrachtung der Phonogeräte-Dispositive
III.1 Dispositive Schwerpunkte
III.2 Massenmediale Nischen und Koexistenz
III.3 Dispositiver Wandel - unverändertes Werbevokabular
III.4 Beharrungskräfte, Hybride und Stabilisierung
III.5 Etappen des Wandels
III.6 Phonogeräte als Kristallisationspunkt neuer Gemeinschaften
Quellen- und Literaturverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
I Thesen und Ziele
II Forschungsstand
III Theoretische Anleihen und Methode
III.1 Eine historische Betrachtung der Phonogeräte-Dispositive
III.2 Sozial konstruierte Artefakte. Social Construction of Technology, user configurations, scripts und user designs
III.3 Bedeutungsreiche und gezähmte Artefakte. Kulturgeschichte der Dinge, material culture studies, cultural studies und Domestication
IV Aufbau und Darstellungsperspektiven der Arbeit
IV.1 Objekte. Möglichkeiten und Widerständigkeiten, Technik, Design und Choreografie der Nutzung
IV.2 Vermarktung. Inszenierung von Zielgruppen und Hörsituationen
IV.3 Diskussion. Warentester, HiFi-Experten und Konsumentenmagazine als Wegbereiter und Kritiker der Geräteentwicklung
IV.4 Aneignungen. Objekte der Abgrenzung und Distinktion
V Quellen
V.1 Objekte
V.2 Hersteller und Händler
V.3 Kritiker und Nutzer
B Die "langen Sechzigerjahre" in der Bundesrepublik: Lebens-, Konsum- und Medienwelten im Umbruch
I Einführung in bewegte Zeiten
II Auf dem Weg in eine ausdifferenzierte Konsumgesellschaft
III Familiäre Häuslichkeit zwischen traditionellem Hochglanz und modernem Wohndesign
IV Die Ausbildung eines vielseitigen massenmedialen Ensembles
C Phonogeräte als Zentrum der privaten Lebenswelt I Der Musikschrank - Prunkstück deutscher Wohlstandshäuslichkeit
I.1 Tonmöbel in allen Formen, Farben, Hölzern und Preislagen
I.1.1 Die bescheidene Phonokommode verliert gegen den prächtigen Musikschrank
I.1.2 Der Phonoschrank als "kleiner Bruder" des Musikschranks
I.1.3 Ein Rundum-Paket für den Musikgenuss - der Musikschrank Arabella
I.2 Dem Käufer geht es "um Farbe, Form und Klang". Die Vermarktung der Tonmöbel
I.2.1 Musikmöbel als Schmuckstück des kultivierten Heims
I.2.2 Das heimische Konzert auf Knopfdruck
I.3 Möbeldesign und Klangqualität im Wettstreit
I.3.1 Musikmöbel vereinen wohnliche Form und guten Klang
I.3.2 "Der angeberische Musikschrank" - Kritik am Möbeldesign auf Kosten des Klangs
I.4 Die Aneignung der Musikschränke: Vom "Heiligtum der Wohnung" zum altmodischen Apparat
I.4.1 Erinnerungen an den Musik-Altar
I.4.2 Der Musikschrank wird ausgemustert
II Stereofonie und High Fidelity - Technik und Sound als Antrieb der Ausdifferenzierung und Merkmal der Abgrenzung
II.1 Stereo-Klang von Schallplatte und Tonband. Lautstarke Vermarktung, leise Verbraucher und hörbare Kritik
II.1.1 Stereo und HiFi - Das neue Klangwunder
II.1.2 Von Stereo überrumpelt - der verwirrte Verbraucher wartet ab
II.1.3 Kritik an leeren Versprechen zu überhöhten Preisen
II.2 Der Stereo-Rundfunk und die HiFi-Norm führen zum Erfolg
II.2.1 Besser spät als nie - Das Radio macht die Stereofonie bekannt
II.2.2 Die HiFi-Norm bietet Orientierung
II.2.3 Stereo und HiFi ziehen immer mehr Nutzer in ihren Bann
III Der Musikschrank zerfällt in seine Bausteine: Die Stereoanlage als perfekte Lösung für Auge und Ohr
III.1 Flexible Alternativen machen dem Musikschrank Konkurrenz
III.1.1 Individuelle Bausteinanlagen
III.1.2 Die Steuertruhe als Hybrid - eine Übergangslösung für den Musikschrankliebhaber
III.2 Das Ziel der Produzenten: Eine Stereoanlage in jedem Haus
III.2.1 Technik und Design nach Wunsch
III.2.2 Bedienungsfreundliche und bezahlbare Stereoanlagen für jedermann
III.3 HiFi-Enthusiasten als Vorreiter der gestiegenen Anforderungen an Sound und Design
III.3.1 Wahre Musik- und Technikliebhaber verlangen HiFi-Stereoanlagen
III.3.2 Das Stereoanlagen-Fieber greift um sich
III.4 Basteln, Stückeln und Sparen als Wege zu den begehrten Stereoanla gen - die Nutzerperspektive
IV Zwischenfazit: Umbruch im Wohnzimmer
D Einzelgeräte entflechten die familiäre Hörgemeinschaft und ermöglichen allgegenwärtigen Musikkonsum Der Plattenspieler erobert neue Hörräume und gewinnt treue Anhänger
I.1 Flexible und günstige Geräte erfüllen neue Wünsche
I.1.1 Koffergeräte machen die Schallplatte mobil
I.1.2 Günstige und moderne Heimgeräte für neue Nutzer
I.2 Inszenierte Nutzerfreuden: Was die Hersteller versprechen
I.2.1 Musik und Freude überall und jederzeit
I.2.2 Plattenspieler für dynamische junge Leute
I.2.3 Modische Plattenspieler liefern nach wenigen Handgriffen eine erstaunliche Klangfülle
I.3 Schallplattenmusik und junge Käufer setzen neue Trends auf dem Plattenspielermarkt
I.3.1 Die Schallplatten geben den Ton an
I.3.2 Die kaufkräftige junge Zielgruppe spaltet den Markt
I.4 Abgrenzen und Dazugehören - Jugendliche Bedeutungszuschreibungen an den Plattenspieler
I.4.1 Teens und Twens als mächtige Trendsetter
I.4.2 Plattenspieler als Ausdruck der Abgrenzung, Zugehörigkeit und Distinktion
I.5 Zwischenfazit: Durch Mobilisierung zur selbstbestimmten Hörgemeinschaft - Das Plattenspieler-Dispositiv
II Das Tonbandgerät als Instrument kreativer Intermedialität
II.1 Das Gerät der unbegrenzten Möglichkeiten
II.2 Die Elite: Tonbandamateure als Kritiker der Geräteentwicklung und Zugpferde des Umsatzes
II.2.1 Das Selbstverständnis der Tonbandfreunde - die technische Elite
II.2.2 Das Magnetophon 77 - komplexe Technik für den Tonbandfreund
II.2.3 Tonbandamateure und Industrie im Gespräch
II.2.4 Tonbandeln als schöpferische Freizeitgestaltung - Die kreativen Klangwelten der Amateure
II.3 Die Mehrheit: Hitjäger bannen Musik auf Band
II.3.1 Die Plattenindustrie diskutiert den Tonraub der Laien
II.3.2 Hitparade statt Hörspiele - Die intermedialen Musikwelten der Jugend
II.4 Zwischenfazit: Das Tonbandgerät - Die Kreativität behauptet sich
III Der Kassettenrekorder vereint unbeschwerte Mobilität und unkomplizierte Intermedialität
III.1 Fast Forward: Kassetten-Nostalgie im Jahr 2003
III.2 Rewind: Der Philips Taschen-Recorder 3300 von 1963
II.3 Pause - Ein Blick auf Kassette und Abspielgerät
III.3.1 Die "Rangelei der Systeme" und der Sieg des Compact Cassetten-Standards
III.3.2 Das Telefunken magnetophon cc alpha von 1969
III.4 Play - Soundtrack of Success: Die Aushandlung eines erfolgreichen Kassettenrekorder-Dispositivs
III.4.1 Seite A - On Tour: Kassettenrekorder machen mobil
III.4.2 Seite B - Easy listening and recording: Intermedialität leicht gemacht
III.5 Stop & Eject - Zwischenfazit: Zielgruppengerechte Intermedialität
E Fazit I Raum- und Tonkultur 1956 und 1973
II Eine Objektgeschichte der Ausdifferenzierung und Abgrenzung
III Ergebnisse der historischen Betrachtung der Phonogeräte-Dispositive
III.1 Dispositive Schwerpunkte
III.2 Massenmediale Nischen und Koexistenz
III.3 Dispositiver Wandel - unverändertes Werbevokabular
III.4 Beharrungskräfte, Hybride und Stabilisierung
III.5 Etappen des Wandels
III.6 Phonogeräte als Kristallisationspunkt neuer Gemeinschaften
Quellen- und Literaturverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Produktdetails
Erscheinungsdatum
22. Mai 2012
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
516
Dateigröße
3,86 MB
Autor/Autorin
Monika Röther
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Adobe-DRM-Kopierschutz
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783828855458
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "The Sound of Distinction" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









