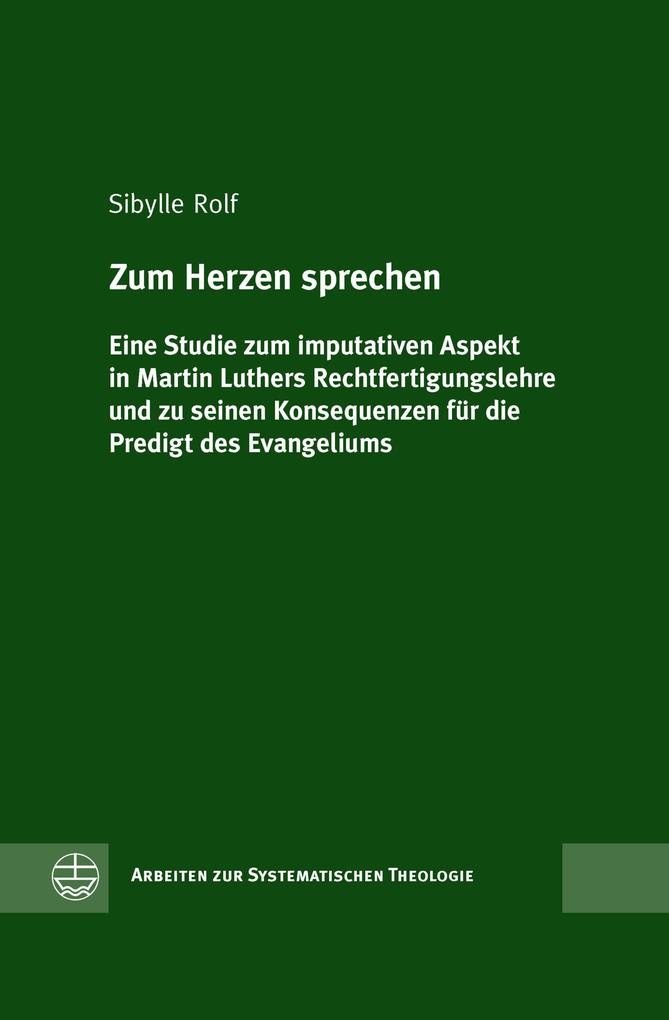
Sofort lieferbar (Download)
Die Studie beschäftigt sich mit der Frage, wie Martin Luther den zentralen Aspekt der Zu- oder Anrechnung innerhalb seiner Rechtfertigungslehre versteht und wie er imputative Rechtfertigung predigt. Im Rückgriff auf zentrale Texte aus Luthers akademischem Wirken werden drei Aspekte der imputatio herausgearbeitet: 1. die Zurechnung des Glaubens, 2. die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi und 3. die Nicht-Zurechnung der Sünde. Den theoretischen Verständnishintergrund für die Analyse von Luthers Rechtfertigungspredigt bilden die Sprechakttheorie (J. Austin), die Semiotik (Charles S. Peirce) sowie die Rhetorik mit dem Rekurs auf die Affektenlehre. Dabei versucht die Studie, Luthers Verständnis von imputatio in einem kommunikativen, relationalen und prozessualen Deutungsrahmen zu interpretieren und für gegenwärtiges Sprechen über Rechtfertigung fruchtbar zu machen.
Die Studie wurde von der Theologischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg als Habilitationsschrift angenommen.
Die Studie wurde von der Theologischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg als Habilitationsschrift angenommen.
Inhaltsverzeichnis
INHALT
Vorwort 11
1 Hinfu hrung 15
1.1 Zur Fragestellung 15
1.2 Zur Methodik der Arbeit 17
1.3 Zur Struktur der Arbeit und zur Textauswahl 19
1.4 Semantische Zuga nge zum Versta ndnis von imputatio 21
1.5 Zur Gliederung des ersten Hauptteils 29
2 Luthers Versta ndnis von imputativer Rechtfertigung 32
2.0 Das Wortfeld imputatio/reputatio in Luthers Theologie. Ein U berblick 32
2.1 Das defizita re Versta ndnis von imputatio bei Augustinus. Luthers Problematisierung 33
2.2 Die non-imputatio als Vergebung der Su nde 40
2.2.1 Luthers Versta ndnis des Menschen vor Gott 40
2.2.2 »Rechtfertigung« als Vergebung und Nichtzurechnung der Su nde 48
2.2.3 Die Formel »simul iustus et peccator« 57
2.3 Luthers Rede von der imputatio und das darin implizierte Wirklichkeitsversta ndnis. Zur Lutherforschung im 20. Jahrhundert 62
2.3.1 Die Lehre von der »Rechtfertigung« in der Lutherforschung des fru hen 20. Jahrhunderts 63
2.3.2 Zur Frage nach einer »relationalen Ontologie« 70
2.3.2.1 Der Mensch als exzentrisches, responsorisches und eschatologisches Wesen. Die Konzeption von Wilfried Joest 72
2.3.2.2 Sein als Zusammensein. Der Ansatz von Gerhard Ebeling 77
2.3.2.3 Die exzentrische Verfasstheit des Menschen. Neuere Arbeiten zu Luther 81
2.3.2.4 Die Lehre von der »Rechtfertigung« als Mitte von Luthers Theologie? Eine zusammenfassende These und ein Blick nach Helsinki 84
Exkurs 1: Die kontroverstheologische Diskussion um die Rechtfertigung. Zum o kumenischen Gespra chsprozess in Deutschland 88
1 Der Prozess um die Studie »Lehrverurteilungen kirchentrennend?« 92
2 Die »Gemeinsame Erkla rung zur Rechtfertigungslehre« 100
2.4 Luthers Versta ndnis der iustitia Christiana 104
2.4.1 »Gerechtigkeit« und »Zurechnung« 104
2.4.2 Die Unterscheidung von iustitia activa und iustitia passiva 106
2.4.3 Zur Notwendigkeit eines kommunikativen Versta ndnisses der iustitia Christiana 110
2.5 Die Anrechnung des Glaubens als »Gerechtigkeit« bei Luther 112
2.5.1 Der Glaube als trinitarisch vermitteltes christologisches Beziehungsgeschehen 115
2.5.2 Die Unverfu gbarkeit des Glaubens und das Wirken des Heiligen Geistes 122
2.5.3 Zur imputativen Funktion des Glaubens 125
2.5.4 Glaube als Kunst der Unterscheidung 128
2.5.5 Glaube und Liebe. Die Wirkung des Glaubens 131
2.5.5.1 Luthers Versta ndnis der responsorischen Struktur des Glaubens 132
2.5.5.2 Luthers Ablehnung der fides charitate formata 135
2.5.6 Der Glaube als fides apprehensiva 138
2.5.7 Zum Verha ltnis von Glauben und imputatio bei den ReformatorennebenLuther 143
2.5.7.1 Die Vergo ttlichung des Menschen. Zum osiandrischen Streit 143
2.5.7.2 Die Durchsetzung der imputativen Fassung der Rechtfertigungslehre 150
2.5.7.3 Heinrich Bullingers Auffassung zur »Rechtfertigung« 157
Exkurs 2: Glaube und Demut. Luthers Versta ndnis von imputatio vor 1518 160
1 Luthers Hochscha tzung der Demut in der Fru hzeit seiner Theologie 160
2 Die imputatio im Ro merbrief-Kommentar 163
2.1 Su nde, Demut und imputatio 163
2.2 Der Christus Samaritanus. Die Demut als Heilmittel gegen die Su nde 171
2.3 Die Selbsterkenntnis des Su nders und seine Glaubensgewissheit 173
3 Das genuin Reformatorische in Luthers spa terer Theologie
und die Frage nach der »reformatorischen Wende« 176
2.6 Die imputatio iustitiae Christi bei Luther 180
2.6.1 Die iustitia Christi als sich mitteilende Gemeinschaftstreue 182
2.6.2 Der Mensch und Christus vereinende Glaube 184
2.6.3 Das stellvertretende Handeln Jesu Christi als Ermo glichungsgrund der imputatio 197
2.6.3.1 Der Tod Jesu Christi als Beginn einer neuen Existenz 197
2.6.3.2 Kants Konzeption von der Unvertretbarkeit des Subjekts und ihr Verha ltnis zur Rede von der imputatio 206
Exkurs 3: Unio cum Christo. Die finnische Lutherforschung 214
1 Die Einheit mit Christus und die Vergo ttlichung des Menschen 216
2 Zur Frage nach der »real-ontischen« Pra senz Christi im Glaubenden 221
2.7 Ergebnis: Luthers Versta ndnis von imputatio 226
3 Luthers Predigt der Rechtfertigung 235
3.1 Die Verku ndigung des go ttlichen Wortes und das Wirken des Heiligen Geistes 235
3.2 Sprechen als Handeln. Die Bedeutung von Sprechakttheorie, Semiotik und Rhetorik fu r die Predigt des Evangeliums 245
3.2.1 Voru berlegungen 245
3.2.2 Zur Rezeption der Sprechakttheorie durch die Theologie fu r die Predigt 247
3.2.3 Zum Zusammenhang von Zeichen und Worten 258
3.2.3.1 Die Wechselwirkung von Sprache und Zeichendeutung 258
3.2.3.2 Die Uneindeutigkeit von Zeichen und der Vorrang des Wortes. Martin Luthers Zeichenversta ndnis 260
3.2.3.3 Zeichen, Objekt und Interpretant. Zur semiotischen Trias der Zeichendeutung 263
3.2.3.4 Homiletische Impulse. Predigt als »offenes Kunstwerk« 271
3.2.3.5 Das Ereignis der imputatio in Predigt und gottesdienstlicher Liturgie 278
3.2.3.6 Die Relevanz der Rhetorik fu r das Ereignis der imputatio 283
3.2.4 Ertrag. Die iustificatio impii in, mit und unter den verku ndigenden Zeichen 291
3.3 Zu Luthers Predigtweise und seinem Schriftversta ndnis fu r die Predigt des Evangeliums 296
3.3.1 Die Vereinigung von Ho rer und Geho rtem in der Gleichzeitigkeit des Ho rens 296
3.3.2 Zur U berlieferung der Predigten und Luthers inhaltlicher Akzentsetzung 300
3.3.3 Die imputatioin Luthers Predigten 304
3.4 Wort und Glaube 307
3.4.1 Luthers Versta ndnis des Glaubens 307
3.4.2 Die unterscheidende und versprechende Macht des Wortes Gottes und das Verbum Dei als Wort der Wahrheit 309
3.4.3 Die Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus als Ermo glichungsgrund einer »neuen Sprache« in der Predigt 318
3.5 Die Gleichzeitigkeit von Wort und Mensch 326
3.5.1 Das Paradox als Kennzeichen der Predigt der imputatio und die Freude als angemessene Reaktion des Menschen 327
3.5.2 Die Predigt der Engel als »himmlische Botschaft« 336
3.5.3 Zwischenfazit: Luthers Verku ndigung des Evangeliums als eine Freudeerweckende Rede 340
3.6 Die Verschra nkung der Geschichte Jesu Christi mit derjenigen des ho renden Menschen 343
3.6.1 Die Anteilnahme Gottes an der menschlichen Natur als Voraussetzung der imputatio 345
3.6.2 Die perso nliche Aneignung der Auferstehungsbotschaft als Ereignis der imputatio iustitiae Christi 347
3.6.3 Die Predigt vom neuen Adam als Ausgestaltung des partim iustus partim peccator 355
3.6.4 Die Notwendigkeit des Ho rens mit dem Herzen fu r das Ereignis der imputatio 359
3.7 Die Predigt der imputatio bei Martin Luther in ihrer Relevanz fu r die Praktische Theologie 363
3.7.1 Die Frage nach dem Ho rer in der Praktischen Theologie nach Ernst Lange 363
3.7.2 Die Predigt der imputatio als Ermo glichung von Erfahrung mit dem Christusereignis 370
4 Luthers Ansto ße fu r das Sprechen von »Rechtfertigung«. Ertrag und Ausblick 376
5 Literaturverzeichnis 393
5.1 Quellen 393
5.2 Hilfsmittel 394
5.3 Literatur zum Thema 395
Anhang 420
Zu den von Luther in seinen Predigten verwendeten Bildern fu r die imputatio 421
Register 423
Personenregister 423
Bibelstellenregister 426
Sachregister 427
Vorwort 11
1 Hinfu hrung 15
1.1 Zur Fragestellung 15
1.2 Zur Methodik der Arbeit 17
1.3 Zur Struktur der Arbeit und zur Textauswahl 19
1.4 Semantische Zuga nge zum Versta ndnis von imputatio 21
1.5 Zur Gliederung des ersten Hauptteils 29
2 Luthers Versta ndnis von imputativer Rechtfertigung 32
2.0 Das Wortfeld imputatio/reputatio in Luthers Theologie. Ein U berblick 32
2.1 Das defizita re Versta ndnis von imputatio bei Augustinus. Luthers Problematisierung 33
2.2 Die non-imputatio als Vergebung der Su nde 40
2.2.1 Luthers Versta ndnis des Menschen vor Gott 40
2.2.2 »Rechtfertigung« als Vergebung und Nichtzurechnung der Su nde 48
2.2.3 Die Formel »simul iustus et peccator« 57
2.3 Luthers Rede von der imputatio und das darin implizierte Wirklichkeitsversta ndnis. Zur Lutherforschung im 20. Jahrhundert 62
2.3.1 Die Lehre von der »Rechtfertigung« in der Lutherforschung des fru hen 20. Jahrhunderts 63
2.3.2 Zur Frage nach einer »relationalen Ontologie« 70
2.3.2.1 Der Mensch als exzentrisches, responsorisches und eschatologisches Wesen. Die Konzeption von Wilfried Joest 72
2.3.2.2 Sein als Zusammensein. Der Ansatz von Gerhard Ebeling 77
2.3.2.3 Die exzentrische Verfasstheit des Menschen. Neuere Arbeiten zu Luther 81
2.3.2.4 Die Lehre von der »Rechtfertigung« als Mitte von Luthers Theologie? Eine zusammenfassende These und ein Blick nach Helsinki 84
Exkurs 1: Die kontroverstheologische Diskussion um die Rechtfertigung. Zum o kumenischen Gespra chsprozess in Deutschland 88
1 Der Prozess um die Studie »Lehrverurteilungen kirchentrennend?« 92
2 Die »Gemeinsame Erkla rung zur Rechtfertigungslehre« 100
2.4 Luthers Versta ndnis der iustitia Christiana 104
2.4.1 »Gerechtigkeit« und »Zurechnung« 104
2.4.2 Die Unterscheidung von iustitia activa und iustitia passiva 106
2.4.3 Zur Notwendigkeit eines kommunikativen Versta ndnisses der iustitia Christiana 110
2.5 Die Anrechnung des Glaubens als »Gerechtigkeit« bei Luther 112
2.5.1 Der Glaube als trinitarisch vermitteltes christologisches Beziehungsgeschehen 115
2.5.2 Die Unverfu gbarkeit des Glaubens und das Wirken des Heiligen Geistes 122
2.5.3 Zur imputativen Funktion des Glaubens 125
2.5.4 Glaube als Kunst der Unterscheidung 128
2.5.5 Glaube und Liebe. Die Wirkung des Glaubens 131
2.5.5.1 Luthers Versta ndnis der responsorischen Struktur des Glaubens 132
2.5.5.2 Luthers Ablehnung der fides charitate formata 135
2.5.6 Der Glaube als fides apprehensiva 138
2.5.7 Zum Verha ltnis von Glauben und imputatio bei den ReformatorennebenLuther 143
2.5.7.1 Die Vergo ttlichung des Menschen. Zum osiandrischen Streit 143
2.5.7.2 Die Durchsetzung der imputativen Fassung der Rechtfertigungslehre 150
2.5.7.3 Heinrich Bullingers Auffassung zur »Rechtfertigung« 157
Exkurs 2: Glaube und Demut. Luthers Versta ndnis von imputatio vor 1518 160
1 Luthers Hochscha tzung der Demut in der Fru hzeit seiner Theologie 160
2 Die imputatio im Ro merbrief-Kommentar 163
2.1 Su nde, Demut und imputatio 163
2.2 Der Christus Samaritanus. Die Demut als Heilmittel gegen die Su nde 171
2.3 Die Selbsterkenntnis des Su nders und seine Glaubensgewissheit 173
3 Das genuin Reformatorische in Luthers spa terer Theologie
und die Frage nach der »reformatorischen Wende« 176
2.6 Die imputatio iustitiae Christi bei Luther 180
2.6.1 Die iustitia Christi als sich mitteilende Gemeinschaftstreue 182
2.6.2 Der Mensch und Christus vereinende Glaube 184
2.6.3 Das stellvertretende Handeln Jesu Christi als Ermo glichungsgrund der imputatio 197
2.6.3.1 Der Tod Jesu Christi als Beginn einer neuen Existenz 197
2.6.3.2 Kants Konzeption von der Unvertretbarkeit des Subjekts und ihr Verha ltnis zur Rede von der imputatio 206
Exkurs 3: Unio cum Christo. Die finnische Lutherforschung 214
1 Die Einheit mit Christus und die Vergo ttlichung des Menschen 216
2 Zur Frage nach der »real-ontischen« Pra senz Christi im Glaubenden 221
2.7 Ergebnis: Luthers Versta ndnis von imputatio 226
3 Luthers Predigt der Rechtfertigung 235
3.1 Die Verku ndigung des go ttlichen Wortes und das Wirken des Heiligen Geistes 235
3.2 Sprechen als Handeln. Die Bedeutung von Sprechakttheorie, Semiotik und Rhetorik fu r die Predigt des Evangeliums 245
3.2.1 Voru berlegungen 245
3.2.2 Zur Rezeption der Sprechakttheorie durch die Theologie fu r die Predigt 247
3.2.3 Zum Zusammenhang von Zeichen und Worten 258
3.2.3.1 Die Wechselwirkung von Sprache und Zeichendeutung 258
3.2.3.2 Die Uneindeutigkeit von Zeichen und der Vorrang des Wortes. Martin Luthers Zeichenversta ndnis 260
3.2.3.3 Zeichen, Objekt und Interpretant. Zur semiotischen Trias der Zeichendeutung 263
3.2.3.4 Homiletische Impulse. Predigt als »offenes Kunstwerk« 271
3.2.3.5 Das Ereignis der imputatio in Predigt und gottesdienstlicher Liturgie 278
3.2.3.6 Die Relevanz der Rhetorik fu r das Ereignis der imputatio 283
3.2.4 Ertrag. Die iustificatio impii in, mit und unter den verku ndigenden Zeichen 291
3.3 Zu Luthers Predigtweise und seinem Schriftversta ndnis fu r die Predigt des Evangeliums 296
3.3.1 Die Vereinigung von Ho rer und Geho rtem in der Gleichzeitigkeit des Ho rens 296
3.3.2 Zur U berlieferung der Predigten und Luthers inhaltlicher Akzentsetzung 300
3.3.3 Die imputatioin Luthers Predigten 304
3.4 Wort und Glaube 307
3.4.1 Luthers Versta ndnis des Glaubens 307
3.4.2 Die unterscheidende und versprechende Macht des Wortes Gottes und das Verbum Dei als Wort der Wahrheit 309
3.4.3 Die Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus als Ermo glichungsgrund einer »neuen Sprache« in der Predigt 318
3.5 Die Gleichzeitigkeit von Wort und Mensch 326
3.5.1 Das Paradox als Kennzeichen der Predigt der imputatio und die Freude als angemessene Reaktion des Menschen 327
3.5.2 Die Predigt der Engel als »himmlische Botschaft« 336
3.5.3 Zwischenfazit: Luthers Verku ndigung des Evangeliums als eine Freudeerweckende Rede 340
3.6 Die Verschra nkung der Geschichte Jesu Christi mit derjenigen des ho renden Menschen 343
3.6.1 Die Anteilnahme Gottes an der menschlichen Natur als Voraussetzung der imputatio 345
3.6.2 Die perso nliche Aneignung der Auferstehungsbotschaft als Ereignis der imputatio iustitiae Christi 347
3.6.3 Die Predigt vom neuen Adam als Ausgestaltung des partim iustus partim peccator 355
3.6.4 Die Notwendigkeit des Ho rens mit dem Herzen fu r das Ereignis der imputatio 359
3.7 Die Predigt der imputatio bei Martin Luther in ihrer Relevanz fu r die Praktische Theologie 363
3.7.1 Die Frage nach dem Ho rer in der Praktischen Theologie nach Ernst Lange 363
3.7.2 Die Predigt der imputatio als Ermo glichung von Erfahrung mit dem Christusereignis 370
4 Luthers Ansto ße fu r das Sprechen von »Rechtfertigung«. Ertrag und Ausblick 376
5 Literaturverzeichnis 393
5.1 Quellen 393
5.2 Hilfsmittel 394
5.3 Literatur zum Thema 395
Anhang 420
Zu den von Luther in seinen Predigten verwendeten Bildern fu r die imputatio 421
Register 423
Personenregister 423
Bibelstellenregister 426
Sachregister 427
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
10. Juni 2008
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
432
Dateigröße
3,95 MB
Reihe
Arbeiten zur Systematischen Theologie (ASTh), 1
Autor/Autorin
Sibylle Rolf
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783374036301
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Zum Herzen sprechen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.























