Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
Ihr Ostergeschenk: 15% Rabatt auf viele Sortimente11 mit dem Code OSTERN15
Jetzt einlösen
mehr erfahren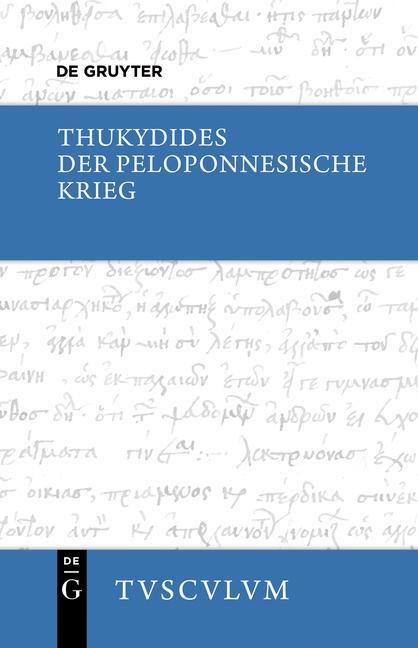
Sofort lieferbar (Download)
Thukydides hat sein unvollendetes Werk über den Peloponnesischen Krieg als , Besitztum für immer' für die Nachwelt konzipiert. Es wird hier in einer neuen Übersetzung vorgelegt, die einerseits die Eigenwilligkeit des Originals getreuer wiedergibt, sich andererseits jedoch von der heutigen deutschen Sprache weniger entfernt als vorhandene Versionen. Der Band bietet außerdem eine ausführliche Einleitung sowie erläuternde Anmerkungen.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
25. September 2017
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
1444
Reihe
Sammlung Tusculum
Autor/Autorin
Thukydides
Herausgegeben von
Michael Weißenberger
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Adobe-DRM-Kopierschutz
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783110378733
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 13.01.2025
Besprechung vom 13.01.2025
Die älteste Demokratie der Welt zerlegt sich selbst
Das ewig gültige Lehrstück über Populisten und Oligarchen stammt von dem griechischen Historiker Thukydides.
Die Beschäftigung mit Geschichte liefert keine Gebrauchsanweisung und keinen Werkzeugkasten für politisches Handeln. Sie ist auch kein Erste-Hilfe-Kurs, aus dem man mit der Gewissheit herauskommt, im Notfall alle wichtigen Handgriffe parat zu haben. Was sie stattdessen bietet, ist der Blick in einen "fernen Spiegel" (Barbara Tuchman), in dem sich die Ereignisse und Gestalten der Gegenwart auf der Folie der Vergangenheit abbilden - perspektivisch gebrochen und durch den zeitlichen Abstand mal mehr, mal weniger deutlich erkennbar.
Wer verstehen will, was er da sieht, muss nicht nur genau hinschauen. Er muss auch begreifen, dass der ferne Spiegel nur Hinweise und Fingerzeige, keine eindeutigen Wahrheiten und Handlungsmuster bereithält; dass die historischen Vergleiche nur stimmen, wenn man ihre Unstimmigkeiten mitdenkt. Das einmal Geschehene wiederholt sich nicht, auch nicht in anderen Kostümen; aber etwas Ähnliches kann immer wieder passieren. Die Schlacht bei Waterloo wird kein zweites Mal geschlagen, aber noch viele Mächtige werden in Zukunft ihr Waterloo erleben.
Im Jahr 431 vor Christus begann in Griechenland ein Krieg, der sich mit einer längeren Unterbrechung bis ins Jahr 404 hinzog. Auf der einen Seite standen das Doppelkönigtum Sparta und die mit ihm verbündeten Städte, auf der anderen Seite die athenische Demokratie und der von ihr beherrschte Attische Seebund. Es war, grob gesagt, ein Konflikt zwischen einer Seemacht und einer Allianz von Landmächten (auch wenn das im Lager Spartas angesiedelte Korinth über eine große Flotte und Athen über ein beachtliches Landheer verfügte); und es war ein Kampf zwischen zwei konkurrierenden Gesellschaftsmodellen - der Volksherrschaft, die bei den Athenern und ihren Mitstreitern den Staat konstituierte, und der Oligarchie, der Herrschaft der Reichen und Mächtigen.
Der Krieg wurde fast in der gesamten griechischsprachigen Welt ausgetragen. Im Jahr 413 scheiterte ein athenisches Expeditionsheer samt Flotte bei der Belagerung von Syrakus, ab 411 kämpften die Streitkräfte des Seebunds in Kleinasien gegen das mit Sparta verbündete Persien. Bis zuletzt rang Athen um den Zugang zum Bosporus und die Getreidelieferungen aus dem Schwarzen Meer. Am Ende, nach dem Zerfall ihres Bündnisses und dem Verlust ihrer letzten Kriegsflotte, musste die Demokratie aufgeben: Spartas Truppen besetzten Athen und installierten ein oligarchisches Regime, die "Dreißig Tyrannen". Deren Terrorherrschaft dauerte allerdings nur acht Monate, dann wurde die Demokratie restituiert. Nach zehn Jahren waren die Vorkriegsverhältnisse annähernd wiederhergestellt - nur dass Athen keinen Seebund mehr hatte, Sparta durch den jahrzehntelangen Aderlass geschwächt war und mit der Regionalmacht Theben alsbald ein neuer Player zu der tödlichen Pokerrunde trat.
Der Schmerz über die Verbannung
Was wir über den Peloponnesischen Krieg wissen, verdanken wir größtenteils dem Geschichtswerk, das der exilierte athenische Heerführer Thukydides kurz nach der Niederlage seiner Heimatstadt verfasste. Thukydides war kein neutraler Beobachter der Ereignisse; der Schmerz über die Verbannung, zu der ihn die Volksversammlung nach einer militärischen Schlappe in Nordgriechenland verurteilte, prägt seine Schilderung ebenso wie die grundsätzliche Loyalität zu Athen und seiner Verfassung. Auch die Reden und Gegenreden, die er den Handelnden in den Mund legt, sind so nie gehalten worden. Dennoch beginnt die Tradition der Geschichtsschreibung als Tatsachenkunst mit Thukydides.
Denn alles, was er zu Papier bringt, ist durch Augenzeugenberichte oder eigenes Erleben beglaubigt; schon kurz nach dem Ausbruch des Krieges, erklärt Thukydides im Vorwort, habe er mit den Notizen dazu begonnen. Die Reden der Akteure dienen nicht der Beschönigung, sondern der Erklärung ihres Tuns. Und das Leitinteresse des Erzählers an seinem Stoff ist von Anfang an klar: Es ist die Suche nach den Ursachen der athenischen Katastrophe. Thukydides ist nicht nur der erste wirkliche Historiker, er ist auch der erste, der die Geschichte ohne Illusionen und Scheuklappen befragt.
Die wesentliche Ursache der Niederlage Athens, das wird im Verlauf des in acht Bücher gegliederten Werkes klar, ist die Entartung seiner Demokratie. Die attische Volksherrschaft war nie demokratisch in unserem heutigen Sinn; nur Vollbürger, also ein Bruchteil der Bevölkerung, nahmen aktiv an ihr teil. Trotzdem hatte das komplizierte, von Kleisthenes ersonnene Regelwerk etwa siebzig Jahre lang funktioniert. Aber schon bald war die eigentliche Macht in die Hände einzelner Männer gelangt, die die Volksversammlung in ihrem Sinn zu lenken verstanden, und nach Kriegsausbruch wurde der athenische Staat endgültig zum Spielball von Demagogen. Auf den maßvollen Perikles folgte der rabiate Populist Kleon, auf diesen der neureiche und abergläubische Nikias, und zuletzt kam mit Alkibiades eine Mischung aus Popstar und Despot ans Ruder, ein ebenso genialer wie skrupelloser Abenteurer, der mal seine Landsleute an Spartaner und Perser, mal diese an die Athener verriet.
Der Niedergang der Demokratie zeigt sich im Ausmaß der Exzesse, die sie verübt. Schon kurz nach Kriegsbeginn werden auf beiden Seiten Gefangene abgeschlachtet, bald nimmt sich der Blutdurst ganze Bevölkerungen zum Ziel. Im Sommer 426 geht es darum, ob die Einwohner von Mytilene auf Lesbos, das den Bund mit Athen aufgekündigt hatte, über die Klinge springen sollen. Kleon leitet sein Plädoyer für den Massenmord mit der Bemerkung ein, er habe längst erkannt, dass die Demokratie unfähig sei, über andere zu herrschen. Bei der Abstimmung siegt noch einmal die Gegenpartei, die für Milde plädiert, doch das wird sich in den kommenden Jahren ändern.
Begründungstext des Völkerrechts
Ihren Gipfel erreicht die Grausamkeit bei der Belagerung der neutralen Insel Melos im Jahr 416. Der Dialog zwischen den Vertretern Athens und den bedrängten Meliern, den Thukydides geschrieben hat, ist zum Begründungstext des Völkerrechts geworden, eben weil er dieses negiert. Zwischen Staaten, sagen die Athener, herrsche das Recht des Stärkeren, und es sei egal, ob die Melier neutral bleiben wollten; sie müssten sich unterwerfen oder sterben. Die Insel entschließt sich zum Widerstand. Im nächsten Jahr wird ihre Stadt erobert, die Sieger töten alle männlichen Bewohner und verkaufen Frauen und Kinder in die Sklaverei.
Im Kalten Krieg ist der Konflikt zwischen Athen und Sparta von vielen Historikern als Spiegelbild des Antagonismus zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt gelesen worden. Mit dem Zerfall der Sowjetunion und dem Aufstieg Chinas hat sich dieser Vergleich scheinbar erledigt. Aber im Kern ist die Konstellation die gleiche geblieben. Noch immer steht eine atlantisch-pazifische Seemacht mit ihren europäischen Verbündeten gegen - nunmehr zwei - asiatische Landmächte und die von ihnen abhängigen Staaten. Noch immer geht es um Ressourcen, Flottenbasen, Kontrolle von Territorien. Und wie damals wird das Völkerrecht mit Füßen getreten. "Unterwirf dich oder stirb" war Putins Botschaft an die Ukraine. Der Krieg, der dort geführt wird, entscheidet über die Machtverteilung in Osteuropa, ob der Westen es will oder nicht.
Man kann das Werk des Thukydides auch als Chronik einer inneren Zerrüttung lesen. Bei Kriegsausbruch ringen Demokraten und Oligarchen in fast allen griechischen Stadtstaaten um die Herrschaft, aber in den meisten haben die Demokraten die Nase vorn. Dann beginnen die Athener, ihr eigenes Ideal zu verraten. Populisten und Superreiche kapern das Staatsschiff. Die Sizilische Expedition, Athens größtes militärisches Debakel, ist von reiner Beutegier getrieben. Im Melierdialog schließlich ist von Demokratie keine Rede mehr, es geht nur noch um Athens Machtinteresse. Auch der Deal, mit dem die Athener ihren Seebund geschmiedet haben - Schutz und Teilhabe gegen Anerkennung ihrer Vormachtstellung -, ist zur Floskel verkommen. Im letzten Kriegsjahrzehnt fällt das Bündnis in Stücke. Im Endspiel gegen seine Feinde steht Athen allein da.
Die einzigartige Bedeutung von Thukydides' Werk liegt trotz aller Dramatik nicht in seinen Kriegsschilderungen, sondern in seinen Charakterzeichnungen. Die Menschen, von denen er erzählt, der grobe Kleon, der zaudernde Nikias, der charismatische Alkibiades oder der aufrechte Spartaner Brasidas, werden zugleich als Individuen sichtbar und als Typen erkennbar. Es hat sie in der Weltgeschichte immer wieder gegeben - und es gibt sie auch heute noch. Deshalb sollte jeder deutsche Politiker, der künftig mit Trump, Putin, Musk, Orbán, Kickl, Fico, Erdogan, Netanjahu und ihresgleichen zu tun hat, den "Peloponnesischen Krieg" im Reisegepäck haben. Der ferne Spiegel zeigt nicht ihre genauen Porträts. Aber er zeigt ihr wahres Bild. ANDREAS KILB
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Der Peloponnesische Krieg" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.








