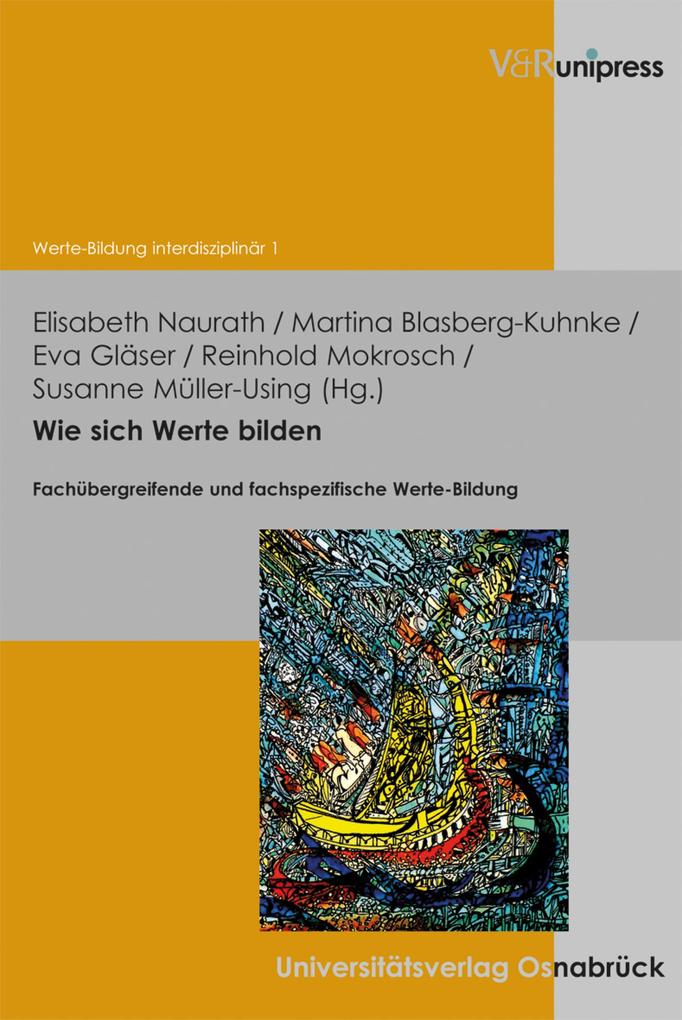
Sofort lieferbar (Download)
How do values form in our consciousness? Do we adopt values, or do they take hold of us? Do we shape values such as tolerance, human dignity, reverence for life, fairness, equality, social justice, or do they shape us? What are the pre-requisites for values to be able to develop in our consciousness and inform our behaviour? Are they specific social conditions or individual capabilities? And what causes values to form in an individual? Does health only gain significance when we are ill? Does tolerance only become important when we encounter intolerance? This volume takes up these questions from a specialist and an interdisciplinary perspective. Scholars of the natural sciences, philosophy, theology, religious studies, education studies, elementary science education, sport science, ethics and the fine arts from the Interdisciplinary Research Unit on Value Formation at the University of Osnabrück analyse the possibilities for value formation in their discipline and examine the synergy effects in co-operation with other disciplines. They provide different answers to the above questions, but share the opinion that value formation is a subjective process of self-education.
Inhaltsverzeichnis
1;Title Page;3 2;Copyright;4 3;Table of Contents;5 4;I. Grundlagen;7 5;Body;7 6;Wie sich Werte bilden. Fachübergreifende und fachspezifische Werte-Bildung. Einleitung (Reinhold Mokrosch);9 7;Arnim Regenbogen: Zu Wertediskursen in Erziehung und Gesellschaft Wer setzt Ziele? Wer bildet die Maßstäbe der Beurteilung?;15 7.1;1. Zum Spektrum der Wertbegriffe in diesem Band;16 7.2;2. Wie entstehen Werte-Diskurse?;18 7.3;3. Wertebildung und wertbesetzte Erziehungsziele;21 7.4;4. Werterziehungskonzepte;23 7.5;5. Ursprüngliche Werthaltungen als Basis für erweiterte Wertebildung in Diskursen;26 8;Elisabeth Naurath: Wertschätzung als pädagogische Grundhaltung zur Werte-Bildung;29 8.1;1. Sich wertgeschätzt fühlen und wertschätzen als Schlüssel zur Werte-Bildung;29 8.1.1;1.1 Wertschätzung auf der Basis des Selbstwertgefühls;30 8.1.2;1.2 Werte im Werden zur lebensgeschichtlichen Perspektive von Wertschätzung im frühkindlichen Alter;30 8.2;2. Werte-Bildung durch die Erfahrung von Wertschätzung im schulischen Kontext;34 8.2.1;2.1 Subjektorientierung als Weg zur Wertschätzung des/der Einzelnen;35 8.2.2;2.2 Wertschätzung auf der Basis einer bildungstheoretischen Verortung;36 8.3;3. Konkretionen zur Wertschätzung als pädagogischer Haltung;38 8.3.1;3.1 Ermöglichung von Wertschätzung auf dem Weg der Binnendifferenzierung;38 8.3.2;3.2 Wertschätzung als handlungsleitendes Kriterium im Unterricht;39 9;Reinhold Mokrosch: Religiöse Werte-Bildung im Pluralismus der Religionen?;43 9.1;1. Wie entstehen Werte? Allgemeine Überlegungen;43 9.2;2. Wie entstehen religiöse Werte? Fachspezifische Überlegungen;46 9.2.1;Exkurs: Sollte man zwischen christlichen d.h. konfessions-religiösen, allgemein-religiösen und inter-religiösen Werten unterscheiden?;47 9.3;3. Allgemeine Überlegungen zur Werte-Bildung und Werte-Erziehung;50 9.4;4. Fachspezifische Überlegungen für christliche, allgemein-religiöse und inter-religiöse Werte-Bildung bzw. Werte-Erziehung;51 9.5;5. Was verstand mein hinduistischer, buddhistisc
her, muslimischer und christlicher Gesprächspartner/in unter Werte-Bildung?;53 9.5.1;(a) Interview mit einem Hindu-Kali-Priester in Kalkutta;54 9.5.2;(b) Interview mit einem buddhistischen Mönch in Bangalore;56 9.5.3;(c) Interview mit einem Imam in Osnabrück;58 9.5.4;(d) Interview mit einer christlichen Theologin in Osnabrück;60 9.6;6. Ist religiöse Werte-Bildung, sei es in Gestalt christlicher, allgemein-religiöser oder inter-religiöser Werte-Bildung, möglich?;62 9.6.1;Schluss-Überlegungen;62 10;Susanne Müller-Using: Die Bedeutung der Werte-Bildung für die Professionalisierung angehender LehrerInnen;65 10.1;Die Werte-Bildung und das LehrerIn-Sein;65 10.1.1;1. Standards für die Lehrerausbildung;69 10.1.2;2. Der schulische Bildungsauftrag und die Umsetzung des Rechts auf Bildung;71 10.1.3;3. Professionelle Handlungskompetenz und Wissensdimensionen einer pädagogisch ausgerichteten Lehrerausbildung;75 10.1.4;5. Werte-Bildung als menschenwürdige Bildung;79 11;Wassilis Kassis: Nur auf dem Mond ist man vor dem Antisemitismus sicher. Antisemitismus bekämpfen auch eine Aufgabe der Werte-Bildung?;83 11.1;Antisemitismus ist eine relevante Form von Menschenfeindlichkeit;83 11.2;Die begriffliche Systematisierung von Antisemitismus;85 11.3;Menschenverachtende und menschenfeindliche Konzepte und Handlungen bei Jugendlichen;87 11.3.1;Methode Untersuchung STAMINA;90 11.3.2;Stichprobe;90 11.3.3;Messinstrumente;91 11.3.4;Ergebnisse: Regressionsanalysen zur Prädiktion antisemitischer Einstellungen bei Jugendlichen;92 11.3.5;Ergebnisse des ersten Analyseschrittes mit der Gesamtstichprobe;93 11.3.6;Ergebnisse zur Bedeutsamkeit des eruierten Gesamtmodells in den vier Teilstichproben;94 11.3.7;Zusammenfassung;95 12;Christoph Sturm: Von der Werte-Erziehung zur Werte-Bildung? Eine Analyse zur Geschichte der Erziehungsdebatten in der Bundesrepublik Deutschland;99 12.1;Zur Vorgeschichte;99 12.2;Methodische Zwischenüberlegungen;101 12.3;In der Defensive und aus der Defensive heraus;102 12.4;Zw
ischenspiele;109 12.5;Nach Hoyerswerda, Mölln und Solingen;113 12.6;Von Auschwitz erholen oder Anything goes in der Postmoderne;116 12.7;Conclusio;120 13;Überleitung (Martina Blasberg-Kuhnke);121 14;II. Konkretionen;123 15;Susanne Menzel: Werte-Bildung im naturwissenschaftlichen Unterricht: kein Widerspruch;125 15.1;Bildungspolitische Verankerung der Werte-Bildung im Biologieunterricht;127 15.2;Nachhaltige Entwicklung und Anwendungsgebiete der modernen Biologie zwei Kontexte des Bewertens im Biologieunterricht;129 15.3;Kompetenzmodelle zum Bewerten im Biologieunterricht;131 15.4;Wertebezogene Kontexte im Biologieunterricht Zwei Beispiele;133 15.4.1;I. Der Parc National des Oiseaux de Djoudj;133 15.4.2;II. Präimplantationsdiagnostik bei Gefahr der Mukoviszidose;136 15.5;Werte-Bildung in der Bildungspraxis: Einige Überlegungen;138 16;Sarah Gaubitz/Eva Gläser: Wertebildung im Sachunterricht vielperspektivisch und fachübergreifend;141 16.1;Entwicklung der Wertebildung in der Geschichte der Grundschule;142 16.2;Wertebildung in der Grundschule Ziele und Ansätze;144 16.3;Entwicklungspsychologische Voraussetzungen von Grundschulkindern;146 16.4;Aktuelle Erkenntnisse zur moralischen Entwicklung;148 16.5;Studien zu Wertorientierungen von Grundschulkindern;151 16.6;Wertebildung aus sachunterrichtsdidaktischer Sicht fachbezogen und fachübergreifend;152 16.7;Wertebildung im Sachunterricht: Kann man politische Werte lernen?;155 17;Arnim Regenbogen: Philosophisches in der Werte-Bildung, gefördert durch Ethik-Unterricht;157 17.1;1. Fachspezifische Werte-Bildung?;157 17.2;2. Philosophische Anforderungen in der Sprache von Lehrplänen;158 17.2.1;2.1 Wertkonflikte bearbeiten;159 17.2.2;2.2 Philosophische Gespräche führen;161 17.2.2.1;2.2.1 Interviews;162 17.2.2.2;2.2.2 Streitgespräche;162 17.2.3;2.3. Philosophische Texte schreiben;164 17.2.3.1;2.3.1 Briefe;164 17.2.3.2;2.3.2 Dialoge;164 17.2.3.3;2.3.3 Essays;165 17.3;3. Philosophische Lebenshaltung auch durch Unterricht zu fördern?;166
18;Peter Elflein/Yoon-Sun Huh: Werte und Ziele interkultureller Erziehung zwischen Integration und Menschenbildung Anschlussperspektiven für die Bewegungs- und Sportpädagogik;169 18.1;1. Einführung;169 18.2;2. Untersuchungen zur Begründung eines allgemeinen pädagogischen Werte- und Zielhorizontes für interkulturelle Erziehung;169 18.2.1;2.1 Allgemeine Bildung als Bezugspunkt für interkulturelles Lernen ein (mittel).europäisches Deutungsmuster;170 18.2.2;2.2 Perspektiven der Dong-Hak Erziehungsphilosophie und Han-Ul Pädagogik (Korea);173 18.2.3;2.3 Zwischenresumee;176 18.3;3. Anschlussperspektiven für interkulturelle Bewegungs- und Sporterziehung;177 18.3.1;3.1 Konzept Integration durch Sport;178 18.3.2;3.2 Interkulturelle Bewegungs- und Sporterziehung im Horizont einer Menschenbildung;179 18.3.2.1;a. Differenzierung von Zielen und thematischen Ansatzpunkten;179 18.3.2.2;b. Methoden- und Vermittlungsperspektiven;182 18.4;4. Zusammenfassung: Wertebildung interkulturelle Werte bilden;183 19;Erna Zonne: Inklusive Religionspädagogik Grundlegende Werte;185 19.1;1. Einleitung: Inklusion aus pädagogischer Sicht;185 19.2;2. Inklusion interdisziplinär gedacht;186 19.3;3. Inklusion aus religionspädagogischer Sicht;187 19.4;4. Wertorientierte Ausrichtung von inklusiven Bestrebungen;190 19.4.1;4.1 Wertorientierung einer inklusiven Pädagogik;190 19.4.2;4.2 Wertorientierung einer inklusiven Religionspädagogik;190 19.4.3;4.3 Zur Gemeinschaft gehören;191 19.4.3.1;4.3.1 Zugehörigkeit zur Gemeinschaft aus pädagogischer Sicht;191 19.4.3.2;4.3.2 Zugehörigkeit zur Gemeinschaft aus theologischer Sicht;194 19.4.4;4.4 Das Vertrauen etwas aber nicht alles meistern zu können;197 19.4.4.1;4.4.1 Etwas aber nicht alles Meistern aus pädagogischer Sicht;197 19.4.4.2;4.4.2 Etwas aber nicht alles Meistern aus theologischer Sicht;199 19.4.5;4.5 Sinnvolles beitragen wollen;202 19.4.5.1;4.5.1 Aus pädagogischer Sicht: Sinnvolles beitragen wollen;202 19.4.5.2;4.5.2 Sinnvolles Beitragen können theologisc
he Gedanken;202 19.4.6;4.6 Abhängigkeit;204 19.4.6.1;4.6.1 Abhängigkeit aus pädagogischer Sicht;204 19.4.6.2;4.6.2 Abhängigkeit aus theologischer Sicht;205 19.5;5. Religionspädagogischer Ausblick;206 20;Carolin Teschmer: Biblische Texte als Schlüssel zur Werte-Bildung;209 20.1;1. Chancen einer Werte-Bildung im Elementarbereich;210 20.2;2. Werte-Bildung am Beispiel des Parameters Mitgefühl;212 20.2.1;2.1 Mitgefühl als Teil der Empathie und in Abgrenzung zum Mitleid;212 20.2.2;2.2 Gottes Barmherzigkeit als theologischer Ort des Mitgefühls;214 20.2.3;2.3 Die kindliche Entwicklung von Mitgefühl im religiösen Kontext;215 20.3;3. Werte bilden mit biblischen Geschichten;217 20.3.1;3.1 Das kindliche Spiel als subjektorientierter Zugang;217 20.3.2;3.2 Schlüsselfunktionen biblischer Texte zum Mitgefühl;219 20.3.3;3.3 Skizzierung einer empirischen Erhebung am Beispiel des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter (Lk 10, 2537);222 20.4;4. Schlussfolgerung;227 21;Ulrich Kuhnke: Wertebildung durch Kommunikation des Evangeliums. Zur narrativen Grundstruktur christlicher Ethik;231 21.1;1. Zum Ansatz der kognitiven Narratologie;232 21.1.1;1.1 Positioning;233 21.1.2;1.2 Embodiment;234 21.1.3;1.3 Emotionology;235 21.2;2. Zum absoluten Wert der Gottesbeziehung;235 21.3;3. Zur Grundstruktur der Nachfolgepraxis;237 21.3.1;3.1 Lieben;237 21.3.2;3.2 Hören;238 21.3.3;3.3 Beten;239 21.4;4. Besitz und Status als exemplarische Werte;240 21.4.1;4.1 Besitz;241 21.4.2;4.2 Sozialer Status;243 21.5;5. Zur wertebildenden Kommunikation;244 22;Melanie Obraz: Der spezifische Wert ästhetischer Werte;247 22.1;I. Die ästhetische Sichtweise als Tor zur Erkenntnis?;247 22.1.1;1. Das Wahre als ein spezifischer Wert des Ästhetischen;248 22.1.2;2. Eine ästhetisch ausgerichtete Sichtweise, die den Ethikaspekt mit einbezieht und als Grundlage für das Erkennen eines spezifisch ästhetischen Wertes steht;250 22.2;II. Die ästhetische Sichtweise als ein besonderes Verstehen des Alltäglichen;252 22.2.1;1. Die Aufgabe d
es Verweilens;253 22.2.2;2. Die Möglichkeit einer ästhetischen Erkenntnis aus der Mitte;254 22.2.3;3. Die Nützlichkeit einer ästhetischen Wertbestimmung;256 22.3;III. Das Ziel ästhetischen Sehens;257 22.3.1;1. Eine spezifisch ästhetische Wert-Erkenntnis;258 22.3.2;2. Die spezifisch ästhetische Sichtweise als Handlung;260 22.4;IV. Resümee;260 23;Ulrike Graf: Von der Werthaftigkeit des Glücks. Überlegungen zu einer salutogenetischen Orientierung in Unterricht und Lehrerbildung;263 23.1;1.1 Einleitung;263 23.2;1.2 Glück ein ver-messener Begriff?;264 23.3;2.1 Ökonomische und sozialwissenschaftliche Forschung;265 23.4;2.2 Salutogenetisch orientierte Forschungen Erkenntnisse für Lebensführung und professionelles pädagogisches Handeln;267 23.4.1;a. Bedürfnisorientierung;267 23.4.2;b. Das Leben als Kontinuum zwischen Polen;269 23.4.3;c. Aufmerksamkeitssteuerung;270 23.4.4;d. Sinn;274 23.4.5;e. Möglichkeitsorientierung;275 23.5;3. Kritik und Grenzen;276 23.6;4. Glück und salutogenetische Erkenntnisse als Bildungsthemen?;277 23.6.1;4.1 Historische Ankerpunkte;277 23.6.2;4.2 Gesellschaftliche Kontextebedingungen;277 23.6.3;4.3 Konsequenzen für die Gestaltung von Bildungskontexten;279 23.7;5. Eine Seminarkonzeption;281 23.7.1;Evaluation;282 23.8;6. Perspektiven;284 24;Werte-Bildung: ein Ausblick (Martina Blasberg-Kuhnke);285 25;Neuere Literatur zur Weiterarbeit in Auswahl;289 26;Hinweise zu den Autoren und Autorinnen;291
her, muslimischer und christlicher Gesprächspartner/in unter Werte-Bildung?;53 9.5.1;(a) Interview mit einem Hindu-Kali-Priester in Kalkutta;54 9.5.2;(b) Interview mit einem buddhistischen Mönch in Bangalore;56 9.5.3;(c) Interview mit einem Imam in Osnabrück;58 9.5.4;(d) Interview mit einer christlichen Theologin in Osnabrück;60 9.6;6. Ist religiöse Werte-Bildung, sei es in Gestalt christlicher, allgemein-religiöser oder inter-religiöser Werte-Bildung, möglich?;62 9.6.1;Schluss-Überlegungen;62 10;Susanne Müller-Using: Die Bedeutung der Werte-Bildung für die Professionalisierung angehender LehrerInnen;65 10.1;Die Werte-Bildung und das LehrerIn-Sein;65 10.1.1;1. Standards für die Lehrerausbildung;69 10.1.2;2. Der schulische Bildungsauftrag und die Umsetzung des Rechts auf Bildung;71 10.1.3;3. Professionelle Handlungskompetenz und Wissensdimensionen einer pädagogisch ausgerichteten Lehrerausbildung;75 10.1.4;5. Werte-Bildung als menschenwürdige Bildung;79 11;Wassilis Kassis: Nur auf dem Mond ist man vor dem Antisemitismus sicher. Antisemitismus bekämpfen auch eine Aufgabe der Werte-Bildung?;83 11.1;Antisemitismus ist eine relevante Form von Menschenfeindlichkeit;83 11.2;Die begriffliche Systematisierung von Antisemitismus;85 11.3;Menschenverachtende und menschenfeindliche Konzepte und Handlungen bei Jugendlichen;87 11.3.1;Methode Untersuchung STAMINA;90 11.3.2;Stichprobe;90 11.3.3;Messinstrumente;91 11.3.4;Ergebnisse: Regressionsanalysen zur Prädiktion antisemitischer Einstellungen bei Jugendlichen;92 11.3.5;Ergebnisse des ersten Analyseschrittes mit der Gesamtstichprobe;93 11.3.6;Ergebnisse zur Bedeutsamkeit des eruierten Gesamtmodells in den vier Teilstichproben;94 11.3.7;Zusammenfassung;95 12;Christoph Sturm: Von der Werte-Erziehung zur Werte-Bildung? Eine Analyse zur Geschichte der Erziehungsdebatten in der Bundesrepublik Deutschland;99 12.1;Zur Vorgeschichte;99 12.2;Methodische Zwischenüberlegungen;101 12.3;In der Defensive und aus der Defensive heraus;102 12.4;Zw
ischenspiele;109 12.5;Nach Hoyerswerda, Mölln und Solingen;113 12.6;Von Auschwitz erholen oder Anything goes in der Postmoderne;116 12.7;Conclusio;120 13;Überleitung (Martina Blasberg-Kuhnke);121 14;II. Konkretionen;123 15;Susanne Menzel: Werte-Bildung im naturwissenschaftlichen Unterricht: kein Widerspruch;125 15.1;Bildungspolitische Verankerung der Werte-Bildung im Biologieunterricht;127 15.2;Nachhaltige Entwicklung und Anwendungsgebiete der modernen Biologie zwei Kontexte des Bewertens im Biologieunterricht;129 15.3;Kompetenzmodelle zum Bewerten im Biologieunterricht;131 15.4;Wertebezogene Kontexte im Biologieunterricht Zwei Beispiele;133 15.4.1;I. Der Parc National des Oiseaux de Djoudj;133 15.4.2;II. Präimplantationsdiagnostik bei Gefahr der Mukoviszidose;136 15.5;Werte-Bildung in der Bildungspraxis: Einige Überlegungen;138 16;Sarah Gaubitz/Eva Gläser: Wertebildung im Sachunterricht vielperspektivisch und fachübergreifend;141 16.1;Entwicklung der Wertebildung in der Geschichte der Grundschule;142 16.2;Wertebildung in der Grundschule Ziele und Ansätze;144 16.3;Entwicklungspsychologische Voraussetzungen von Grundschulkindern;146 16.4;Aktuelle Erkenntnisse zur moralischen Entwicklung;148 16.5;Studien zu Wertorientierungen von Grundschulkindern;151 16.6;Wertebildung aus sachunterrichtsdidaktischer Sicht fachbezogen und fachübergreifend;152 16.7;Wertebildung im Sachunterricht: Kann man politische Werte lernen?;155 17;Arnim Regenbogen: Philosophisches in der Werte-Bildung, gefördert durch Ethik-Unterricht;157 17.1;1. Fachspezifische Werte-Bildung?;157 17.2;2. Philosophische Anforderungen in der Sprache von Lehrplänen;158 17.2.1;2.1 Wertkonflikte bearbeiten;159 17.2.2;2.2 Philosophische Gespräche führen;161 17.2.2.1;2.2.1 Interviews;162 17.2.2.2;2.2.2 Streitgespräche;162 17.2.3;2.3. Philosophische Texte schreiben;164 17.2.3.1;2.3.1 Briefe;164 17.2.3.2;2.3.2 Dialoge;164 17.2.3.3;2.3.3 Essays;165 17.3;3. Philosophische Lebenshaltung auch durch Unterricht zu fördern?;166
18;Peter Elflein/Yoon-Sun Huh: Werte und Ziele interkultureller Erziehung zwischen Integration und Menschenbildung Anschlussperspektiven für die Bewegungs- und Sportpädagogik;169 18.1;1. Einführung;169 18.2;2. Untersuchungen zur Begründung eines allgemeinen pädagogischen Werte- und Zielhorizontes für interkulturelle Erziehung;169 18.2.1;2.1 Allgemeine Bildung als Bezugspunkt für interkulturelles Lernen ein (mittel).europäisches Deutungsmuster;170 18.2.2;2.2 Perspektiven der Dong-Hak Erziehungsphilosophie und Han-Ul Pädagogik (Korea);173 18.2.3;2.3 Zwischenresumee;176 18.3;3. Anschlussperspektiven für interkulturelle Bewegungs- und Sporterziehung;177 18.3.1;3.1 Konzept Integration durch Sport;178 18.3.2;3.2 Interkulturelle Bewegungs- und Sporterziehung im Horizont einer Menschenbildung;179 18.3.2.1;a. Differenzierung von Zielen und thematischen Ansatzpunkten;179 18.3.2.2;b. Methoden- und Vermittlungsperspektiven;182 18.4;4. Zusammenfassung: Wertebildung interkulturelle Werte bilden;183 19;Erna Zonne: Inklusive Religionspädagogik Grundlegende Werte;185 19.1;1. Einleitung: Inklusion aus pädagogischer Sicht;185 19.2;2. Inklusion interdisziplinär gedacht;186 19.3;3. Inklusion aus religionspädagogischer Sicht;187 19.4;4. Wertorientierte Ausrichtung von inklusiven Bestrebungen;190 19.4.1;4.1 Wertorientierung einer inklusiven Pädagogik;190 19.4.2;4.2 Wertorientierung einer inklusiven Religionspädagogik;190 19.4.3;4.3 Zur Gemeinschaft gehören;191 19.4.3.1;4.3.1 Zugehörigkeit zur Gemeinschaft aus pädagogischer Sicht;191 19.4.3.2;4.3.2 Zugehörigkeit zur Gemeinschaft aus theologischer Sicht;194 19.4.4;4.4 Das Vertrauen etwas aber nicht alles meistern zu können;197 19.4.4.1;4.4.1 Etwas aber nicht alles Meistern aus pädagogischer Sicht;197 19.4.4.2;4.4.2 Etwas aber nicht alles Meistern aus theologischer Sicht;199 19.4.5;4.5 Sinnvolles beitragen wollen;202 19.4.5.1;4.5.1 Aus pädagogischer Sicht: Sinnvolles beitragen wollen;202 19.4.5.2;4.5.2 Sinnvolles Beitragen können theologisc
he Gedanken;202 19.4.6;4.6 Abhängigkeit;204 19.4.6.1;4.6.1 Abhängigkeit aus pädagogischer Sicht;204 19.4.6.2;4.6.2 Abhängigkeit aus theologischer Sicht;205 19.5;5. Religionspädagogischer Ausblick;206 20;Carolin Teschmer: Biblische Texte als Schlüssel zur Werte-Bildung;209 20.1;1. Chancen einer Werte-Bildung im Elementarbereich;210 20.2;2. Werte-Bildung am Beispiel des Parameters Mitgefühl;212 20.2.1;2.1 Mitgefühl als Teil der Empathie und in Abgrenzung zum Mitleid;212 20.2.2;2.2 Gottes Barmherzigkeit als theologischer Ort des Mitgefühls;214 20.2.3;2.3 Die kindliche Entwicklung von Mitgefühl im religiösen Kontext;215 20.3;3. Werte bilden mit biblischen Geschichten;217 20.3.1;3.1 Das kindliche Spiel als subjektorientierter Zugang;217 20.3.2;3.2 Schlüsselfunktionen biblischer Texte zum Mitgefühl;219 20.3.3;3.3 Skizzierung einer empirischen Erhebung am Beispiel des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter (Lk 10, 2537);222 20.4;4. Schlussfolgerung;227 21;Ulrich Kuhnke: Wertebildung durch Kommunikation des Evangeliums. Zur narrativen Grundstruktur christlicher Ethik;231 21.1;1. Zum Ansatz der kognitiven Narratologie;232 21.1.1;1.1 Positioning;233 21.1.2;1.2 Embodiment;234 21.1.3;1.3 Emotionology;235 21.2;2. Zum absoluten Wert der Gottesbeziehung;235 21.3;3. Zur Grundstruktur der Nachfolgepraxis;237 21.3.1;3.1 Lieben;237 21.3.2;3.2 Hören;238 21.3.3;3.3 Beten;239 21.4;4. Besitz und Status als exemplarische Werte;240 21.4.1;4.1 Besitz;241 21.4.2;4.2 Sozialer Status;243 21.5;5. Zur wertebildenden Kommunikation;244 22;Melanie Obraz: Der spezifische Wert ästhetischer Werte;247 22.1;I. Die ästhetische Sichtweise als Tor zur Erkenntnis?;247 22.1.1;1. Das Wahre als ein spezifischer Wert des Ästhetischen;248 22.1.2;2. Eine ästhetisch ausgerichtete Sichtweise, die den Ethikaspekt mit einbezieht und als Grundlage für das Erkennen eines spezifisch ästhetischen Wertes steht;250 22.2;II. Die ästhetische Sichtweise als ein besonderes Verstehen des Alltäglichen;252 22.2.1;1. Die Aufgabe d
es Verweilens;253 22.2.2;2. Die Möglichkeit einer ästhetischen Erkenntnis aus der Mitte;254 22.2.3;3. Die Nützlichkeit einer ästhetischen Wertbestimmung;256 22.3;III. Das Ziel ästhetischen Sehens;257 22.3.1;1. Eine spezifisch ästhetische Wert-Erkenntnis;258 22.3.2;2. Die spezifisch ästhetische Sichtweise als Handlung;260 22.4;IV. Resümee;260 23;Ulrike Graf: Von der Werthaftigkeit des Glücks. Überlegungen zu einer salutogenetischen Orientierung in Unterricht und Lehrerbildung;263 23.1;1.1 Einleitung;263 23.2;1.2 Glück ein ver-messener Begriff?;264 23.3;2.1 Ökonomische und sozialwissenschaftliche Forschung;265 23.4;2.2 Salutogenetisch orientierte Forschungen Erkenntnisse für Lebensführung und professionelles pädagogisches Handeln;267 23.4.1;a. Bedürfnisorientierung;267 23.4.2;b. Das Leben als Kontinuum zwischen Polen;269 23.4.3;c. Aufmerksamkeitssteuerung;270 23.4.4;d. Sinn;274 23.4.5;e. Möglichkeitsorientierung;275 23.5;3. Kritik und Grenzen;276 23.6;4. Glück und salutogenetische Erkenntnisse als Bildungsthemen?;277 23.6.1;4.1 Historische Ankerpunkte;277 23.6.2;4.2 Gesellschaftliche Kontextebedingungen;277 23.6.3;4.3 Konsequenzen für die Gestaltung von Bildungskontexten;279 23.7;5. Eine Seminarkonzeption;281 23.7.1;Evaluation;282 23.8;6. Perspektiven;284 24;Werte-Bildung: ein Ausblick (Martina Blasberg-Kuhnke);285 25;Neuere Literatur zur Weiterarbeit in Auswahl;289 26;Hinweise zu den Autoren und Autorinnen;291
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
19. Juni 2013
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
297
Dateigröße
2,24 MB
Reihe
Werte-Bildung interdisziplinär
Herausgegeben von
Elisabeth Naurath, Martina Blasberg-Kuhnke, Eva Gläser, Reinhold Mokrosch, Susanne Müller-Using
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
ohne Kopierschutz
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783847001300
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Wie sich Werte bilden" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.

















