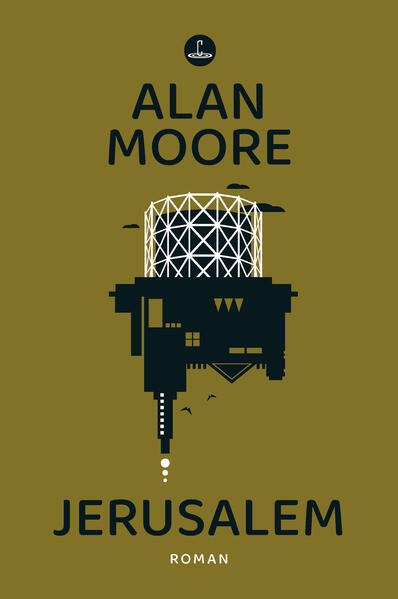
Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Für die Leser:innen von James Joyce, Roberto Bolaño und David Foster Wallace
Der Jahrhundertroman von einem der bedeutendsten Erzähler unserer Zeit
Der Jahrhundertroman von einem der bedeutendsten Erzähler unserer Zeit
Michael Warren kann sich an das wichtigste Ereignis seines Lebens nicht erinnern: Im Alter von drei Jahren verschluckt er ein Hustenbonbon - und droht daran zu ersticken. Zehn Minuten soll er, so heißt es, nicht geatmet haben, und während dieser zehn Minuten wird Michael hinfortgerissen in eine andere Welt, wo er als Ehrenmitglied der 'Bande der Todtoten' zahlreiche fröhliche wie furchterregende Abenteuer erlebt. Dabei erfährt er am eigenen Leibe, dass unsere Vorstellungen von Raum und Zeit, von Leben und Tod kaum an der Oberfläche der Realität kratzen: Unsere Wirklichkeit ist nur die unterste Ebene eines mehrstöckigen Weltengebäudes, das von ganz anderen Gesetzen beherrscht wird als jenen, die wir für unumstößlich halten. Und zwischen diesen höheren Gefilden und Michaels Zuhause in den Boroughs von Northampton besteht eine geheimnisvolle Wechselwirkung . . . Mit Jerusalem hat Alan Moore ein verstörendes, berauschendes Romanepos über die Tragik und das Glück des menschlichen Daseins verfasst, ein Monument, das in seiner brillanten Vielfalt von tiefschürfender Gesellschaftskritik bis zu extravaganter Phantastik alle Register zieht.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
06. November 2024
Sprache
deutsch
Auflage
Deutsche Erstausgabe
Seitenanzahl
1443
Reihe
Carcosa
Autor/Autorin
Alan Moore
Übersetzung
Hannes Riffel, Andreas Fliedner
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
2004 g
Größe (L/B/H)
248/179/66 mm
ISBN
9783910914209
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Ein kontrapunktisch perfekt durchkomponierter Riesenorchester-Roman . . Satz für Satz ein Textkosmos seltsamster Schönheiten. « Dietmar Dath, FAZ
»Jerusalem lässt sich nur aushalten, wenn man sich seinen Exzessen hingibt seiner Getriebenheit, sämtliche Herausforderer hinsichtlich Üppigkeit der Sprache und Weite des Blickfelds zu übertreffen und anerkennt, dass der Roman wirklich so genial ist, wie es den Anschein erweckt. « Douglas Wolk, THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
»Jerusalem lässt sich nur aushalten, wenn man sich seinen Exzessen hingibt seiner Getriebenheit, sämtliche Herausforderer hinsichtlich Üppigkeit der Sprache und Weite des Blickfelds zu übertreffen und anerkennt, dass der Roman wirklich so genial ist, wie es den Anschein erweckt. « Douglas Wolk, THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
 Besprechung vom 30.11.2024
Besprechung vom 30.11.2024
Über die himmlischen und die irdischen Geometrien
Auf die Lektüre dieses Buchs darf man nicht verzichten: Alan Moores gewaltiges Phantastik-Romanepos "Jerusalem" ist nach jahrelanger Übersetzungsarbeit nun endlich auf Deutsch erschienen.
Von Clemens J. Setz
Von Clemens J. Setz
Manchmal scheint mir, als würde der gegenwärtigen Literatur nichts so schmerzvoll fehlen wie ein ausführlich und ehrlich erzähltes Jenseits. Es geht immer so abgekartet diesseitig zu, als gäbe es gar keine Gespenster auf der Erde. Diesem freudlosen Zustand wirkt der nun endlich - nach zweifellos jahrelanger Schwerstarbeit - ins Deutsche übersetzte Riesenroman des bislang eher für seine Comicwerke berühmten Alan Moore mit aller Kraft entgegen.
"Jerusalem" erzählt eine metaphysische Geschichte Northamptons, speziell seines The Boroughs genannten Arbeiterbezirks, der Heimat des Autors. In unermüdlich variierenden Textformen (Young-Adult- Abenteuerroman, Theaterstück, gereimte Ballade, innerer Monolog, Filmerzählung) erläutert Moore die Gebräuche, Regeln und Rituale der verschiedenen Kategorien jenseitiger Wesen und Wohnbereiche und schafft es dabei, auf fast jeder der immerhin 1500 Seiten uns alle möglichen Wunder der Schöpfung vorzuführen, von der Notgeburt eines Kindes auf offener Straße über schmerzhaft durch den Körper eines Gespensts fallenden Regen, über die Phänomene der stereometrischen Verschmelzung verschiedener parallel laufender Biographien bis hin zu den Rändern der Raumzeit und des Denkbaren. Wir werden vom Teufel Asmodeus auf einen gespenstischen Ritt mitgenommen, gehen bei Oliver Cromwell in eine Lehrstunde über Anarchismus, hören theologische Diskussionen zwischen John Bunyan und Samuel Beckett und lernen sogar, was Tauben, diese unauffällig schillernden Stadtwächter, in Wahrheit sind.
Im Zentrum des angenehm uferlosen Erzählgebildes stehen die Geschwister Alma und Michael Warren. Alma ist Malerin und hört eines Tages von ihrem Bruder die Inspiration für eine neue Werkserie. Er könne sich plötzlich wieder an etwas erinnern, das ihm als dreijähriges Kind passiert sei, eine höchst kuriose Sache. Er war damals für mehrere Minuten tot, erstickt an einem Hustenbonbon. Im Krankenhaus konnte man den Jungen glücklicherweise retten, und sein Leben ging normal weiter, bis ins Erwachsenenalter, als ein Unfall mit toxischen Substanzen am Arbeitsplatz die Erinnerungen an das vorübergehende Totsein zurückbrachte. Damals kam er ins "Obergeschoss", einen vierdimensionalen Überbau ihres Heimatbezirks, und traf dort auf berühmte und unbekannte Tote, darunter eine Schar Kinder, die sich die "Bande der Todtoten" (the Dead Dead Gang) nannte. Dass er von diesem Totenreich wieder zurück nach Hause kam, war einem unbegreiflichen Versehen, einer Meinungsverschiedenheit unter den "Bauleuten" (eine Art Engelskaste) zuzuschreiben, die die Geschicke von uns Menschen in endlosen Billardspielen bestimmen.
Dieser eigene kleine Jugendroman in der Mitte des Buches besitzt von allen Teilen den stärksten erzählerischen Rückenwind. Die Schar der aufgeweckten Geisterkinder, deren ungeheuer nahegehende Lebensgeschichten in ausführlichen Porträts vorgestellt werden, gehören zum Hinreißendsten, was ich in den letzten Jahren gelesen habe. Vom "Obergeschoss" aus blickt der verängstigte Michael immer wieder zurück, auf alle Zeitebenen seines Lebens zugleich: "Der mit Gelee überflutete Raum, der so sonderbar wirkte wie ein unentdeckter Planet, war in Wirklichkeit das ihm so vertraute Wohnzimmer, nur irgendwie zu sagenhafter Größe angeschwollen. Die leuchtenden, verdrehten Kristallsäulen, die sich hindurchwanden, waren die Körper seiner Familie, ihre Formen endlos wiederholt und durch den kronleuchterartigen Sirup ihrer Atmosphäre projiziert, ganz so wie Michaels Arme und Beine ausgesehen hatten, als er selbst in der zähflüssigen Leere umhertaumelte. Mit dem Unterschied allerdings, dass sich diese langgezogenen Gestalten nicht bewegten und die Bilder, aus denen sie bestanden, nicht so schlagartig verblassten wie seine überzähligen Gliedmaßen - beinahe als wären Menschen, die noch am Leben waren, zu völliger Reglosigkeit erstarrt und in die geronnene Mandelsulz der Zeit eingetaucht. Zwar dachten sie, sie würden sich bewegen, aber in Wahrheit war das nur ihr Bewusstsein, das als bunte Leuchtkugel die bereits vorhandenen Tunnel ihrer Lebenszeit entlangflatterte. Offenbar wurden Menschen erst dann, wenn sie - wie Michael anscheinend gerade - starben, aus diesem Bernstein entlassen, damit sie prustend und planschend durch den Stundengelee emportauchen konnten."
Michaels Vorfahren stammen aus dem Clan der Vernalls, die alle irgendwelche kuriosen Unfälle an den Grenzbereichen der Wirklichkeit erlitten haben, etwa der Ururgroßvater Ern Vernall, der bei Restaurationsarbeiten an einem Engelsbild von einer jenseitigen Stimme durchdrungen wird, die ihm die geheime Natur des Universums verkündet: Zeit und Raum verlaufen nicht linear, sondern in Form eines Torus. Für den Rest seines Lebens wiederholt der von dieser Einsicht vollkommen überforderte Ern nur noch diesen Begriff. Oder die Großmutter May Warren, die ihre kleine Tochter May an Diphtherie verlor (erschütternd die mehrmals wiederkehrende Beschreibung ihres Abtransports im zum Lazarett führenden "Fieberkarren") und daraufhin den Beruf der "Totenpackerin" (Deathmonger) ergreift, eine für die Boroughs typische Mischung aus Hebamme und Bestatterin, eine Art Begleitfrau für die beiden Enden des Lebens.
Auf die Todesabenteuer des kleinen Michael folgt dann der dritte große Teil, der aus einer Reihe experimenteller Novellen besteht, etwa einer absurden Theaterszene, dem hymnischen Bericht eines Engels über sein liebevoll-indifferentes Verhältnis zu uns Menschen, oder einem ganzen Kapitel in wortspielvernebelter Finnegans-Wake-Traumsprache. Letzteres handelt von Lucia Joyce, Tochter des berühmten James Joyce, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung mehr als dreißig Jahre im St. Andrew's Hospital in Northampton eingesperrt lebte - demselben Krankenhaus, in dem auch, ein Jahrhundert vor ihr, der Dichter John Clare 23 Jahre lang Patient war. Beide, Lucia Joyce und John Clare, geistern im Roman unerlöst durch die Jahrhunderte, immer noch hungrig nach Leben und um Selbsterklärung bemüht. (Direkt neben dem St. Andrew's Hospital befindet sich übrigens die Schule, aus der, der Legende nach, Alan Moore ehedem als Teenager geworfen wurde, weil er an seine Mitschüler LSD verkauft hatte.)
Nicht immer überzeugt Moores sinnliche, vollmundig barocke Prosa mit ihren unzähligen Metaphern. Das hundertste obszöne Wortspiel im Lucia-Kapitel hätte es wirklich nicht gebraucht, ebenso wenig das "Wer träumt hier eigentlich wen?" - Slapstickgeblödel zwischen den Geistern von Samuel Beckett und John Bunyan oder die ausführlich beschriebene Galerie von Almas Gemälden am Ende des Buches, wo jedes einzelne Kapitel des eben gelesenen Buches noch einmal als Gemälde durcherklärt wird. Moore nutzt jeden längeren Dialog für ausführliche Belehrungen über interessante historische Fakten seiner Heimatstadt, und immerhin sind sie das: interessant, auch wenn seine Figuren dafür ständig etwas unmotiviert in lange Monologe ausbrechen müssen. So erfahren wir viel Bedenkenswertes über die Übel des Kapitalismus, über die Behandlung der Arbeiterklasse, über die teuflische Natur einer inzwischen verschwundenen Müllverbrennungsanlage, und wir verzeihen dem Autor selbst die Augenblicke, wo sein Bedürfnis nach Selbstmystifizierung nicht zu unterdrücken war und er seine armen Figuren dazu anhält, seine eigenen Einfälle enthusiastisch und unironisch zu loben.
Sehr vieles im Roman, was auf den ersten Blick überzählig wirkt, erlebt im Verlauf der Geschichte überwältigende motivische Entwicklungen. Wofür, so fragt man etwa, war denn dieses eine frühe Kapitel aus der Sicht des jungen Charlie Chaplin gut? Chaplin stammte aus Lambeth, einem Stadtteil Londons, wo auch ein gewisser Teil der Vernall-Familie herkommt, und er spricht kurz mit einer der Figuren, May Warren, okay, aber danach spielt er keine Rolle mehr. Oder doch? Ja, man muss nur etwas warten und sieht seine Gestalt stückchenweise wiederkehren, etwa als May Warren senior stirbt und ihr letzter Gedanke auf Erden lautet: "Charlie Chaplin! Der Kerl, mit dem ich damals gesprochen habe, das war . . .", und sogar am Ende des Universums selbst, in dem bei Weitem überwältigendsten Kapitel, in dem die zu früh gestorbene May Warren junior (die, ach, im grauenvollen Fieberkarren fortgerissen wurde), von ihrem Großvater auf den Schultern getragen, als Geist durch die Zeit reist. Die beiden wandern durch Millionen von Jahren und erfreuen sich, beim Zusammenstoß der Andromedagalaxie mit unserer Milchstraße, an ganz neuen Hybridsternbildern, darunter: "der kleine Tramp". Ein hinreißender, aufwühlender motivischer Reim. Auch Lucia Joyce, die gelernte Tänzerin, konnte, wie wir erfahren, den Chaplin Walk perfekt imitieren. So entsteht in unzähligen zarten Verbindungslinien das Bild des kleinen Tramps, dieses anmutigsten Gewatschels der Filmgeschichte, als merkwürdig problematische Sehnsuchtsfigur, genährt und umsponnen von den Selbsttröstungsversuchen verlorener und zertretener Menschen zu allen Zeiten.
Es sind buchstäblich Hunderte solcher Wunder und Korrespondenzen, die dieser Roman vor uns aufspannt, darunter vorzüglich grauenhafte Visionen, wie etwa die eines sich durch das "Obergeschoss" bewegenden Geistes, der für immer in genau dem Augenblick und der Form konserviert wurde, in der er zu Lebzeiten am glücklichsten war: mitten in der Explosion durch seinen eigenen Sprengstoffgürtel. Der einstige Selbstmordattentäter schwebt also in einer erstarrten Wolke seiner Einzelteile herum, vollkommen zufrieden. Andere Wunder sind ganz irdische, alltägliche, aber auch sie werden in hingebungsvoller Zeitlupe gefeiert: "Er beobachtet die Tröpfchen auf der jahrhundertealten Fensterscheibe, die leicht grünlich schimmert, studiert die Form der langsam kriechenden Diamanten, ein begeisterter Zuschauer bei einem wässrigen Pferderennen. Einige der windgetriebenen Tropfen scheitern an der ersten Hürde, gelangen nicht ans Ende ihres diagonalen Bahnverlaufs über das Glas, ihre flüssige Substanz schwindet dahin und ist erschöpft, lange bevor sie den verwitterten Holzrahmen erreichen, der ihre Ziellinie ist. Dann gibt es da noch feistere Kügelchen, die gefährlicher und zielstrebiger zu sein scheinen, denn sie schlucken die wässrigen Rückstände ihrer gefallenen Kameraden und rollen, gestärkt und mit frischem Schwung, majestätisch über das funkelnde Feld zu einem mühelosen Sieg."
Alan Moore ist ein swedenborgianischer Claude Simon, der die Erscheinungen der Welt so genau beschreibt, dass man nach der Lektüre vollkommen verwandelt umhergeht und alle Dinge, sogar einige um ein Verkehrsschild versammelte Tauben, mit dem neuen Kennerblick des Eingeweihten betrachtet. Freiwillig auf dieses Leseglück etwa aufgrund der abschreckenden Länge oder aus Scheu vor einigen doch recht dick aufgetragenen Fantasy-Elementen zu verzichten wäre, das muss man deutlich sagen, eine unverzeihliche Eselei.
Alan Moore: "Jerusalem". Roman.
Aus dem Englischen von Andreas Fliedner. Memoranda Verlag, Berlin 2024. 1400 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Jerusalem" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









