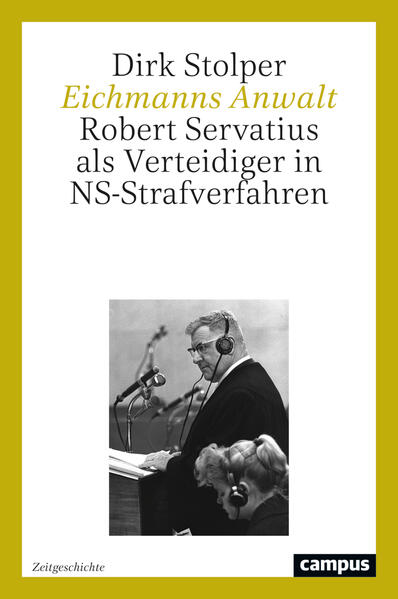
Zustellung: Fr, 02.05. - Mo, 05.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Der Kölner Rechtsanwalt Robert Servatius erlangte 1961 weltweite Bekanntheit: Er verteidigte im Prozess in Jerusalem Adolf Eichmann, der während des Zweiten Weltkriegs aus dem Berliner Reichssicherheitshauptamt die Deportation der europäischen Juden in die deutschen Vernichtungslager im östlichen Europa organisiert hatte. Dirk Stolper untersucht in seiner Studie nicht nur die Biografie und die öffentliche Wahrnehmung von Servatius, sondern beleuchtet insbesondere die von ihm entwickelten und angewandten Verteidigungsstrategien in NS-Prozessen zwischen 1945 und 1975 sowie deren Rezeption in der Öffentlichkeit. Das Buch leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der juristischen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und den NS-Verbrechen, insbesondere der Rolle der Strafverteidiger in diesem Kontext.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
20. Februar 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
498
Reihe
Zeitgeschichte, 3
Autor/Autorin
Dirk Stolper
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
Lesebändchen
Gewicht
710 g
Größe (L/B/H)
216/145/35 mm
ISBN
9783593517131
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Dirk Stolpers kenntnisreiche Studie erlaubt einen kritischen Blick auf diesen wichtigen Strafverteidiger der Bundesrepublik, der dessen Selbstinszenierungen durchschaut, ohne ihn zu vorzuführen. « Daniel Siemens, FAZ, 04. 03. 2025
»Eine fundierte, sorgfältige wissenschaftliche Arbeit [. . .], in der viel Archivarbeit steckt und Dutzende von Regalmetern verarbeitet wurden« Deutschlandfunk, Andruck, 24. 03. 2025
»Eine fundierte, sorgfältige wissenschaftliche Arbeit [. . .], in der viel Archivarbeit steckt und Dutzende von Regalmetern verarbeitet wurden« Deutschlandfunk, Andruck, 24. 03. 2025
 Besprechung vom 04.03.2025
Besprechung vom 04.03.2025
Der Anwalt, der die Nazis verteidigte
Robert Servatius vertrat Adolf Eichmann und ranghohe NS-Funktionäre nach dem Krieg vor Gericht. Früher hatte er ein Faible für die Sowjetunion.
Rechtsanwälte gehören zu den Berufsgruppen, bei denen die Erfolgreichsten in der Regel öffentlich wenig in Erscheinung treten. Anders ist das bei Strafverteidigern mit prominenten Mandanten. Hier gehört lautes Trommeln zum Handwerk. Das Gerichtsverfahren wird zur massenmedial beobachteten Bühne, auf der der Rechtsanwalt auftritt und in vielen Fällen selbst zum Star wird. Das lohnt sich meist auch finanziell.
Bei dem Kölner Rechtsanwalt Robert Servatius war die Sache etwas komplizierter, wie der Historiker Dirk Stolper in der ersten umfassenden Biographie dieses Mannes zeigt. Servatius gehörte im Nachkriegsdeutschland zu den Strafverteidigern, die als Rechtsanwälte hochrangiger Nationalsozialisten bekannt wurden. Beim Internationalen Militärtribunal in Nürnberg 1945/46 vertrat er das Führerkorps der Politischen Leiter der NSDAP sowie Fritz Sauckel, den langjährigen Thüringer Gauleiter. Als "Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz" war Sauckel seit 1942 auch für die Ausbeutung von Millionen Zwangsarbeitern verantwortlich gewesen.
Karrierehöhepunkt Servatius' war der Prozess gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, einen der Hauptorganisatoren des Holocausts, der 1961 in Jerusalem stattfand und international Aufsehen erregte. Stolpers biographische Annäherung, die er als Beitrag zu einer juristischen Zeitgeschichte versteht, liefert erstmals Einblicke in die Sozialisation und die Geschäftspraktiken des prominenten Strafverteidigers. In seinen besten Passagen trägt das Buch zu einer Kultur- und Mentalitätsgeschichte der frühen Bundesrepublik bei.
Nicht kritische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, sondern die Frontstellungen des Kalten Kriegs und die Mentalität der Wirtschaftswunderjahre prägten Servatius' Verteidigungsstrategien, aber auch die politischen Versuche, ihn sich nützlich zu machen. Daran wirkten beim Eichmann-Prozess sowohl der Bundesnachrichtendienst als auch Israels Gegner im Nahen Osten mit. Aber auch der Schweizer Banker, Hitler-Fan und Terrorfinancier François Genoud war beteiligt.
Robert Servatius wurde 1894 in Köln geboren. Sein Vater, Tabakhändler und später Hotelpächter, schickte ihn auf das humanistische Friedlich-Wilhelm-Gymnasium. Mit 19 Jahren wurde Servatius als Freiwilliger Soldat im Ersten Weltkrieg, worüber er später im Stile Ernst Jüngers schrieb: "Nein, ich will nicht beten, dass ich wieder heil zurückkomme, das ist gleichgültig, ich will den Krieg voll erleben." Dieses ambivalente Glück war ihm gleich zweimal beschieden, denn auch am Zweiten Weltkrieg nahm Servatius aus Überzeugung teil, zuletzt im Range eines Majors in der Wehrmacht.
Anfang der Zwanzigerjahre studierte Servatius unter anderem in München und Bonn Jura. Er sympathisierte seinerzeit mit der extremen Rechten um Hermann Ehrhardt, Freikorpsführer und Gründer der Terrorgruppe Organisation Consul (OC). Das Studium schloss er 1925 mit der Promotion ab; im selben Jahr wurde er in seiner Heimatstadt als Rechtsanwalt zugelassen. Seine Praxis kam allerdings nicht in Schwung, sodass der an Fremdsprachen interessierte Servatius sie 1929 aufgab und ein Visum für die Sowjetunion beantragte, aber nicht erhielt. Seit 1931 war er wieder in Köln als Rechtsanwalt tätig. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten sah er als Chance. Für totalitäre Regime und ihre antisemitische Gewalt, so Stolper, sei "der glühende Militarist und Nationalist" Servatius empfänglich gewesen.
Sein anhaltendes Interesse an der Sowjetunion brachte ihm im Mai 1934 allerdings auch ein Ermittlungsverfahren wegen "staatsfeindlicher Betätigung" ein. Servatius' Verhältnis zum Nationalsozialismus blieb auch nach 1945 von Widersprüchen geprägt. Er verteidigte immer wieder hochrangige Nazis, unter anderem im sogenannten Ärzteprozess von 1946/47 Hitlers Begleitarzt Karl Brandt, Generalkommissar für das Sanitäts- und Gesundheitswesen und SS-Gruppenführer. Brandt war einer der Hauptverantwortlichen für die systematische Tötung von mehr als 70.000 Menschen mit Behinderung Anfang der Vierzigerjahre ("Aktion T4"). Das hinderte Servatius nicht daran, mit ihm - wie Stolper schreibt - eine "regelrechte Kampfgemeinschaft" zu bilden. In seinem Schlussplädoyer wiederholte Servatius das zentrale Argument für die vermeintliche Rechtfertigung der Euthanasie-Morde, wie es schon Wolfgang Liebeneiners Film "Ich klage an" von 1941 popularisiert hatte: "Wer wird nicht in gesunden Tagen wünschen, lieber zu sterben, als mit allen Mitteln der Heilkunde gezwungen zu werden, als vertiertes Wesen weiter zu existieren."
Das war mehr als zynisch, denn die Betroffenen hatten ja gerade keinen Todeswunsch vorgebracht, sondern wurden heimtückisch ermordet. Zeigt dieses Argument Servatius' eine ideologische Übereinstimmung mit dem Nationalsozialismus, oder war es nur eine moralisch niederträchtige Taktik in einem aussichtslosen Fall? Stolper wägt ab und trägt Indizien zusammen, ohne sich auf ein eindeutiges Urteil festzulegen. Dem in den Fünfzigerjahren einflussreichen "Heidelberger Juristenkreis", dessen Mitglieder sich für die Freilassung von deutschen Kriegsverbrechern einsetzten, gehörte Servatius, anders als andere Anwälte der Nürnberger Prozesse, nicht an. Aber er zeigte eben auch eine Affinität zu hochrangigen NS-Tätern, die wohl nicht allein mit strategischen Überlegungen eines geschäftstüchtigen Anwalts zu erklären sind.
Im Zentrum des Buches steht der Eichmann-Prozess, bei dem Servatius als einziger Verteidiger auftrat, weshalb ihm die Verteidigungsstrategie unmittelbar zugerechnet werden kann. Stolper hebt die Kontinuitäten hervor: Seit 1945 habe sich Servatius dem "Kampf gegen Nürnberg" und das neue Völkerstrafrecht verschrieben. Seine Argumente blieben über Jahrzehnte die gleichen. Er bezweifelte die Zuständigkeit der Gerichte und machte für seine Mandanten "Befehlsnotstand" geltend. Selbst Eichmann sei nur ein Rädchen im Getriebe gewesen und habe nicht eigenverantwortlich gehandelt.
Über die Rolle des BND im Umfeld des Eichmann-Prozesses ist bereits in den vergangenen Jahren mehrfach berichtet worden. Die Bundesregierung sorgte sich um den gerade erst notdürftig wiederhergestellten Ruf des Landes, da kam eine internationale Diskussion über die Täter des Holocausts zur Unzeit, zumal sie auch engste Mitarbeiter Adenauers wie den ehemaligen NS-Juristen Hans Globke in den Fokus zu rücken drohte. Servatius wurde nicht nur ausspioniert, der BND nahm auch Einfluss auf seine Verteidigungsstrategie. Stolpers nüchterne Rekonstruktion der Geldflüsse und materiellen Vorteile, die zahlreiche Akteure, unter ihnen auch Servatius, aus dem Fall Eichmann zogen, gehört zu den bedrückendsten Passagen dieses Buches.
Schon lange ist bekannt, dass Briefe, Memoiren und Tagebücher von Nazigrößen über Jahrzehnte hinweg international Verkaufsschlager waren. Und dennoch ist man peinlich berührt, wenn man bei Stolper liest, dass jedes Wort des Massenmörders Eichmann Anfang der Sechzigerjahre nach Kräften vermarktet wurde. Die Leiden der Opfer spielten hingegen keine Rolle.
Servatius war sich seiner prominenten Rolle als Strafverteidiger führender Nationalsozialisten sehr bewusst. So sammelte er die Zuschriften an ihn, die 24 Aktenordner füllen und heute im Bundesarchiv verwahrt werden. Auch schrieb er an einer zunächst auf mehrere Bände angelegten Autobiographie, von der jedoch nur ein Teil erhalten und veröffentlicht ist. Das muss man nicht bedauern. Dirk Stolpers kenntnisreiche Studie erlaubt einen kritischen Blick auf diesen wichtigen Strafverteidiger der Bundesrepublik, der dessen Selbstinszenierungen durchschaut, ohne ihn vorzuführen. DANIEL SIEMENS
Dirk Stolper: Eichmanns Anwalt. Robert Servatius als Verteidiger in NS-Verfahren.
Campus Verlag, Frankfurt am Main 2025. 498 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Eichmanns Anwalt" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.






















