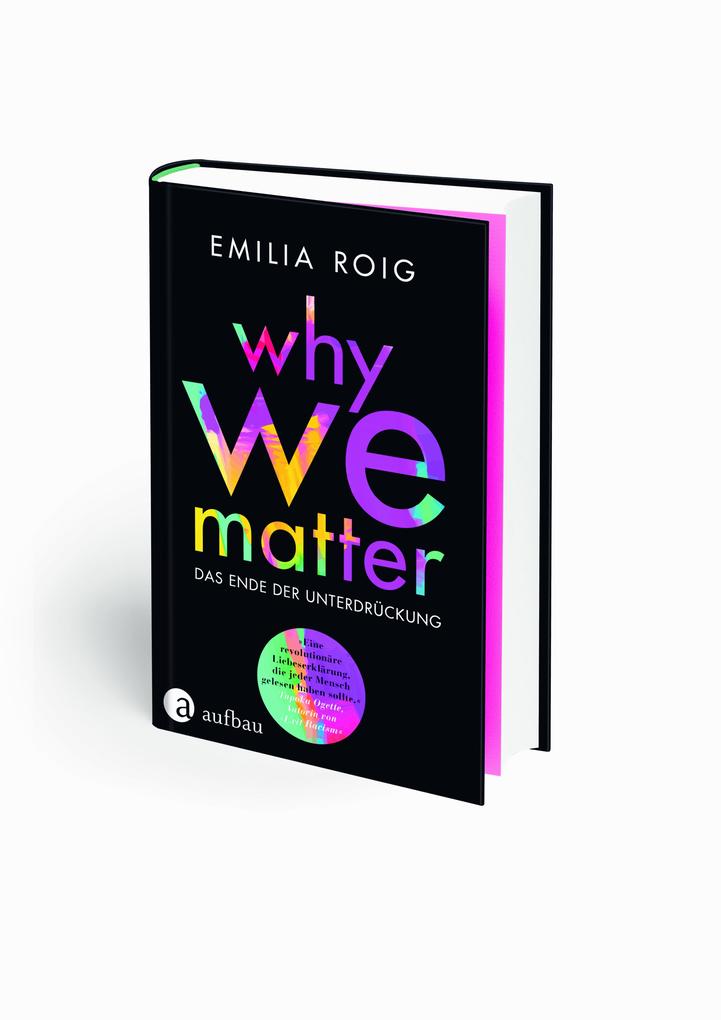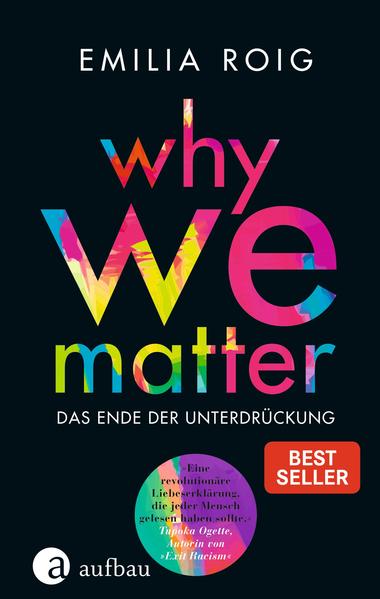
Zustellung: Di, 29.04. - Fr, 02.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Emilia Roig deckt die Muster der Unterdrückung auf - in der Liebe, in der Ehe, an den Universitäten, in den Medien, im Gerichtssaal, im Beruf, im Gesundheitssystem und in der Justiz. Sie leitet zu radikaler Solidarität an und zeigt - auch anhand der Geschichte ihrer eigenen Familie -, wie Rassismus und Black Pride, Trauma und Auschwitz, Homofeindlichkeit und Queerness, Patriarchat und Feminismus aufeinanderprallen.
"Radikal und behutsam zugleich. Dieses Buch ist ein heilsames, inspirierendes Geschenk." Kübra Gümüsay
"Die Antwort auf viele Fragen unserer unsicheren Zeit heißt: Gleichberechtigung aller. Und dieses großartige Buch ist ein Schritt auf dem Weg dahin."
Sibylle Berg
"Dieses Buch wird verändern, wie Sie die Welt wahrnehmen und Sie verstehen lassen, was Gerechtigkeit wirklich bedeutet."
Teresa Bücker
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. Februar 2021
Sprache
deutsch
Auflage
7. Auflage
Seitenanzahl
397
Autor/Autorin
Emilia Roig
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
485 g
Größe (L/B/H)
225/145/34 mm
ISBN
9783351038472
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Dass Emilia Roig einen in seiner Radikalität essentiellen Beitrag zu den Diskriminierungsdebatten dieser Zeitgeschrieben hat, steht außer Zweifel. Er wird es so lange bleiben, bis eine ganze Reihe weiterer Empathielücken geschlossen ist. « Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Emilia Roig gelingt das Kunststück, ein bestürzend dichtes Panorama der Hierarchien, Entwertungen und verweigerten Chancen zu zeichnen, ohne dass es wie eine Abrechnung klingt, sondern stattdessen eher einladend, umarmend. « Süddeutsche Zeitung
»Ein Plädoyer, die Welt neu zu denken. « DIE ZEIT
»Wer sich von Roig über die Wirklichkeit aufklären lässt, findet sich in den künftigenDebatten besser zurecht. « Der SPIEGEL
»Die Autorin, Tochter eines weißen Algeriers mit jüdischem Hintergrund und einer Schwarzen aus Martinique, versucht in ihrem Buch Why We Matter die Unterdrückung von Minderheiten sichtbar zu machen - von Frauen, von People of Colour, von Schwulen, von Menschen mit Behinderung. « RBB Kulturradio
»Mit Why we matter blickt Roig in zahlreiche Bereiche, die bis heute von offenem Rassismus, dürftig verkappter Unterdrückung oder unbewussten Mustern der Diskriminierung geprägt sind. Die knapp 400 Seiten haben viel Potenzial, die Augen von weißen, privilegierten Menschen zu öffnen. « dpa
»Wie kann unsere Welt gerechter werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich Emilia Roig in ihrem neuen Buch Why We Matter . Die Politologin und Aktivistin analysiert darin unterschiedliche Formen von Unterdrückung. « ZEIT online
» Why We Matter ist ein wissenschaftliches Buch, das unbewusste Diskriminierungsmuster aufzeigt - etwa, dass wir uns Übergriffe auf die Körper bestimmter Gruppen erlauben, ohne nachzudenken. « ARD ttt - titel, thesen, temperamente
»Emilia Roig gelingt das Kunststück, ein bestürzend dichtes Panorama der Hierarchien, Entwertungen und verweigerten Chancen zu zeichnen, ohne dass es wie eine Abrechnung klingt, sondern stattdessen eher einladend, umarmend. « Süddeutsche Zeitung
»Ein Plädoyer, die Welt neu zu denken. « DIE ZEIT
»Wer sich von Roig über die Wirklichkeit aufklären lässt, findet sich in den künftigenDebatten besser zurecht. « Der SPIEGEL
»Die Autorin, Tochter eines weißen Algeriers mit jüdischem Hintergrund und einer Schwarzen aus Martinique, versucht in ihrem Buch Why We Matter die Unterdrückung von Minderheiten sichtbar zu machen - von Frauen, von People of Colour, von Schwulen, von Menschen mit Behinderung. « RBB Kulturradio
»Mit Why we matter blickt Roig in zahlreiche Bereiche, die bis heute von offenem Rassismus, dürftig verkappter Unterdrückung oder unbewussten Mustern der Diskriminierung geprägt sind. Die knapp 400 Seiten haben viel Potenzial, die Augen von weißen, privilegierten Menschen zu öffnen. « dpa
»Wie kann unsere Welt gerechter werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich Emilia Roig in ihrem neuen Buch Why We Matter . Die Politologin und Aktivistin analysiert darin unterschiedliche Formen von Unterdrückung. « ZEIT online
» Why We Matter ist ein wissenschaftliches Buch, das unbewusste Diskriminierungsmuster aufzeigt - etwa, dass wir uns Übergriffe auf die Körper bestimmter Gruppen erlauben, ohne nachzudenken. « ARD ttt - titel, thesen, temperamente
 Besprechung vom 19.03.2021
Besprechung vom 19.03.2021
Im Dienst der großen Umwälzung
Alles eine Frage der Macht: Emilia Roig erörtert Gründe und Formen alltäglicher Diskriminierung
Stellen wir uns eine Mutter vor, die ihrem Sohn aus einem Buch vorliest. Der Vielfalt wegen ändert sie beim Lesen hin und wieder Namen und Geschlechter, so auch bei der Geschichte über den sechs Jahre alten Alexander den Großen, der das Pferd Bucephalus zähmt. Die letzte Zeile des Kinderbuches lautet: "Alexander, du wirst Großes vollbringen!" Die Mutter sagt: "Alexandra". Nach einer kurzen Pause will der Sohn wissen, ob es sich bei dem mutigen Kind wirklich um ein Mädchen handle. Aber sicher, sagt die Mutter. "Nicht für mich", urteilt ihr Sohn. "Für mich ist sie ein Junge."
Die Autorin und Aktivistin Emilia Roig beschreibt die Reaktion ihres Sohns als Ausdruck eines inneren Konflikts. Er will sich mit der Heldin identifizieren, aber kein Mädchen sein. Wäre er ein Mädchen, so Roig, und Alexander bliebe ein Junge, hätte das Kind die Frage nach dem Geschlecht mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gestellt. "Nicht nur Mädchen lernen, die Welt aus der Perspektive der Jungen zu betrachten", schreibt Roig. Nichtweiße Menschen lernen, sich in weiße Menschen hineinzuversetzen, Queere in Heteros. Die natürliche Abgrenzung ihres Sohns ist als Empathielücke bekannt. Die Vielfalt der ungleich verteilten Heldengeschichten als Intersektionalität.
Emilia Roig ist mit zwei Geschwistern in einem Pariser Vorort aufgewachsen. Ihre Mutter stammt aus Martinique, ihr Vater ist als Sohn eines Pied-Noir in Algerien geboren. Ihr Alltag, schreibt sie, war von Rassismus geprägt, auch weil die Eltern des Vaters aus der Hautfarbe der Kinder eine Art Fetisch machten und über andere nicht-weiße Menschen herzogen.
Obwohl sie sich schon früh zu anderen Frauen hingezogen fühlte, heiratete Emilia Roig einen Mann: "Seit meiner Kindheit habe ich verinnerlicht, dass Ehe und Kinderhaben keine Optionen sind, sondern unentbehrliche Etappen im Leben, ohne die eine Frau keine Erfüllung erfahren kann." Die Beziehung galt ihr als nötige Bedingung dafür, Mutter zu werden. Für den Erhalt des Gleichgewichts in der Ehe lernte sie, sich ahnungslos zu stellen, sich von ihrem Mann die Welt erklären zu lassen.
Roig ist 37 Jahre alt. Sie hat Jura und Politik studiert, wurde in Berlin promoviert, lehrt an Hochschulen in Frankreich, Deutschland und Amerika postkoloniale Studien, Völkerrecht, Intersektionalität und Critical Race Theory. Bevor sie ankam, wo sie sich jetzt befindet, hat sie unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen gemacht: als Queere, als Schwarze und als Frau. Sie lässt deshalb kein gutes Haar an den Machtmechanismen unserer Welt.
Ihr Buch zu lesen ist ein Test an den eigenen Empathielücken. Für eine heterosexuelle, weiße Leserin beginnt die Identifikation dort, wo Roig von den Erwartungen an sie als junge Frau berichtet, und endet mit ihrer Auflehnung gegen stereotype partnerschaftliche Rollen. Dann liest man von der Abwertung von Weiblichkeit, auf der Trans- und Homofeindlichkeit basierten, von der Hierarchie zwischen zwei konstruierten Geschlechtern, von unbewussten Vorurteilen.
Die Autorin führt ein Beispiel nach dem anderen an, wie etwa während des vierstündigen Urteilsspruchs nach den NSU-Morden und auf dreitausend Seiten Urteil kein Satz für die Familien der Opfer fiel. Nun, schreibt sie, werde sie die sozialen Hierarchien aufdecken, die dafür gesorgt haben, dass die Realität der einen als spezifisch und die der anderen als universell betrachtet werde.
Die Dichte, die Beweisführung, der instruktive Ton: "Why We Matter" ist eine anstrengende Lektüre. Wem gilt all das, denkt man, legt das Buch weg, fühlt sich belehrt: Sogar am Wohlfühlfilm "Ziemlich beste Freunde" hat Roig etwas auszusetzen. Alle Klischees über Klasse, Behinderung und schwarze Männer würden darin bedient, und eben weil er gesellschaftliche Ordnung erhält, berühre der Film so sehr.
Dann nimmt man das Buch doch wieder zur Hand und liest weiter, von der Angst der Privilegierten, sich eingestehen zu müssen, dass nicht alles in ihrem Leben durch Talent und harte Arbeit erkämpft ist, sondern Konsequenz einer gesellschaftlichen Bevormundung. Für diejenigen, bei denen solche Sätze ein Frösteln auslösen, für die Wegleger und Weiterleser, schreibt sie, und sie dürften in der Mehrzahl sein.
Roig greift ins Herz des Bildungssystems und zerrt an ihm. Sie beklagt das Fehlen postkolonialer und anderer kritischer Studien im Lehrplan, in der Literatur und Philosophie, vermisst eine weitere, nicht von weißen europäischen Männern artikulierte Perspektive auf die Welt. Warum lernten Kinder in Martinique und Guadeloupe alles über das europäische Mittelalter und nahezu nichts von der Sklaverei und der kolonialen Vorgeschichte ihrer Inseln? Bis der Löwe aus seiner Perspektive erzählt, so laute ein Sprichwort aus Simbabwe, werde die Erzählung von der Jagd immer den Jäger verherrlichen.
Im Dienst der gesellschaftlichen Umwälzung geht Roig sehr weit. Auch die im Verlauf der "Black Lives Matter"-Proteste entstandene Debatte über die Abschaffung der Polizei soll an dieser Stelle geführt werden, die Annahme entlarvt, Kriminalität habe mit mangelnder Disziplin und Pathologie zu tun. Wenn es heißt, New York sei sicherer geworden, bedeute das nicht Sicherheit für alle.
Ob die Entfernung des Räderwerks aber die Arbeit einer stinkenden alten Maschine verbessert? Es wäre Zündstoff für ein neues Buch. Und wenn sie anführt, die von ihr erklärte Ausnahmebehandlung der Schoa liege darin begründet, dass es sich um ein Verbrechen gegen weiße Menschen handle (hier sucht Roig Zuflucht in einem Zitat von Aimé Césaire), was wiederum eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Rassismus in Deutschland verhindere, hat das Frösteln einen anderen Ursprung. Dass Emilia Roig einen in seiner Radikalität essentiellen Beitrag zu den Diskriminierungsdebatten dieser Zeit geschrieben hat, steht außer Zweifel. Er wird es so lange bleiben, bis eine ganze Reihe weiterer Empathielücken geschlossen ist.
ELENA WITZECK.
Emilia Roig: "Why We Matter".
Das Ende der Unterdrückung.
Aufbau Verlag, Berlin 2021. 397 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 11.02.2025
Wenn man bereit ist, Dinge über Diskriminierung zu lernen, ist man bei diesem Buch richtig!
am 27.01.2025
Why we matter: Unterdrückung sichtbar machen
In ihrem Buch Why we matter: Das Ende der Unterdrückung zeigt Emilia Roig die Muster der Unterdrückung auf, die es in den verschiedensten Bereichen gibt, sei es in der Liebe/der Ehe, an den Universitäten, in den Medien, im Gerichtssaal, im Beruf, im Gesundheitssystem und in der Justiz. Dazu gibt sie viele Beispiele aus ihrem eigenen Leben, geht sehr ins Persönliche; gleichzeitig sind es Themen, die viele Menschen betreffen und uns alle angehen sollten. Es werden auch viele unbewusste Diskriminierungsmuster aufgezeigt und kann bzw. sollte verändern, wie wir die Welt wahrnehmen.
Das Buch ist ein Schritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung ALLER
Das Buch hat mich total begeistert! Emilia Roig schreibt sehr gut und klug, ich konnte das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen - unbedingt lesen!
Die vielfältigen Themen wie (Alltags-)Rassismus, Benachteiligung von Frauen, Flüchtlingen und Minderheiten gehen uns ALLE an! Das Buch sollte Pflichtlektüre werden!
"Warum fällt es uns heute so schwer, die Menschheit als eine kollektive Entität zu betrachten? Warum halten wir an der Idee fest, dass jede*r von uns vom Rest der Menschheit abtrennbar ist? Jede*r von uns ist der*die andere*. Jede Seele ist die Widerspiegelung von anderen Seelen."
"Das weibliche Schönheitsideal ist die gesellschaftlich konstruierte Vorstellung, das körperliche Attraktivität eines der wichtigsten Vermögen der Frauen ist, und etwas, dass alle Frauen anstreben und erhalten sollten."
"In einer Gesellschaft, die uns ständig sagt, dass wir nicht "genug" sind, ist uns selbst zu lieben revolutionär. Jede* r- Einzelne* von uns wurde genauso geboren, wie sie*er sollte. Wir sind alle perfekt, genug und liebenswert, wie wir sind. Wenn wir verstehen, dass unser Wert nicht von außen definiert werden kann, sind wir auf dem Weg der Heilung. Uns selbst zu definieren in einer Welt, die darauf besteht, uns in vorgefasste Rollen zu pressen, ist an sich subversiv. Selbstliebe braucht Zeit, Hingabe und Arbeit, und sie ist unsere größte Stärke und Waffe gegen Unterdrückung, denn wenn wir erkennen, was in uns liebenswert ist, erkennen wir die Liebe in der Menschheit als Ganzes und können unsere Verbindung mit anderen auf der Welt vertiefen."
"Alles ist eine Frage der Perspektive. Ein kollektiver Bewusstseinswandel ist möglich, hin zu mehr Verbindung, mehr Einheit, mehr Empathie und schließlich mehr Liebe."