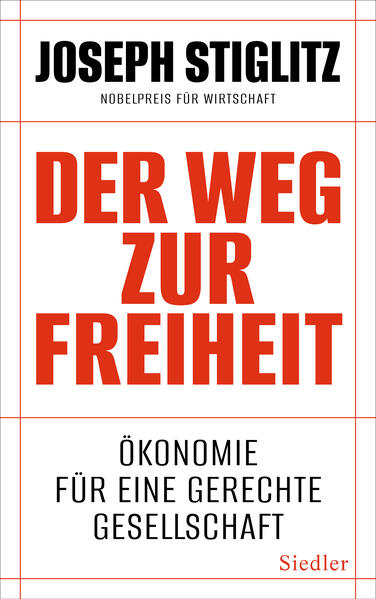
Zustellung: Fr, 02.05. - Mo, 05.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Gegen die Freiheit des Raubtierkapitalismus: Warum unsere Gesellschaft eine neue Wirtschaftspolitik braucht, um zukunftsfähig und gerechter zu werden
Unter Donald Trump und Elon Musk greift ein Kult der Freiheit um sich. Doch die Wahl- und Meinungsfreiheit, die J. D. Vance & Co. zu einem Fetisch erhoben haben, geht immer auf Kosten der Freiheit anderer. Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger und einer der schärfsten Kritiker Donald Trumps, zeigt, wer die Opfer der neuen Meritokratie sind - und wie der Abbau von Bürokratie sowie unregulierte Märkte Wachstum bremsen und unsere Gesellschaften ärmer machen. Doch Stiglitz bleibt nicht bei der Analyse stehen, sondern weist uns den Weg, wie wir das Konzept der Freiheit zurückerobern können. Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine gleichermaßen gerechtere wie freiere Welt.
Unter Donald Trump und Elon Musk greift ein Kult der Freiheit um sich. Doch die Wahl- und Meinungsfreiheit, die J. D. Vance & Co. zu einem Fetisch erhoben haben, geht immer auf Kosten der Freiheit anderer. Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger und einer der schärfsten Kritiker Donald Trumps, zeigt, wer die Opfer der neuen Meritokratie sind - und wie der Abbau von Bürokratie sowie unregulierte Märkte Wachstum bremsen und unsere Gesellschaften ärmer machen. Doch Stiglitz bleibt nicht bei der Analyse stehen, sondern weist uns den Weg, wie wir das Konzept der Freiheit zurückerobern können. Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine gleichermaßen gerechtere wie freiere Welt.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Mai 2025
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
480
Autor/Autorin
Joseph Stiglitz
Übersetzung
Thorsten Schmidt
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
664 g
Größe (L/B/H)
218/146/48 mm
ISBN
9783827501998
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 06.01.2025
Besprechung vom 06.01.2025
Ein starker Staat
Stiglitz' Antithese zu Hayek und Friedman
Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz gilt als Ikone der Kapitalismuskritik, er ist Professor an der Columbia University in New York, war früher Chefökonom der Weltbank und Vorsitzender der Wirtschaftsberater unter US-Präsident Clinton. Sein neues Buch knüpft an seine bisherigen Bestseller an, bei denen es um Marktversagen durch Informationsasymmetrien, die "Schatten der Globalisierung" (2002) oder auch den "Preis der Ungleichheit" (2012) und die zunehmende Spaltung der Gesellschaft geht. Das Buch spricht wieder ein breites Publikum an, auch wenn Grundkenntnisse der Ökonomie einschließlich der prägenden Kontroverse zwischen Keynes und Hayek und der Entstehung und Funktionsweise von IWF, Weltbank und WTO hilfreich sind. Der Buchtitel ist eine Anspielung auf Hayeks "Weg zur Knechtschaft", und nicht überraschend befasst sich der Autor ausführlich mit der Chicago-Schule, mit Hayek und Friedman. Dabei steht der Freiheitsbegriff im Zentrum. Im Grunde formuliert Stiglitz die Antithese zu Hayeks Werk: Nicht zu viel Staat führe zu Unfreiheit, sondern zu wenig Staat.
Es erscheint wichtig, Stiglitz' Terminologie zu verstehen, die sich an dem orientiert, was in den USA (heute) üblich ist, zum Beispiel die Gleichsetzung von "links" oder "progressiv" mit "liberal". Allerdings setzt Stiglitz auch eigene Akzente, wenn er die Begriffe neoliberal, libertär, (neo-)konservativ und "rechts" fast schon als Synonyme vorstellt, wodurch auch inhaltliche Unterscheidungen ein Stück weit verloren gehen. Dieser Aspekt dürfte eine besondere Rolle spielen, wenn das Buch, das bisher nur auf Englisch vorliegt, ins Deutsche übersetzt wird (der Siedler Verlag plant für Mai eine deutsche Ausgabe). Hierzulande wird der Begriff Neoliberalismus immer noch unterschiedlich verwendet, traditionell als Gegenbegriff zum Laissez-faire-Liberalismus, zunehmend aber - wie bei Stiglitz - auch als Synonym für kaltherzigen ungebremsten Kapitalismus.
Jenseits der Terminologie: Nach Stiglitz war es das Erkenntnisinteresse Hayeks und Friedmans, freie Märkte und die daraus resultierende Macht-, Einkommens- und Vermögensverteilung zu verteidigen. "Sie versuchten nicht, zu verstehen, wie der Kapitalismus tatsächlich funktioniert." Ihre dazu passende Grundthese ist die überlegene Effizienz freier Märkte (Stiglitz verwendet häufig den Begriff "unfettered", also "entfesselt"), auf denen Wettbewerb herrscht und freie Individuen freie Konsum- und Produktionsentscheidungen treffen. Gestützt werde diese These, zumindest bei Friedman, letztlich auf unrealistischen Annahmen. Im Ergebnis werde ein Staat gefordert, der sich im Wesentlichen auf das Funktionieren der freien Märkte beschränke. Krisen sind dabei in der Regel das Ergebnis von Staatsversagen.
Es kann dahingestellt bleiben, inwieweit diese Darstellung überzieht, insbesondere im Hinblick auf Hayeks Marktprozesstheorie, welche die Notwendigkeit freier Märkte bekanntlich differenziert begründet (Stichwort: Verwertung von Wissen). Entscheidend ist Stiglitz' Feststellung, dass die Konzepte von Hayek und Friedman äußerst wirkmächtig sind und seit den Achtzigerjahren die wirtschaftspolitische Agenda prägen, obwohl sie laut Stiglitz national und international (Stichwort: Washington Consensus) nicht funktionierten: Die Deregulierung der Finanzmärkte habe zur größten Finanzkrise in einem Dreivierteljahrhundert geführt, die Deregulierung des Außenhandels zur Beschleunigung der Deindustrialisierung und die Befreiung der großen Unternehmen zur Ausbeutung der Konsumierenden, der Arbeitenden und der Umwelt gleichermaßen. Die größere Ungleichheit habe den Boden bereitet für den gefährlichen Aufstieg der Rechtspopulisten.
Stiglitz' an Rawls angelehnter Gegenentwurf beginnt mit seinem Freiheitsbegriff, der verbunden ist mit der Vorstellung von Fairness und Gerechtigkeit und auf der Einsicht gründet, dass die Freiheit einer Person oft die Unfreiheit einer anderen bedeutet. Der Staat habe die Pflicht, im Interesse des Gemeinwohls Zielkonflikte zu erkennen und abzuwägen und Freiheiten der einen Gruppe zugunsten anderer einzuschränken. Zum Beispiel die Freiheit der Waffenbesitzer. Negative externe Effekte, wie zum Beispiel Treibhausgasemissionen, müssten durch geeignete Regulierung, also durch Markteingriffe, korrigiert werden. Im Ergebnis fordert Stiglitz einen starken Staat, der Chancengleichheit herstellt, anstatt sie zu behaupten. Krisen seien in der Regel das Ergebnis von Marktversagen.
Stiglitz bleibt nicht auf der abstrakten Ebene. Im Schlusskapitel folgt eine mehrseitige Tabelle, die wichtige Fälle des Marktversagens auflistet. Stiglitz befürwortet einen "progressiven Kapitalismus", der einer europäisch sozialdemokratischen Agenda ähnelt. Dabei wird deutlich, dass er bei aller Fundamentalkritik den Kapitalismus und die Marktwirtschaft nicht abschaffen, sondern verbessern will. Seine Agenda ist in den USA und erst recht in Europa grundsätzlich immer noch mehrheitsfähig und teilweise umgesetzt, trotz der Trumps und Orbáns. Freilich sind weder Trump noch Orbán Neoliberale, sondern Rechtspopulisten, sodass Stiglitz' Auseinandersetzung mit dem (verkürzten) Neoliberalismus etwas überholt wirkt. Wichtige Fragen sind nicht ausreichend beantwortet, zum Beispiel: Was bedeutet es, dass auch die Rechtspopulisten für die heimische Deindustrialisierung freie und offene Märkte verantwortlich machen? Gibt es gar einen gemeinsamen Nenner mit ihnen: noch mehr Zölle und Protektionismus? JOACHIM RÜCKER
Joseph E. Stiglitz: The Road to Freedom - Economics and the Good Society. Allen Lane, New York 2024, 384 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Der Weg zur Freiheit" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









