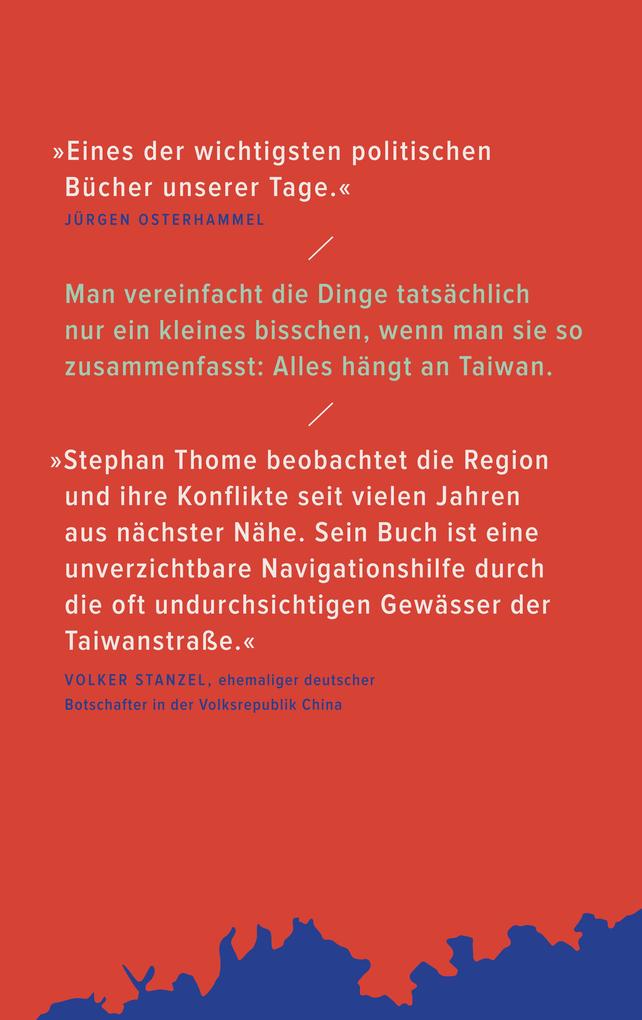Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Man vereinfacht die Dinge tatsächlich nur ein kleines bisschen, wenn man sie so zusammenfasst: Alles hängt an Taiwan.
Es ist ein Konflikt, der die Welt in Atem hält: Die kommunistische Führung in Peking betrachtet Taiwan als »abtrünnige Provinz«, die mit dem Mutterland vereinigt werden muss. Taipeh wiederum will seine faktische Unabhängigkeit und die hart erkämpfte Demokratie bewahren. Als führender Chip-Hersteller und aufgrund seiner Lage im westlichen Pazifik besitzt der Inselstaat zudem eine enorme Bedeutung für die Rivalität zwischen der Volksrepublik China und den USA. Nirgendwo ist eine direkte Konfrontation der beiden Supermächte wahrscheinlicher als in der Taiwanstraße.
Stephan Thome, einer der besten deutschen Taiwan-Kenner, beleuchtet in seinem hochaktuellen Buch die Hintergründe dieses Konflikts, die in der medialen Berichterstattung meist zu kurz kommen. Er zeigt, warum Taiwans Geografie so wichtig ist und was aus ihr für eine mögliche militärische Auseinandersetzung folgt. In großen historischen Bögen erläutert er, wie Chinas Selbstverständnis als alte und neue Weltmacht, aber auch die amerikanische Bündnispolitik im Pazifik zur heutigen Situation beigetragen haben. Der Kampf um Taiwan hat längst begonnen und betrifft uns in Europa viel stärker, als wir glauben.
»Ich will Leserinnen und Lesern helfen, den Konflikt in der Taiwanstraße besser zu verstehen . . . Die aktuellen Spannungen resultieren aus historischen Entwicklungen, politischen Interessen und nationalen Pathologien, die in Deutschland nur zum Teil als bekannt gelten dürfen. Sie offenzulegen, ist das Hauptanliegen meines Buches. «
»Eines der wichtigsten politischen Bücher unserer Tage. « Jürgen Osterhammel, Historiker
Nominiert für den NDR Sachbuchpreis 2024
Produktdetails
Erscheinungsdatum
09. September 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
366
Autor/Autorin
Stephan Thome
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
Mit Abbildungen
Gewicht
510 g
Größe (L/B/H)
217/144/32 mm
ISBN
9783518432044
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»[Eine] brillante Analyse . . . Auf ein Buch wie [Thomes] hat man dringend gewartet, es sei der deutschen Öffentlichkeit zur umgehenden Lektüre ans Herz gelegt. « Kai Strittmacher, Süddeutsche Zeitung
»Das Buch ist allen zu empfehlen, die den Konflikt in seinem historischen und politischen Zusammenhang verstehen wollen. « Mark Siemons, Frankfurter Allgemeine Zeitung
». . . ein brillantes Werk. « Mariam Lau, DIE ZEIT
»Thomes faktenreiches, spannend und zugänglich geschriebenes Buch bietet einen guten Einstieg, um die verwickelte Vorgeschichte und den Verlauf des Konflikts in der Taiwanstrasse besser zu verstehen. « Thomas Wagner, Neue Zürcher Zeitung
»Eine umsichtigere, präzisere, reflektiertere Darstellung wird man kaum finden. « Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
»Kaum ein Deutscher kennt Taiwan so gut wie Stephan Thome. « Der Tagesspiegel
»Das Buch wird auch in Zukunft eine erhellende Hintergrundanalyse sein. « Till Schmidt, Mare
»Das Buch ist allen zu empfehlen, die den Konflikt in seinem historischen und politischen Zusammenhang verstehen wollen. « Mark Siemons, Frankfurter Allgemeine Zeitung
». . . ein brillantes Werk. « Mariam Lau, DIE ZEIT
»Thomes faktenreiches, spannend und zugänglich geschriebenes Buch bietet einen guten Einstieg, um die verwickelte Vorgeschichte und den Verlauf des Konflikts in der Taiwanstrasse besser zu verstehen. « Thomas Wagner, Neue Zürcher Zeitung
»Eine umsichtigere, präzisere, reflektiertere Darstellung wird man kaum finden. « Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
»Kaum ein Deutscher kennt Taiwan so gut wie Stephan Thome. « Der Tagesspiegel
»Das Buch wird auch in Zukunft eine erhellende Hintergrundanalyse sein. « Till Schmidt, Mare
 Besprechung vom 20.12.2024
Besprechung vom 20.12.2024
Von rohen, gekochten und zugezogenen Einwohnern
Identität beantwortet nicht die Frage, wer jemand ist, sondern wie jemand sich selbst sieht und von anderen gesehen werden will: Stephan Thome geht den Hintergründen des Konflikts zwischen Taiwan und China auf den Grund.
Taiwan, eine Insel von der Größe Baden-Württembergs, ist der wahrscheinlichste Ort, an dem sich die zunehmenden Spannungen zwischen den Supermächten China und USA in einem großen Krieg entladen könnten. Worum es da eigentlich geht, erläutert jetzt ein umsichtiges und tief in die Geschichte ausgreifendes Buch des in Taipeh lebenden deutschen Schriftstellers Stephan Thome. Schon in seinem jüngsten Roman, "Pflaumenregen", hatte er sich auf die verwickelten historischen Konstellationen der Insel eingelassen. In dem langen Essay "Schmales Gewässer, gefährliche Strömung" geht es ihm nun darum, die Kategorien, um die zwischen den Mächten gestritten wird, von innen her verständlich zu machen. In immer neuen Anläufen umkreist er die japanische Kolonialzeit, den chinesischen Bürgerkrieg, die Wandlungen der Volksrepublik einerseits und Taiwans andererseits sowie die aktuellen geopolitischen Frontstellungen.
Was ist der Kern des Konflikts? Im Mittelteil seines Buchs weist Thome auf zwei Begriffe hin, deren Mehrdeutigkeit sich fatal auswirkt: Nation und Identität. Laut der Ein-China-Doktrin der Volksrepublik hat Taiwan immer schon zur chinesischen Nation gehört, weshalb Xi Jinpings Programm einer "großen Wiederauferstehung der chinesischen Nation" ohne die Einholung der Insel in den Pekinger Herrschaftsbereich unvollständig bleibe. Thome legt nun dar, warum diese Behauptung in mehrfacher Hinsicht ahistorisch und anachronistisch ist. Bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts spielten für China Vorstellungen von einem Nationalstaat mit eindeutigen Grenzen zu anderen Nationalstaaten gar keine Rolle. China war ein Imperium mit fließenden, im Lauf der Geschichte immer wieder stark veränderten Rändern, das seine Einheit vor allem kulturell herleitete, als eine potentiell "alles unter dem Himmel" umfassende Zivilisation, deren Ränder mit wachsender Entfernung zur Mitte immer weiter ins "Barbarentum" übergingen.
Das betraf sogar das Selbstbewusstsein der Angehörigen dieses Reichs, wie Thome mit einer sprechenden Anekdote klarmacht: "Als der portugiesische Glücksritter Galeote Pereira Mitte des 16. Jahrhunderts in einem Gefängnis in der Küstenstadt Fuzhou landete, überraschte er seine Mitgefangenen mit der Mitteilung, sie seien 'Chinesen'. Von dieser Bezeichnung hatten sie nie gehört. Sie selbst bezeichneten sich als da ming ren: Untertanen der großen Ming."
Es ist daher grundsätzlich problematisch, heutige nationalstaatliche Kategorien auf frühere Verhältnisse zurückzuprojizieren und umgekehrt aus früheren Tributbeziehungen und Zusammengehörigkeitsgefühlen einen heutigen völkerrechtlichen Anspruch abzuleiten. Die Insel wurde schon vor unserer Zeitrechnung in mehreren Schüben von Han-Chinesen besiedelt, doch erst 1684 wurde sie formell dem chinesischen Reich eingegliedert.
Nach dem verlorenen chinesisch-japanischen Krieg kam Taiwan 1895 unter die Herrschaft Japans, und nach der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg fiel es wieder an die "Republik China" zurück, worauf sich die im Bürgerkrieg geschlagenen Kuomintang-Truppen Tschiang Kai-scheks 1949 dorthin flüchteten und mit dem Anspruch, ganz China zu repräsentieren, eine Militärdiktatur errichteten. 1971 verlor die "Republik China" jedoch ihren Sitz bei den Vereinten Nationen, und 1987 setzte eine Demokratisierung ein, in deren Folge die Kuomintang nur noch eine Partei unter anderen wurde.
Thome leitet aus dem anachronistischen Gebrauch des Nation-Begriffs nun ab, dass die Ansprüche Pekings auf Taiwan schon deshalb auf tönernen Füßen stünden, weil die Insel niemals zur Volksrepublik, sondern zum Qing-Reich gehört habe und später allenfalls zur "Republik China" der Kuomintang. Doch eine solche Argumentation verkennt etwa, dass China mit diesem Problem der völkerrechtlichen Ansprüche aus vornationalen Verhältnissen nicht allein dasteht.
Der Übergang in der Verfasstheit der Staatsgebilde schafft an vielen Orten Uneindeutigkeiten, die der Aushandlung bedürfen. Auch kommt der entstehende chinesische Nationalismus bei Thome etwas zu schlecht weg. Davon abgesehen, dass er erst mal eine Nachahmung der europäischen Verhältnisse war, war er für die jungen chinesischen Rebellen etwa der 4.-Mai-Bewegung von 1919 auch ein Medium der Modernisierung und der Reform. Interessant ist allerdings, dass der Anspruch auf Taiwan keineswegs immer mit der heutigen Vehemenz erhoben wurde, wie Thome mit vielen Beispielen belegt. Noch 1936 hatte Mao etwa dem amerikanischen Journalisten Edgar Snow gesagt, das Ziel des Befreiungskampfs sei, Taiwan in die Unabhängigkeit zu entlassen.
Zugleich ist die Insel ein Exempel dafür, welche politische und sogar geopolitische Bedeutung einer kollektiven "Identität" und deren Wandlungen zukommen kann. Thome zeichnet die Entwicklungen minutiös nach. Taiwans Ureinwohner wurden im 17. Jahrhundert von den chinesischen Siedlern in "rohe" und "gekochte" eingeteilt und auf diese Weise in das konfuzianische Schema integriert, das verschiedene Kultivierungsstufen von der chinesischen Kernzivilisation bis zur Barbarei vorsieht. Die Einwanderer waren ihrerseits auch nicht einheitlich, die meisten kamen aus der der Insel gegenüberliegenden Provinz Fujian, manche aber gehörten auch zur Volksgruppe der Hakka aus Guangdong.
Die japanische Kolonialherrschaft stärkte auf der einen Seite das Zusammengehörigkeitsgefühl der chinesischen Bevölkerungsteile, auf der anderen förderte die in dieser Zeit vorangetriebene Modernisierung bei manchen auch eine Identifizierung mit dem Besatzer. 1949 begann mit der Flucht der Kuomintang-Truppen auf die Insel eine Phase der erzwungenen Sinisierung: Die "Republik China" sollte mit ihrem Anspruch, das ganze Land zu vertreten, chinesischer als China sein. Als die Diktatur mit der Aufhebung des Kriegsrechts 1987 ein Ende fand, traten wieder die unterschiedlichen Herkünfte ins Bewusstsein, und im Lauf der Jahrzehnte bestimmte immer stärker eine Identitätsdebatte die Politik.
Mittlerweile hat die Demokratisierung den taiwanischen Diskurs weitgehend aus den traditionellen ethnischen Zuschreibungen herausgelöst: "Identität beantwortet", so formuliert es Thome, "nicht die Frage, wer jemand ist, sondern wie jemand sich selbst sieht und von anderen gesehen werden will." Dieses Selbstbestimmungskonzept steht nun aber in direktem Gegensatz zur Position Pekings, die die han-chinesische Ethnie, die kulturelle Tradition und die nationale Identität umstandslos in eins setzt.
Neben den gegensätzlichen geopolitischen Interessen ist es daher nicht zuletzt der konträre Gebrauch der Begriffe, der die Vermeidung eines großen Krieges so kompliziert macht. Und der Faktor Trump trägt auch nicht eben zur Vereinfachung der Lage bei. Dem Plädoyer des Autors für den Status quo Taiwans als eines zwar formal nicht unabhängigen, aber doch faktisch eigenständigen Gemeinwesens kann man daher nur zustimmen. "Etwas Besseres als diesen werden wir auf absehbare Zeit nicht bekommen", schreibt Thome. "Umstritten, fragil und gefährdet, macht der Status quo zwar niemanden wunschlos glücklich, aber immerhin fordert er von allen Beteiligten nur Mäßigung, Fingerspitzengefühl und Geduld, keine Menschenleben." Das Buch ist allen zu empfehlen, die den Konflikt in seinem historischen und politischen Zusammenhang verstehen wollen. MARK SIEMONS
Stephan Thome: "Schmales Gewässer, gefährliche Strömung". Über den Konflikt in der Taiwanstraße.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2024. 366 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.