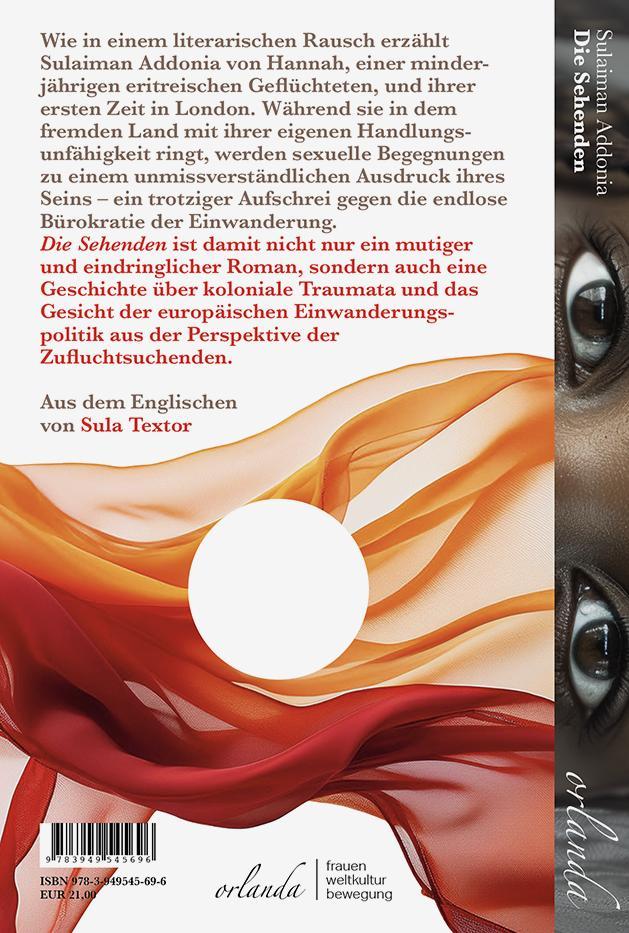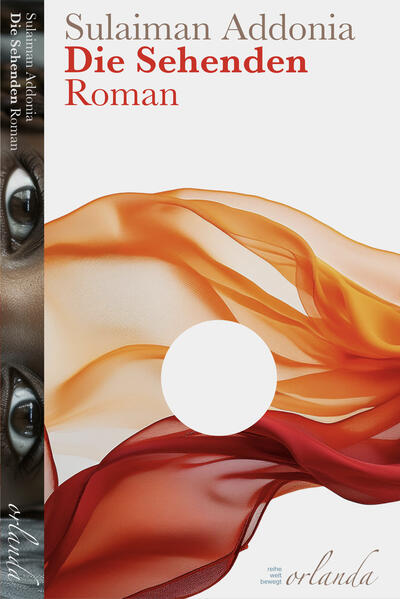
Zustellung: Di, 29.04. - Fr, 02.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Ein literarischer Rausch - der neue Roman von Sulaiman Addonia
Das mutige Ausloten eines Lebens am Rande der Gesellschaft und die Bedeutung von Sexualität
Wie in einem literarischen Rausch erzählt Sulaiman Addonia die Geschichte von Hannah, einer minderjährigen eritreischen Geflüchteten, und ihrer ersten Zeit in London. Während sie in einem fremden Land mit ihrer eigenen Handlungsunfähigkeit ringt, werden sexuelle Begegnungen zu einem unmissverständlichen Ausdruck ihres Seins - ein trotziger Aufschrei gegen die endlose Bürokratie der Einwanderung. Eindimensionalen Erzählungen über Flucht, Trauma und einem Leben am Rande der Gesellschaft setzt Addonia eine unkonventionelle, vielschichtige Protagonistin entgegen, die ihren Platz in der Welt sucht.
»Die Sehenden« ist ein mutiger, eindringlicher Roman, der Psyche und Sexualität seiner Figuren auf unvergleichliche Weise entschlüsselt. Eine Geschichte über Vergangenheit und Gegenwart, generationsübergreifende Lebenserfahrungen, koloniale Traumata und das reale Gesicht der europäischen Einwanderungspolitik sowie ihre Auswirkungen auf Zufluchtssuchende
.»In Die Sehenden nimmt uns Sulaiman Addonia mit in eine ebenso bezaubernde wie raue Welt, in der sich Sehnsüchte und Erinnerungen überschneiden. Wie fesselnd und elegant und ergreifend und witzig und voller Vitalität! Und was für eine Fülle von Bildern! Absolute Weltklasse. « Peter Verhelst
Das mutige Ausloten eines Lebens am Rande der Gesellschaft und die Bedeutung von Sexualität
Wie in einem literarischen Rausch erzählt Sulaiman Addonia die Geschichte von Hannah, einer minderjährigen eritreischen Geflüchteten, und ihrer ersten Zeit in London. Während sie in einem fremden Land mit ihrer eigenen Handlungsunfähigkeit ringt, werden sexuelle Begegnungen zu einem unmissverständlichen Ausdruck ihres Seins - ein trotziger Aufschrei gegen die endlose Bürokratie der Einwanderung. Eindimensionalen Erzählungen über Flucht, Trauma und einem Leben am Rande der Gesellschaft setzt Addonia eine unkonventionelle, vielschichtige Protagonistin entgegen, die ihren Platz in der Welt sucht.
»Die Sehenden« ist ein mutiger, eindringlicher Roman, der Psyche und Sexualität seiner Figuren auf unvergleichliche Weise entschlüsselt. Eine Geschichte über Vergangenheit und Gegenwart, generationsübergreifende Lebenserfahrungen, koloniale Traumata und das reale Gesicht der europäischen Einwanderungspolitik sowie ihre Auswirkungen auf Zufluchtssuchende
.»In Die Sehenden nimmt uns Sulaiman Addonia mit in eine ebenso bezaubernde wie raue Welt, in der sich Sehnsüchte und Erinnerungen überschneiden. Wie fesselnd und elegant und ergreifend und witzig und voller Vitalität! Und was für eine Fülle von Bildern! Absolute Weltklasse. « Peter Verhelst
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
12. März 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
176
Reihe
welt bewegt
Autor/Autorin
Sulaiman Addonia
Übersetzung
Sula Textor
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
316 g
Größe (L/B/H)
216/125/19 mm
ISBN
9783949545696
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»In Die Sehenden nimmt uns Sulaiman Addonia mit in eine ebenso bezaubernde wie raue Welt, in der sich Sehnsüchte und Erinnerungen überschneiden. Wie fesselnd und elegant und ergreifend und witzig und voller Vitalität! Und was für eine Fülle von Bildern! Absolute Weltklasse. « Peter Verhelst
»Sensationell! Addonias fesselnde Prosa jagt von einem sinnlichen Gedanken zum nächsten. . . Eine leidenschaftliche und verführerische Geschichte von Resilienz. « Publishers Weekly
»Sensationell! Addonias fesselnde Prosa jagt von einem sinnlichen Gedanken zum nächsten. . . Eine leidenschaftliche und verführerische Geschichte von Resilienz. « Publishers Weekly
 Besprechung vom 25.03.2025
Besprechung vom 25.03.2025
Sprachliches Wellenreiten
Flucht und Lust: Sulaiman Addonias erotischer Exilroman "Die Sehenden"
Die Mutter ist ein Stern, der Vater ist ein Stern, und als Hannah eines Abends in London aus dem Fenster schaut, kann die Geflüchtete im Teenageralter kaum der Verlockung widerstehen, "mit meinen Eltern zwischen den Sternen herumzuspazieren". Es ist der Abend nach einem Tag, den Hannah mit Warten auf den Asylbescheid des "Home Office" verbracht hat. Diese kleine Szene sagt viel aus über den Stil des Autors Sulaiman Addonia, der mit Hannahs Geschichte sein drittes Buch geschrieben hat: unter dem Titel "Die Sehenden". Dessen Sprache begibt sich kaum in die Nähe von psychologischen oder diskursiven Termini, sondern sucht nach der Wahrnehmung innerer Bilder, die der Komplexität der Vorgänge, bevor sie eingeordnet werden, gerecht wird.
Uneindeutigkeit wird hier weniger zelebriert als ermöglicht. So bleibt auch bis zum Ende offen, ob die Kreuzchen des "Home Office" bei "schwarzafrikanisch", "weiblich" und "heterosexuell" Hannahs Identität entsprechen oder nicht. "Wer sind wir denn, wenn wir unsere Geschichten vereinfachen müssen, um in Frieden zu leben?", fragt die Protagonistin rhetorisch. Damit meint sie nicht nur die Kreuze, sondern vor allem die Mischung aus politischem und persönlichem Kontext, die in Fluchtgeschichten oft so dosiert werden muss, dass sie den Vorstellungen der Entscheider entspricht.
Sulaiman Addonia hat sich mit seinem neuen Roman als eine Stimme in der Literaturwelt etabliert, die Seltenheitswert hat. Einerseits schreibt er, indem er die Durchdringung von arabischen, afrikanischen und europäisch-amerikanischen Erzähltraditionen faszinierend spürbar macht, vor dem Hintergrund einer Weltliteratur, die in dieser Breite nur selten präsent ist. Anderseits verbindet er die Erfahrungen aus Afrika stammender Geflüchteter mit dem Drang, seinen Protagonisten auf dem Weg sexueller Befreiung und Selbstverwirklichung zu folgen. In einem Interview mit "The London Magazine" sprach Addonia darüber, dass der Prozess, seinen Protagonisten solche Freiheiten zuzustehen, für ihn ein harter Kampf gewesen sei.
Auch das Ergebnis ist nicht ohne. So, wie Hannah sich beim Lesen des sexuell expliziten Tagebuchs ihrer Mutter, dem einzigen Gepäckstück, das sie nach London mitgebracht hatte, übergeben musste, so wird auch ihrem Lesepublikum einiges zugemutet. Als eine Referenz, die ihm im Prozess des Schreibens bewusst wurde, nennt der Autor im Nachwort Anne Desclos' berühmten sadomasochistisch-erotischen Roman "Geschichte der O". Interessanterweise arbeitet er hier jedoch auf andere Art mit Dosierung: Dadurch, dass seine ringende Ich-Erzählerin nie mehr von ihren eigenen Motivationen oder jenen anderer preisgibt, als sie sich selbst zumuten und zutrauen kann, wird eine vorsichtige Solidarität ermöglicht.
Ebenfalls im Nachwort zu seinem in einem Absatz geschriebenen Roman, der im besten Sinn auch als Novelle durchgehen kann, behält sich Addonia einen eigenwilligen Dank vor. Er dankt den Pflanzen und dem Wasser der Étangs d'Ixelles (zwei größeren, kontinuierlich von Joggern umkreisten Ententeichen im Zentrum von Brüssel), die sein regelmäßiges Vorlesen von Gedichten mit der Inspiration zu "Den Sehenden" beantwortet hätten. Dadurch wird eine weitere, ganz eigene Komponente in der Welterfahrung des Autors unterstrichen, die er auch an seine Protagonistin weitergibt. Denn die liebt - zumindest in ihrer Zeit als Obdachlose - "die Natur mehr als Menschen" und kommuniziert mit ihr mittels Versen verstorbener Dichter. Ein weiterer Aspekt, den dieser Dank betont, ist Addonias Verbundenheit mit der Stadt Brüssel, in der er sich 2009 niedergelassen hat. Dort hat der Autor inzwischen das "Asmara-Addis Literary Festival (In Exile)" sowie, mit Unterstützung des Stadtteils Ixelles, einen Kreatives-Schreiben-Workshop für Geflüchtete etabliert. Der wird jeweils geleitet von Autoren, die sich zwischen mehreren Sprachen bewegen. Bei Addonia selbst sind es inzwischen mindestens fünf: Arabisch, Amharisch, Tigrinya, Englisch, Flämisch. Seine literarische Sprache ist das Englische, das er erst lernte, als er - wie Hannah - als unbegleiteter eritreischer Flüchtling nach London kam.
Dieser Erfahrung der Mehrsprachigkeit, mit der ein Misstrauen gegenüber Sprache als ultimative Ausdrucksmöglichkeit einhergeht, war Addonia in seinem zweiten Roman mit dem (scheinbar) programmatischen Titel "Schweigen ist meine Muttersprache" nachgegangen. Mehrsprachigkeit ist auch in "Die Sehenden" präsent, sowohl als Türöffner für das Ausdruckspotential von Sexualität als auch als neu entdecktes Lustprinzip: Am Anfang zeigt Hannah einen Zettel vor, auf dem in Großbuchstaben steht: "Ich spreche Tigrinya, Amharisch und Arabisch." Am Ende, nur wenige Wochen, dafür aber viele Fernsehsendungen und Lektüren weiter, heißt es: "Viele von uns reiten Akzente wie Wellen, gleiten gekonnt zwischen Estuary, Cockney und Posh hin und her, was ein Muttersprachler nie könnte oder wollte." Ein kritisches Verhältnis zur Sprache bedeutet hier also nicht weniger Sprachlust. "Wörter sind meine Kultur", lautet eine von Hannahs wenigen Gewissheiten. Und damit ist ihr zumindest auf diesem Gebiet vertraut, was sie in anderen Beziehungen sucht: der Schnittpunkt der Koordinaten Zuflucht und Lust. ASTRID KAMINSKI
Sulaiman Addonia:
"Die Sehenden". Roman.
Aus dem Englischen von Sula Textor.
Orlanda Verlag,
Leipzig 2025.
176 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 14.03.2025
Herausfordernd
Welch ein provokanter und herausfordernder Text. Er hat mich nachhaltig beschäftigt und sehr beeindruckt, durchaus auch zu tief beeindruckt und war schwer verdaulich.
Hannah, eine junge Eritreerin, flüchtet nach Großbritannien. In Eritrea und auch auf der Flucht wurde sie vergewaltigt. In London wird sie als unbegleite Minderjähriger in einer Pflegestelle bei Diana untergebracht. Diese ist selbst eher unglücklich mit ihrem Leben. Hannah wartet auf den Asylbescheid. Sie versucht sich einzuleben, kann aber aufgrund der Gesetze nicht viel machen. Sie stößt wiederholt auf Rassismus. Sie versucht am Leben zu bleiben - nur das Begehren und die Lust halten sie am Leben. Sie verliebt sich.
Ihre spezielle Formen der Lust ist allgegenwärtig und nimmt sehr viel Raum ein. Sicherlich auch als Bewältigungsversuch ihrer traumatischen Erlebnisse zu verstehen. "Es muss weh tun, um all den Schmerz zu ertränken." Zudem setzt sie sich mit dem Tagebuch ihrer früh verstorbenen Mutter auseinander. Hier werden Parallelen deutlich,was ich letztlich als Versuch des eines feministischen Aufbegehrens verstehe.
Eine Bewertung fällt mir schwer. Ich kann von einem bis fünf Sterne alles vergeben:
1 Stern dafür, dass ich Dinge überflogen habe und überlegt habe, abzubrechen. Viele Geschehnisse und Beschreibungen irritierten mich und stießen mich sehr ab.
2 Sterne dafür, dass ich mich manchmal gelangweilt habe, da es zuviel desselben war und mir die Story zu wild wurde. Es nervte mich zudem, dass alles irgendwie mit Sex und verschiedenen Praktiken verbunden wurde. Ich habe einige Ideen dazu, wie man es verstehen kann, aber es war mir insgesamt zu viel und manchmal auch zu heftig.
3 Sterne dafür, dass der Autor ein Mann ist und ich mich fragte, ob es überhaupt okay ist, solch ein Buch aus der Ich-Perspektive einer jungen Frau zu schreiben. Anfangs dachte ich, es sei eine Autorin. Mein Mitgefühl mit der Protagonistin war dadurch sehr groß, fast schon quälend schmerzhaft und herzzerbrechend. Bald bemerkte ich aber, dass dieser Text nicht von einer Frau sein könne und begriff dann endlich, dass der Autor ein Mann war. Dadurch konnte ich mich besser vom Text distanzieren, und etwas Atem holen, fühlte mich aber auch etwas provoziert.
4 Sterne für den schrägen, ungewöhnlichen und eigenwilligen Text, der ohne Absätze, im Stil eines stream of consciousness geschrieben wurde. Dadurch ist man sehr dicht am Erleben der Hauptfigur dran. Nicht immer ist hierbei klar, ob Ereignisse tatsächlich oder eher metaphorisch geschehen.
5 Sterne für die eindrückliche Darstellung des Lebens als Geflüchtete, die sich einfinden muss und um ihre Identität ringt. Die Schilderungen der politischen und gesellschaftlichen Situation in Eritrea fand ich sehr interessant. Die Darstellung der der Warterei und der Verdammung zum Nichtstun in London fand ich sehr authentisch und beleuchtet das Asylsystem durchaus kritisch.
Der Text zwang mich inhaltlich zur Auseinandersetzung und wird mir nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Auch strukturell zwang mich der Text zur Auseinandersetzung: was kann Literatur leisten, was soll sie leisten? Zudem hat der Autor meinen tiefen Respekt, da er im Nachgang seine literarischen Anleihen und entnommenen Gedichte als Quellen darlegt.
Fazit: Eindrücklich, tragisch, berührend, provokant, verstörend, interpretierbar. Nicht für jede*n geeignet.
Triggerwarnung: sexueller Mißbrauch, sexuelle Spielarten, Suizid, Gewalt
am 12.03.2025
Exilantin in London
Sulaiman Addonia ist in Eritrea geboren. Er hat Flüchtlingslager erlebt.
Die Sehenden ist über eine geflüchtete Eritrea in London.
Hannah versucht ein Leben in Freiheit zu beginnen. Das ist aber nicht leicht.
Der Autor schreibt mit beeindruckender Stimme .
Es wird viel über Sexualität erzählt.
Es ist für mich ein bedrückendes Werk.
Es ist ein trauriges Leben der Hannah, das bestimmt für viele Emigranten zählt.