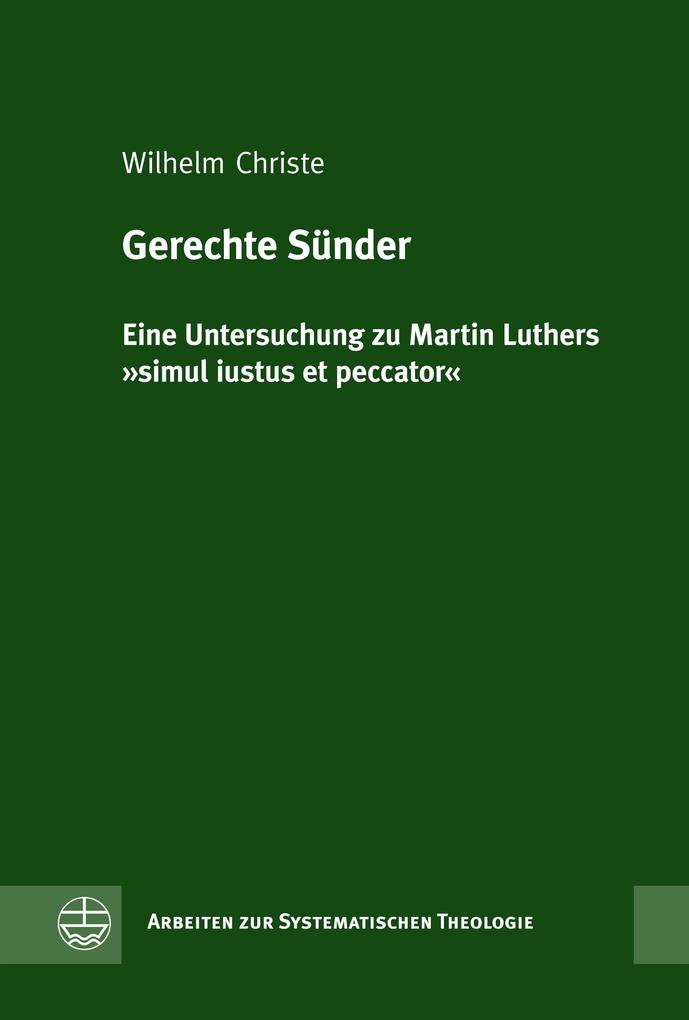
Sofort lieferbar (Download)
'Gerecht und Sünder zugleich' lautet die Kurzformel, mit der Martin Luther die ontologische Verfasstheit des Christenmenschen brennpunktartig zusammenfasst. Ihre Bedeutung und theologische Vertretbarkeit sind jedoch nicht nur im interkonfessionellen, sondern auch im innerevangelischen Diskurs bis heute strittig. Wird der Sünde nicht ein zu großes Gewicht beigemessen? Verführt die Formel nicht zu ethischem Quietismus? Hat sie überhaupt eine Basis in der Heiligen Schrift?
In seiner Habilitationsschrift erforscht Christe Vorkommen, Bedeutung und Stellenwert des 'simul iustus et peccator' im Werk Martin Luthers. Zunächst wird untersucht, innerhalb welcher theologischer Themen der Reformator auf die Formel rekurriert. Anschließend werden die Begriffe 'peccator', 'iustus' und 'simul' semantisch geklärt. Abschließend fragt die Arbeit nach der exegetischen Basis von Luthers Formel und untersucht die Möglichkeit ihrer heutigen systematischen Vertretbarkeit auf dem Hintergrund des gegenwärtigen ökumenisch-theologischen Gesprächs.
In seiner Habilitationsschrift erforscht Christe Vorkommen, Bedeutung und Stellenwert des 'simul iustus et peccator' im Werk Martin Luthers. Zunächst wird untersucht, innerhalb welcher theologischer Themen der Reformator auf die Formel rekurriert. Anschließend werden die Begriffe 'peccator', 'iustus' und 'simul' semantisch geklärt. Abschließend fragt die Arbeit nach der exegetischen Basis von Luthers Formel und untersucht die Möglichkeit ihrer heutigen systematischen Vertretbarkeit auf dem Hintergrund des gegenwärtigen ökumenisch-theologischen Gesprächs.
Inhaltsverzeichnis
INHALT
Einleitung
Wirkungsgeschichte Forschungsbericht Gang der Untersuchung 15
1 Spuren des »simul iustus et peccator« in den lutherischen Bekenntnisschriften 19
1.1 Apologie 19
1.2 Konkordienformel 21
2 Der katholische Widerspruch 24
2.1 Trient 24
2.2 Johann Adam Mo hler 28
2.3 Heinrich Denifle 32
3 Neuere katholische Anna herungen an das »simul iustus et peccator« 35
3.1 Robert Grosche 35
3.2 Hans Urs von Balthasar 36
3.3 Karl Rahner 38
3.4 Johann Baptist Metz 43
3.5 Ralf Miggelbrink 44
3.6 Giovanni Iammarrone 47
4 Die Diskussion um das »simul iustus et peccator« anla sslich der »Gemeinsamen Erkla rung zur Rechtfertigungslehre« 53
4.1 Das »simul« in der »Gemeinsamen Erkla rung« (GE) 53
4.2 Reaktionen auf die Position der »Gemeinsamen Erkla rung« 58
4.3 Die »Gemeinsame offizielle Feststellung« (GOF) und der
»Anhang zur gemeinsamen offiziellen Feststellung« 61
4.4 Lutherische Stimmen zur »Gemeinsamen offiziellen Feststellung« 66
5 Einzelstudien zum lutherischen »simul iustus et peccator« 69
5.1 Rudolf Hermann 69
5.2 Paul Althaus 75
5.3 Wilhelm Link 77
5.4 Wilfried Joest 79
5.5 Reinhard Ko sters 82
5.6 Kjell Ove Nilsson 86
5.7 O kumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen 89
5.8 Gerhard Ebeling 92
6 Methode und Aufbau der Studie 94
I
Simul iustus et peccator: Verortung in der Theologie Luthers 99
1 Rechtfertigung 101
1.1 Ro merbriefvorlesung (1515 1516) 101
1.1.1 Scholion zu Ro mer 4,7 101
1.1.2 Scholion zu Ro mer 12,2 113
1.1.3 Der Su ndencharakter der Konkupiszenz 119
Exkurs: Zur Genese von Luthers Neubewertung der Konkupiszenz 123
1.1.4 Die kerygmatische Funktion des »simul« 130
1.2 Großer Galaterkommentar (1531 [1535]) 138
1.2.1 Argumentum Epistolae 139
1.2.2 Galater 3,6 144
1.2.3 Galater 2,16 151
1.2.4 Galater 2,20 154
1.2.5 Galater 3,13 157
1.2.6 Galater 5,5 160
1.2.7 Galater 5,16-17 163
1.3 Spa te Disputationen (1535-1537) 168
1.3.1 Gottes doppelte Toleranz 169
1.3.2 Aspekte des Rechtfertigungsversta ndnisses 176
1.3.2.1 Imputatio 176
1.3.2.2 Rechtfertigung als sich wiederholendes Geschehen 177
1.3.2.3 Totalita ts- und Interimscharakter der Rechtfertigung 178
1.3.2.4 Ausschluss der guten Werke von der Rechtfertigung 178
1.3.2.5 Effektives Gerechtwerden 179
1.3.2.6 Der Realita tscharakter der »imputatio« 184
1.3.2.7 Doppelte Gerechtigkeit 186
Exkurs: Augustinus und Luther u ber Rechtfertigung ein Vergleich 191
2 Taufe 205
2.1 Taufe als Gerechtsprechung: Der Mensch wird ganz von Gott angenommen 207
2.1.1 Taufe als Unterstelltwerden unter das Urteil der go ttlichen Barmherzigkeit 207
2.1.2 Die Su nde bleibt bis in den Tod 210
2.1.3 Taufgeda chtnis 213
2.1.4 Profilierung der Taufverheißung 215
2.2 Taufe als lebenslanges Gerechtwerden: Ta gliches Sterben und Auferstehen bis zum Tod 217
2.2.1 Getauftwerden bis in den Tod 217
2.2.2 Taufe als Bund zwischen Gott und Mensch 218
2.2.3 Formen der U berwindung der Su nde 220
2.2.4 Reales, nicht nur symbolisches Sterben 221
2.2.5 »Ta gliche Reu und Buße« 223
2.2.6 »Bekehrung« 224
2.2.7 Fortschreiten und Wachsen? 225
3 Buße 228
3.1 Das »simul« als Realgrund der lebenslangen Buße 228
3.1.1 Fru he Schriften zur Buße (1517 1519) 228
3.1.2 Dritte Thesenreihe gegen die Antinomer (1538) 233
3.2 DieSituationkonkreterBußealsErkenntnisgrunddes »simul« 237
3.3 Das »simul« in der Auslegung von Bußpsalmen 241
3.3.1 Die sieben Bußpsalmen (1517) 242
3.3.2 Enarratio Psalmi 51 (1532 [1538]) 243
3.4 Die Totalita t der bleibenden Su nde im Su ndenbekenntnis 248
3.4.1 Enarratio Psalmi 51 (1532 [1538]) 248
3.4.2 Die sieben Bußpsalmen (1517) 251
4 Gute Werke 254
4.1 Die These: »omne opus bonum est peccatum« 254
4.2 Wie versteht die These das »simul«? 256
4.3 Die Denkbarkeit des »simul« mittels der Unterscheidung von »gratia« und »donum« 266
4.4 Was ist der Grund der Rechtfertigung: »gratia« und/oder »donum«? 271
4.5 Christus unsere einzige »reale Gerechtigkeit« der Gerechtfertigte von sich her lebenslang »totus peccator« 283
Exkurs: Zur Interpretation der Rechtfertigungslehre Luthers durch Reinhold Seeberg 288
4.6 Die ethische Valenz der guten Werke auch Gott gegenu ber 292
5 Anthropologie 295
5.1 Von wem spricht Ro mer 7? 295
5.2 Wie zeigt sich der Gegensatz von Geist und Fleisch? »Facere« und »perficere« 300
5.2.1 Ro merbriefvorlesung (1515 1516) 301
5.2.2 Kleiner Galaterkommentar (1519) 304
5.3 In Ro mer 7 ist von wirklicher Su nde die Rede 306
5.4 Das Ineinander und Gegeneinander von Geist und Fleisch in der Person des Christen 311
5.4.1 Vororientierung 312
5.4.2 Der Christ selbst su ndigt und doch nicht er selbst 314
5.4.3 Die Zwei-Naturen-Lehre als Analogie Luthers schrittweise Ablo sung vom Substanzdualismus 318
5.4.4 Zwei ganze Menschen in einem Menschen 322
5.5 Zum Verha ltnis von anthropologischen Konstitutionsbegriffen und soteriologischen Ganzheitsbegriffen 327
5.5.1 Geist und Fleisch als Aussagen u ber den »totus homo« 328
5.5.1.1 Kleiner Galaterkommentar (1519) 328
5.5.1.2 Großer Galaterkommentar (1531 [1535]) 332
5.5.1.3 De servo arbitrio (1525) 334
5.5.2 Die Verha ltnisbestimmung selbst 337
5.5.2.1 Auslegung des Magnifikat (1521) 337
5.5.2.2 Freiheitstraktat (1520) 343
a) Totus-homo-Anthropologie oder doch Substanzdualismus? 343
b) »Innerer Mensch« 346
c) »A ußerer Mensch« 349
d) Zusammenfassung 355
Gesetz 359
6.1 Zwei Gerechtigkeiten 361
6.2 Zwei Zeiten 368
6.3 Zwei Aspekte oder Relationen: der Christ ein »Doppelwesen« 374
6.3.1 Die zwei Prinzipien der Antinomer 376
6.3.2 Die doppelte Begru ndung der kirchlichen Gesetzespredigt 378
6.3.3 Thematisierungen des »simul« 382
6.3.4 Aspekte oder Relationen, unter denen das »simul« ausgesagt wird 386
6.3.4.1 Geist Fleisch 387
6.3.4.2 Im Blick auf Christus im Blick auf mich 388
6.3.4.3 Christianus triumphans christianus militans 389
6.3.4.4 Der Christ als Christ der Christ als Su nder 390
6.3.5 Non esse sub lege esse sub lege: aspekthaft-relationales oder tempora res Versta ndnis? 391
Exkurs: Luthers Interpretation von 1. Timotheus 1,8-9 398
6.4 Tertiusususlegis? 405
6.4.1 Die Problemstellung und typische Lo sungsmodelle 406
6.4.2 Kleiner Galaterkommentar (1519) 408
6.4.3 Großer Galaterkommentar (1531 [1535]) und De servo arbitrio (1525) 416
6.4.4 Antinomerdisputationen (1537 1540) 418
6.4.4.1 Gesetz als Weisung und Mahnung 419
6.4.4.2 »Gemildertes Gesetz« 423
6.4.4.3 Das ins Herz geschriebene Gesetz 424
6.4.5 Resu mee 427
II
Simul iustus et peccator: Begriffsbestimmungen 437
1 Peccator/peccatum 439
1.1 Von der Tatsu nde zur Ursprungssu nde 439
1.2 Worin besteht die Ursprungssu nde? 446
1.3 Peccatum regnans peccatum regnatum 453
1.4 Peccatum/crimen 454
1.5 Die Ursprungssu nde zeigt sich in Tatsu nden 456
2 Iustus/iustitia 459
2.1 Gerechtigkeit vor Gott 459
2.2 Iustitia actualis 465
2.3 Fortschritt und Wachstum und ihre Erkennbarkeit 468
2.4 Die theologische Relevanz der »iustitia actualis« 474
3 Simul 478
3.1 Total- und Partialaspekt 478
3.2 Zum sachlogischen Status des Urteils »totus peccator« 484
3.3 Verha ltnisbestimmungen zwischen »iustus« und »peccator« 486
3.4 Die Denkform der christologischen »communicatio idiomatum« 494
3.5 Auszuschließende bzw. zu integrierende Modelle der Zuordnung von »iustus« und »peccator« 500
3.5.1 Keine Aufhebung der Logik 500
3.5.2 Kein ausschließlich temporales Versta ndnis 505
3.5.3 Nicht nur auf die Tatsu nden und die Versuchlichkeit bezogen 507
3.6 Der heilsgeschichtliche Sinn des »simul iustus et peccator« 509
III
Simul iustus et peccator: Exegetische und systematische U berlegungen 515
1 Luthers »simul« kurzgefasst Zusammenfassung der Ergebnisse von Teil I und II 517
1.1 Drei Aspekte der Simul-Formel 517
1.2 Der Su ndenbegriff 518
1.3 Das Versta ndnis der Rechtfertigung 519
1.4 Das »simul« in zentralen Themenfeldern von Luthers Theologie 521
1.5 Gottes »Absicht« mit dem »simul« 524
1.6 Das »simul« und die Logik 524
2 Kann Ro mer 7 einen Beitrag zur Begru ndung des »simul iustus et peccator« leisten? 526
2.1 Die Aufgabe: Kritisch-konstruktive Pru fung und mo gliche Erweiterung der biblischen Belege Luthers fu r das »simul« 526
2.2 Die Frage nach dem Subjekt von Ro mer 7 528
2.2.1 Mo gliche Antworten und Luthers Position 528
2.2.2 In Ro mer 7 spricht der Mensch vor und außer Christus 530
2.2.3 Umdeutungen Luthers 536
Exkurs: Die interpretatio christiana von Ro mer 7 in neueren Ro merbriefkommentaren 538
a) Argumente fu r die »interpretatio christiana« 538
b) Die theologischen Optionen dieser Deutung 541
c) Fazit 547
2.3 Die indirekte Funktion von Ro mer 7 fu r eine Begru ndung des »simul«: Die Frage nach der » « (Ro m 7,7-8) 549
2.4 Gru nde fu r die nachpaulinische Applikation von Ro mer 7 auf die christliche Existenz 558
2.4.1 Die unterschiedliche kirchliche Situation bei Paulus und Luther 560
2.4.2 Herausbildung der abendla ndischen Subjektivita t 563
2.4.3 Wegfall der urchristlichen Naherwartung 568
2.4.4 Hans Hu bners Begru ndung des »simul« durch eine »geschichtliche« Paulusinterpretation 572
Exkurs: Zur Debatte um Su ndlosigkeit und Su nde des Christen 574
a) Hermann Scholz 574
b) Paul Wernle 575
c) Johannes Gottschick 579
d) Hans Windisch 581
e) Theodor Schlatter 588
f) Helmut Umbach 592
3 Andere neutestamentliche Belege zur indirekten Fundierung des »simul iustus et peccator« 596
3.1 Galater 5,16-17 596
3.1.1 Luthers Auslegung 597
3.1.2 Galater 5,16-17 in der heutigen exegetischen Diskussion 598
3.1.3 Fazit 604
3.2 Mattha us 5,21-22; 5,27-28 604
3.2.1 Einfu hrendes zu den Antithesen 605
3.2.2 Erste Antithese 606
3.2.3 Zweite Antithese 608
3.2.4 Mattha us 5,21-22; 5,27-28 und das »simul iustus et peccator« 610
3.3 1.Johannes 1,5-2,1; 3,4-10; 5,14-18 615
3.3.1 Luthers Deutung 615
3.3.2 Die in 1. Johannes erkennbare Kontroverse 618
3.3.3 Zur Exegese der drei Textkomplexe 619
3.3.4 Zur Vereinbarkeit von Su nde und Su ndlosigkeit des Christen 624
3.3.5 Kennt 1. Johannes das lutherische »simul iustus et peccator«? 628
4 Zur mo glichen Versta ndigung u ber den Konkupiszenzbegriff 630
4.1 Der »status quaestionis« 630
4.2 Konkupiszenz und Konsens 636
4.3 Su nde und Schuld 643
4.4 Natu rliche Konkupiszenz? 650
5 Zur Frage nach der Wirklichkeit der Rechtfertigung 653
5.1 Einwa nde gegen Luthers Rechtfertigungslehre 653
5.2 Relationale Ontologie 655
5.3 Wirkungen der Rechtfertigung 658
5.4 »Der Gerechtgesprochene ist auch gerecht!« 663
5.4.1 Der positive Sinn des Satzes 663
5.4.2 Auseinandersetzung mit anderen Interpretationen 668
5.4.2.1 Eberhard Ju ngel 668
5.4.2.2 Sibylle Rolf 674
5.5 Einseitigkeiten und Gefahren bei Luther 681
5.5.1 U berscharfe Konzentration auf das Kreuz 681
5.5.2 Relativierung des Sieges Christi 684
5.5.3 Erlo sung durch den Tod? 686
6 Zum ekklesiologischen und interkonfessionellen Stellenwert des »simul iustus et peccator« 687
6.1 Kirchengemeinschaft trotz Lehrdifferenz beim »simul iustus et peccator«? 687
6.2 Einheit und Gemeinschaft der Kirchen nach der Leuenberger Konkordie 688
6.3 »Das gemeinsame Versta ndnis des Evangeliums« 690
6.4 Anwendung des Leuenberger Kriteriums auf das »simul iustus et peccator« 692
6.5 Vertiefte Interpretation des Leuenberger Ansatzes 695
Anhang 701
Tabelle wichtiger Simul-Stellen bei Luther 703
1 Simul-Formeln 703
2 Varianten der Simul-Formel 705
Literaturverzeichnis 712
1 Quellen 712
2 Die zitierten Werke Luthers im Einzelnen 714
3 Sonstige Literatur 722
Personenregister 742
Einleitung
Wirkungsgeschichte Forschungsbericht Gang der Untersuchung 15
1 Spuren des »simul iustus et peccator« in den lutherischen Bekenntnisschriften 19
1.1 Apologie 19
1.2 Konkordienformel 21
2 Der katholische Widerspruch 24
2.1 Trient 24
2.2 Johann Adam Mo hler 28
2.3 Heinrich Denifle 32
3 Neuere katholische Anna herungen an das »simul iustus et peccator« 35
3.1 Robert Grosche 35
3.2 Hans Urs von Balthasar 36
3.3 Karl Rahner 38
3.4 Johann Baptist Metz 43
3.5 Ralf Miggelbrink 44
3.6 Giovanni Iammarrone 47
4 Die Diskussion um das »simul iustus et peccator« anla sslich der »Gemeinsamen Erkla rung zur Rechtfertigungslehre« 53
4.1 Das »simul« in der »Gemeinsamen Erkla rung« (GE) 53
4.2 Reaktionen auf die Position der »Gemeinsamen Erkla rung« 58
4.3 Die »Gemeinsame offizielle Feststellung« (GOF) und der
»Anhang zur gemeinsamen offiziellen Feststellung« 61
4.4 Lutherische Stimmen zur »Gemeinsamen offiziellen Feststellung« 66
5 Einzelstudien zum lutherischen »simul iustus et peccator« 69
5.1 Rudolf Hermann 69
5.2 Paul Althaus 75
5.3 Wilhelm Link 77
5.4 Wilfried Joest 79
5.5 Reinhard Ko sters 82
5.6 Kjell Ove Nilsson 86
5.7 O kumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen 89
5.8 Gerhard Ebeling 92
6 Methode und Aufbau der Studie 94
I
Simul iustus et peccator: Verortung in der Theologie Luthers 99
1 Rechtfertigung 101
1.1 Ro merbriefvorlesung (1515 1516) 101
1.1.1 Scholion zu Ro mer 4,7 101
1.1.2 Scholion zu Ro mer 12,2 113
1.1.3 Der Su ndencharakter der Konkupiszenz 119
Exkurs: Zur Genese von Luthers Neubewertung der Konkupiszenz 123
1.1.4 Die kerygmatische Funktion des »simul« 130
1.2 Großer Galaterkommentar (1531 [1535]) 138
1.2.1 Argumentum Epistolae 139
1.2.2 Galater 3,6 144
1.2.3 Galater 2,16 151
1.2.4 Galater 2,20 154
1.2.5 Galater 3,13 157
1.2.6 Galater 5,5 160
1.2.7 Galater 5,16-17 163
1.3 Spa te Disputationen (1535-1537) 168
1.3.1 Gottes doppelte Toleranz 169
1.3.2 Aspekte des Rechtfertigungsversta ndnisses 176
1.3.2.1 Imputatio 176
1.3.2.2 Rechtfertigung als sich wiederholendes Geschehen 177
1.3.2.3 Totalita ts- und Interimscharakter der Rechtfertigung 178
1.3.2.4 Ausschluss der guten Werke von der Rechtfertigung 178
1.3.2.5 Effektives Gerechtwerden 179
1.3.2.6 Der Realita tscharakter der »imputatio« 184
1.3.2.7 Doppelte Gerechtigkeit 186
Exkurs: Augustinus und Luther u ber Rechtfertigung ein Vergleich 191
2 Taufe 205
2.1 Taufe als Gerechtsprechung: Der Mensch wird ganz von Gott angenommen 207
2.1.1 Taufe als Unterstelltwerden unter das Urteil der go ttlichen Barmherzigkeit 207
2.1.2 Die Su nde bleibt bis in den Tod 210
2.1.3 Taufgeda chtnis 213
2.1.4 Profilierung der Taufverheißung 215
2.2 Taufe als lebenslanges Gerechtwerden: Ta gliches Sterben und Auferstehen bis zum Tod 217
2.2.1 Getauftwerden bis in den Tod 217
2.2.2 Taufe als Bund zwischen Gott und Mensch 218
2.2.3 Formen der U berwindung der Su nde 220
2.2.4 Reales, nicht nur symbolisches Sterben 221
2.2.5 »Ta gliche Reu und Buße« 223
2.2.6 »Bekehrung« 224
2.2.7 Fortschreiten und Wachsen? 225
3 Buße 228
3.1 Das »simul« als Realgrund der lebenslangen Buße 228
3.1.1 Fru he Schriften zur Buße (1517 1519) 228
3.1.2 Dritte Thesenreihe gegen die Antinomer (1538) 233
3.2 DieSituationkonkreterBußealsErkenntnisgrunddes »simul« 237
3.3 Das »simul« in der Auslegung von Bußpsalmen 241
3.3.1 Die sieben Bußpsalmen (1517) 242
3.3.2 Enarratio Psalmi 51 (1532 [1538]) 243
3.4 Die Totalita t der bleibenden Su nde im Su ndenbekenntnis 248
3.4.1 Enarratio Psalmi 51 (1532 [1538]) 248
3.4.2 Die sieben Bußpsalmen (1517) 251
4 Gute Werke 254
4.1 Die These: »omne opus bonum est peccatum« 254
4.2 Wie versteht die These das »simul«? 256
4.3 Die Denkbarkeit des »simul« mittels der Unterscheidung von »gratia« und »donum« 266
4.4 Was ist der Grund der Rechtfertigung: »gratia« und/oder »donum«? 271
4.5 Christus unsere einzige »reale Gerechtigkeit« der Gerechtfertigte von sich her lebenslang »totus peccator« 283
Exkurs: Zur Interpretation der Rechtfertigungslehre Luthers durch Reinhold Seeberg 288
4.6 Die ethische Valenz der guten Werke auch Gott gegenu ber 292
5 Anthropologie 295
5.1 Von wem spricht Ro mer 7? 295
5.2 Wie zeigt sich der Gegensatz von Geist und Fleisch? »Facere« und »perficere« 300
5.2.1 Ro merbriefvorlesung (1515 1516) 301
5.2.2 Kleiner Galaterkommentar (1519) 304
5.3 In Ro mer 7 ist von wirklicher Su nde die Rede 306
5.4 Das Ineinander und Gegeneinander von Geist und Fleisch in der Person des Christen 311
5.4.1 Vororientierung 312
5.4.2 Der Christ selbst su ndigt und doch nicht er selbst 314
5.4.3 Die Zwei-Naturen-Lehre als Analogie Luthers schrittweise Ablo sung vom Substanzdualismus 318
5.4.4 Zwei ganze Menschen in einem Menschen 322
5.5 Zum Verha ltnis von anthropologischen Konstitutionsbegriffen und soteriologischen Ganzheitsbegriffen 327
5.5.1 Geist und Fleisch als Aussagen u ber den »totus homo« 328
5.5.1.1 Kleiner Galaterkommentar (1519) 328
5.5.1.2 Großer Galaterkommentar (1531 [1535]) 332
5.5.1.3 De servo arbitrio (1525) 334
5.5.2 Die Verha ltnisbestimmung selbst 337
5.5.2.1 Auslegung des Magnifikat (1521) 337
5.5.2.2 Freiheitstraktat (1520) 343
a) Totus-homo-Anthropologie oder doch Substanzdualismus? 343
b) »Innerer Mensch« 346
c) »A ußerer Mensch« 349
d) Zusammenfassung 355
Gesetz 359
6.1 Zwei Gerechtigkeiten 361
6.2 Zwei Zeiten 368
6.3 Zwei Aspekte oder Relationen: der Christ ein »Doppelwesen« 374
6.3.1 Die zwei Prinzipien der Antinomer 376
6.3.2 Die doppelte Begru ndung der kirchlichen Gesetzespredigt 378
6.3.3 Thematisierungen des »simul« 382
6.3.4 Aspekte oder Relationen, unter denen das »simul« ausgesagt wird 386
6.3.4.1 Geist Fleisch 387
6.3.4.2 Im Blick auf Christus im Blick auf mich 388
6.3.4.3 Christianus triumphans christianus militans 389
6.3.4.4 Der Christ als Christ der Christ als Su nder 390
6.3.5 Non esse sub lege esse sub lege: aspekthaft-relationales oder tempora res Versta ndnis? 391
Exkurs: Luthers Interpretation von 1. Timotheus 1,8-9 398
6.4 Tertiusususlegis? 405
6.4.1 Die Problemstellung und typische Lo sungsmodelle 406
6.4.2 Kleiner Galaterkommentar (1519) 408
6.4.3 Großer Galaterkommentar (1531 [1535]) und De servo arbitrio (1525) 416
6.4.4 Antinomerdisputationen (1537 1540) 418
6.4.4.1 Gesetz als Weisung und Mahnung 419
6.4.4.2 »Gemildertes Gesetz« 423
6.4.4.3 Das ins Herz geschriebene Gesetz 424
6.4.5 Resu mee 427
II
Simul iustus et peccator: Begriffsbestimmungen 437
1 Peccator/peccatum 439
1.1 Von der Tatsu nde zur Ursprungssu nde 439
1.2 Worin besteht die Ursprungssu nde? 446
1.3 Peccatum regnans peccatum regnatum 453
1.4 Peccatum/crimen 454
1.5 Die Ursprungssu nde zeigt sich in Tatsu nden 456
2 Iustus/iustitia 459
2.1 Gerechtigkeit vor Gott 459
2.2 Iustitia actualis 465
2.3 Fortschritt und Wachstum und ihre Erkennbarkeit 468
2.4 Die theologische Relevanz der »iustitia actualis« 474
3 Simul 478
3.1 Total- und Partialaspekt 478
3.2 Zum sachlogischen Status des Urteils »totus peccator« 484
3.3 Verha ltnisbestimmungen zwischen »iustus« und »peccator« 486
3.4 Die Denkform der christologischen »communicatio idiomatum« 494
3.5 Auszuschließende bzw. zu integrierende Modelle der Zuordnung von »iustus« und »peccator« 500
3.5.1 Keine Aufhebung der Logik 500
3.5.2 Kein ausschließlich temporales Versta ndnis 505
3.5.3 Nicht nur auf die Tatsu nden und die Versuchlichkeit bezogen 507
3.6 Der heilsgeschichtliche Sinn des »simul iustus et peccator« 509
III
Simul iustus et peccator: Exegetische und systematische U berlegungen 515
1 Luthers »simul« kurzgefasst Zusammenfassung der Ergebnisse von Teil I und II 517
1.1 Drei Aspekte der Simul-Formel 517
1.2 Der Su ndenbegriff 518
1.3 Das Versta ndnis der Rechtfertigung 519
1.4 Das »simul« in zentralen Themenfeldern von Luthers Theologie 521
1.5 Gottes »Absicht« mit dem »simul« 524
1.6 Das »simul« und die Logik 524
2 Kann Ro mer 7 einen Beitrag zur Begru ndung des »simul iustus et peccator« leisten? 526
2.1 Die Aufgabe: Kritisch-konstruktive Pru fung und mo gliche Erweiterung der biblischen Belege Luthers fu r das »simul« 526
2.2 Die Frage nach dem Subjekt von Ro mer 7 528
2.2.1 Mo gliche Antworten und Luthers Position 528
2.2.2 In Ro mer 7 spricht der Mensch vor und außer Christus 530
2.2.3 Umdeutungen Luthers 536
Exkurs: Die interpretatio christiana von Ro mer 7 in neueren Ro merbriefkommentaren 538
a) Argumente fu r die »interpretatio christiana« 538
b) Die theologischen Optionen dieser Deutung 541
c) Fazit 547
2.3 Die indirekte Funktion von Ro mer 7 fu r eine Begru ndung des »simul«: Die Frage nach der » « (Ro m 7,7-8) 549
2.4 Gru nde fu r die nachpaulinische Applikation von Ro mer 7 auf die christliche Existenz 558
2.4.1 Die unterschiedliche kirchliche Situation bei Paulus und Luther 560
2.4.2 Herausbildung der abendla ndischen Subjektivita t 563
2.4.3 Wegfall der urchristlichen Naherwartung 568
2.4.4 Hans Hu bners Begru ndung des »simul« durch eine »geschichtliche« Paulusinterpretation 572
Exkurs: Zur Debatte um Su ndlosigkeit und Su nde des Christen 574
a) Hermann Scholz 574
b) Paul Wernle 575
c) Johannes Gottschick 579
d) Hans Windisch 581
e) Theodor Schlatter 588
f) Helmut Umbach 592
3 Andere neutestamentliche Belege zur indirekten Fundierung des »simul iustus et peccator« 596
3.1 Galater 5,16-17 596
3.1.1 Luthers Auslegung 597
3.1.2 Galater 5,16-17 in der heutigen exegetischen Diskussion 598
3.1.3 Fazit 604
3.2 Mattha us 5,21-22; 5,27-28 604
3.2.1 Einfu hrendes zu den Antithesen 605
3.2.2 Erste Antithese 606
3.2.3 Zweite Antithese 608
3.2.4 Mattha us 5,21-22; 5,27-28 und das »simul iustus et peccator« 610
3.3 1.Johannes 1,5-2,1; 3,4-10; 5,14-18 615
3.3.1 Luthers Deutung 615
3.3.2 Die in 1. Johannes erkennbare Kontroverse 618
3.3.3 Zur Exegese der drei Textkomplexe 619
3.3.4 Zur Vereinbarkeit von Su nde und Su ndlosigkeit des Christen 624
3.3.5 Kennt 1. Johannes das lutherische »simul iustus et peccator«? 628
4 Zur mo glichen Versta ndigung u ber den Konkupiszenzbegriff 630
4.1 Der »status quaestionis« 630
4.2 Konkupiszenz und Konsens 636
4.3 Su nde und Schuld 643
4.4 Natu rliche Konkupiszenz? 650
5 Zur Frage nach der Wirklichkeit der Rechtfertigung 653
5.1 Einwa nde gegen Luthers Rechtfertigungslehre 653
5.2 Relationale Ontologie 655
5.3 Wirkungen der Rechtfertigung 658
5.4 »Der Gerechtgesprochene ist auch gerecht!« 663
5.4.1 Der positive Sinn des Satzes 663
5.4.2 Auseinandersetzung mit anderen Interpretationen 668
5.4.2.1 Eberhard Ju ngel 668
5.4.2.2 Sibylle Rolf 674
5.5 Einseitigkeiten und Gefahren bei Luther 681
5.5.1 U berscharfe Konzentration auf das Kreuz 681
5.5.2 Relativierung des Sieges Christi 684
5.5.3 Erlo sung durch den Tod? 686
6 Zum ekklesiologischen und interkonfessionellen Stellenwert des »simul iustus et peccator« 687
6.1 Kirchengemeinschaft trotz Lehrdifferenz beim »simul iustus et peccator«? 687
6.2 Einheit und Gemeinschaft der Kirchen nach der Leuenberger Konkordie 688
6.3 »Das gemeinsame Versta ndnis des Evangeliums« 690
6.4 Anwendung des Leuenberger Kriteriums auf das »simul iustus et peccator« 692
6.5 Vertiefte Interpretation des Leuenberger Ansatzes 695
Anhang 701
Tabelle wichtiger Simul-Stellen bei Luther 703
1 Simul-Formeln 703
2 Varianten der Simul-Formel 705
Literaturverzeichnis 712
1 Quellen 712
2 Die zitierten Werke Luthers im Einzelnen 714
3 Sonstige Literatur 722
Personenregister 742
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
29. April 2014
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
752
Dateigröße
103,67 MB
Reihe
Arbeiten zur Systematischen Theologie (ASTh), 6
Autor/Autorin
Wilhelm Christe
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783374038176
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Gerechte Sünder" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.























