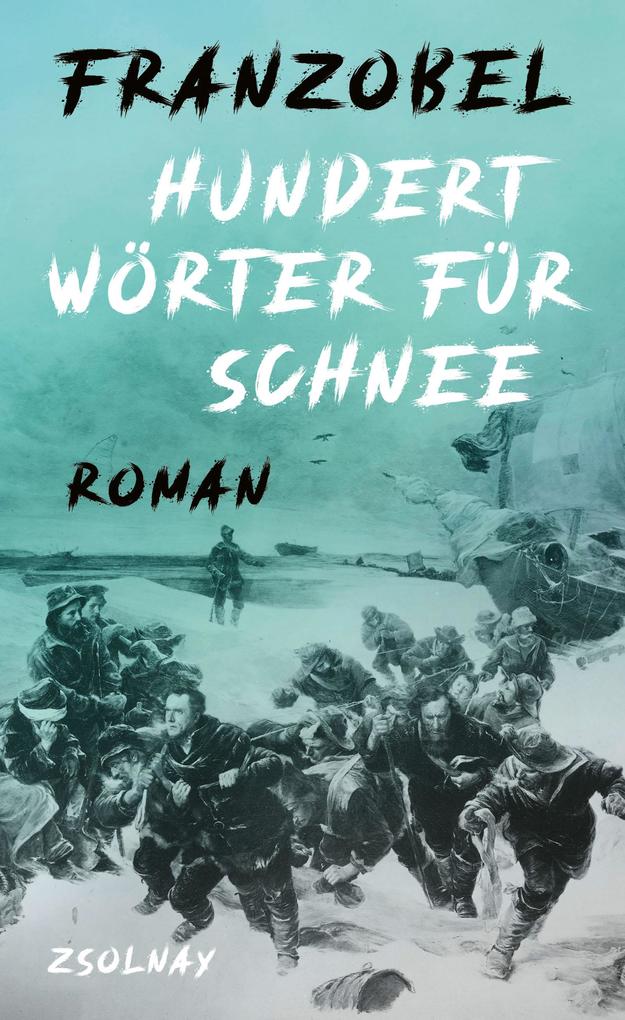
Sofort lieferbar (Download)
Nach »Das Floß der Medusa« und »Die Eroberung Amerikas« erzählt Franzobel in »Hundert Wörter für Schnee« die abenteuerliche Geschichte der Eroberung des Nordpols.
Im Herbst 1897 bringt der US-amerikanische Entdecker und Abenteurer Robert Peary sechs Inughuit, so der Name der im Norden Grönlands lebenden Menschen, auf einem Dampfschiff nach New York. Untersucht sollen sie werden, vor allem aber ausgestellt und hergezeigt. Vier von ihnen sterben schnell an Tuberkulose, einer wird zurückgebracht - der neunjährige Minik aber bleibt. Seine Geschichte - Taufe, Schule, betrügerischer Pflegevater, Flucht - sorgt für Schlagzeilen. In Franzobels Roman wird Minik nicht nur zum Spielball zwischen der zivilisierten amerikanischen Kultur und der angeblich primitiven eines Naturvolkes. Sein Schicksal ist ein Heldenlied auf den Überlebenskampf eines beinahe ausgestorbenen Volkes, das bewiesen hat, wie der Mensch selbst in der unwirtlichsten Gegend überleben kann.
Im Herbst 1897 bringt der US-amerikanische Entdecker und Abenteurer Robert Peary sechs Inughuit, so der Name der im Norden Grönlands lebenden Menschen, auf einem Dampfschiff nach New York. Untersucht sollen sie werden, vor allem aber ausgestellt und hergezeigt. Vier von ihnen sterben schnell an Tuberkulose, einer wird zurückgebracht - der neunjährige Minik aber bleibt. Seine Geschichte - Taufe, Schule, betrügerischer Pflegevater, Flucht - sorgt für Schlagzeilen. In Franzobels Roman wird Minik nicht nur zum Spielball zwischen der zivilisierten amerikanischen Kultur und der angeblich primitiven eines Naturvolkes. Sein Schicksal ist ein Heldenlied auf den Überlebenskampf eines beinahe ausgestorbenen Volkes, das bewiesen hat, wie der Mensch selbst in der unwirtlichsten Gegend überleben kann.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
18. Februar 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
528
Dateigröße
2,24 MB
Autor/Autorin
Franzobel
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783552075641
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 23.03.2025
Besprechung vom 23.03.2025
Wohin man blickt, ist Süden
Die Welt jenseits von Trump (II): Der österreichische Schriftsteller Franzobel hat einen abenteuerlichen Roman über Grönland und die Eroberung des Nordpols geschrieben
Von Andreas Lesti
Vielleicht sollte irgendjemand Donald Trump mitteilen, was für ein Land er vereinnahmen möchte. Vielleicht sollte ihm irgendjemand diese Zeilen zu lesen geben: "Das Thermometer zeigte minus 44 Grad, Tendenz fallend, und ihre Füße fühlten sich wie Zementpatschen an. Sie fragten sich, was sie hier taten in diesem menschenfeindlichen Landstrich." 92 Tage ohne Sonne, die "erbarmungslose, rabenschwarze, kalte, polare Dunkelheit" trieb die Männer in den Wahnsinn oder in den Tod. Und trotzdem marschierten sie weiter nach Norden. Es waren Trumps amerikanische Landsleute, die vor 130 Jahren über Grönland herfielen und von dort zum Pol strebten.
Die Zeilen stammen aus "Hundert Wörter für Schnee", dem neuen Roman des Österreichers Franzobel, und sie zeigen, dass der Akt der Aneignung Grönlands kein neuer ist. Schon im späten 19. Jahrhundert lieferten sich zwei Amerikaner einen Wettlauf zum Nordpol, was eine schamlose Unterwerfung der größten Insel der Welt zur Folge hatte. Die Protagonisten sind die beiden Arktisforscher Robert Edwin Peary und Frederick Albert Cook, zwei Besessene, deren Dasein von der Idee verblendet ist, als erste Menschen diesen Pol zu erreichen, jeder für sich und in gnadenloser Konkurrenz zueinander, "als gäbe es nur einen Platz in der Geschichte, um den sie beide stritten". Der eine, Zivilingenieur Peary, schlägt sich zunächst durch den Dschungel Nicaraguas, weil er dort eine Schiffsverbindung zwischen Atlantik und Pazifik bauen will. Der "Peary-Kanal" soll seinen Namen in die Welt tragen, doch es kommt anders.
Und so führen ihn Ehrgeiz und Ruhmsucht nach Nordgrönland. Als Peary dort im Jahr 1891 zum ersten Mal anlandet, legt er "seine Galauniform an - blauer Rock mit vergoldeten Knöpfen - und lässt vor der versammelten Mannschaft das Banner der Vereinigten Staaten aufziehen". Sein Vorhaben stilisiert er zu einer "modernen Form von Kunst", sich selbst zum Genie. Als ihm später acht erfrorene Zehen abgenommen werden, sieht er das nicht mehr so. Und zum Nordpol fehlen immer noch Hunderte von Kilometern. Der andere, Cook, ist ein Phantast und Geschichtenerzähler, der es mit der Wahrheit nicht so ganz genau nimmt. War er am Pol? Er behauptet es, genauso wie er behauptet, als erster Mensch den Mount McKinley bestiegen zu haben, Nordamerikas höchsten Berg. In beiden Fällen wird er als Lügner entlarvt.
Diese beiden Getriebenen also versuchen es zwischen 1888 und 1909 immer wieder, fahren ein ums andere Mal bis ans Ende der Baffin Bay, zum nördlichsten Siedlungsplatz der indigenen Inughuit. Von dort starten sie mit Einheimischen und Schlittenhunden, erst durch das Grönländische Inlandeis, dann weiter über das Packeis. Sie verschieben die Grenzen nach Norden, verlieren sich in der weißen und kalten Einsamkeit, frieren, hungern und essen die Schlittenhunde. Nur um am Ende mit leeren Händen dazustehen, als Nordpol-Betrüger, ohne Beweise, gescheitert, weil sie zu früh umgedreht sind, in der Eiseskälte bei minus 42, 45, bei minus 50 Grad. Und beide fragen sich, ob der andere es nicht vielleicht doch geschafft hat, diesen vermaledeiten Pol zu erreichen, diesen entlegensten aller Orte, ein weißer Fleck auf der Landkarte, von dem es heißt, das Jahr dauere dort nur eine Nacht und einen Tag, und wohin man dort auch blicke, sei Süden. Bis die ersten Menschen nachweislich den Nordpol erreichen, sollte noch eine ganze Weile vergehen: Es sind 1948 die Teilnehmer einer sowjetischen Expedition.
Ungeachtet der Fiktion des Romans und der Lügen seiner Protagonisten hat sich die Geschichte ziemlich genau so zugetragen, wie Franzobel sie erzählt. Er war selbst lange in Grönland, Kanada, in den USA, hat Originalschauplätze aufgesucht, Nachfahren und Ethnologen getroffen. Mit diesem Wissen versetzt er sich in die beiden fanatischen Männer hinein, stellt sie mit ihren Marotten, Dialekten und Schwächen dar. Als Leser leidet man mit, stolpert Seite für Seite mit ihnen ins Verderben, während der Erzählfluss durch die Geschichte trägt wie der Wind die Schiffe nach Norden.
Es gibt viele Pol- und Grönland-Romane, die meisten wurden aus der Perspektive der Eroberer und der Gescheiterten erzählt. Das ist bei Franzobel anders: Er blickt auch durch die Augen der Inughuit auf die Welt, vor allem durch die seines dritten Protagonisten Minik, auch ihn hat es wirklich gegeben. Minik ist einer von sechs "Polarmenschen", die Peary in Nordgrönland wie Beutekunst auf ein Schiff packen lässt und in die USA entführt. Sie leben im Keller des Naturwissenschaftlichen Museums und sind eine Attraktion, durch die Gitterstäbe werfen die Leute Zuckerstangen und Schokolade, bis man ein Schild aufstellt: "Füttern verboten". Vier von ihnen sterben schnell an Tuberkulose, einer wird zurückgeschickt, nur Minik bleibt. In New York sieht er zum ersten Mal Häuser, Züge, Bäume und sagt im Central Park: "Ihr müsst hundert Wörter für die Farbe Grün haben."
Erst viel später kehrt Minik zurück nach Grönland. Nachdem sich herausgestellt hat, dass Peary und Cook gelogen haben und keiner von beiden am Nordpol war, will er selbst dorthin. Nur: Er stellt fest, dass er all seine Fähigkeiten, die er einst besaß, um in dieser feindseligen und eiskalten Natur zu überleben, verloren hat.
Franzobel: "Hundert Wörter für Schnee". Roman. Zsolnay Verlag, 528 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 31.03.2025
Clash der Kulturen
LovelyBooks-Bewertung am 23.03.2025
in Teilen sehr gelungener, in anderen leider weniger, Blick auf die Arktisexpeditionen des Forschers Peary und ihre Folgen









