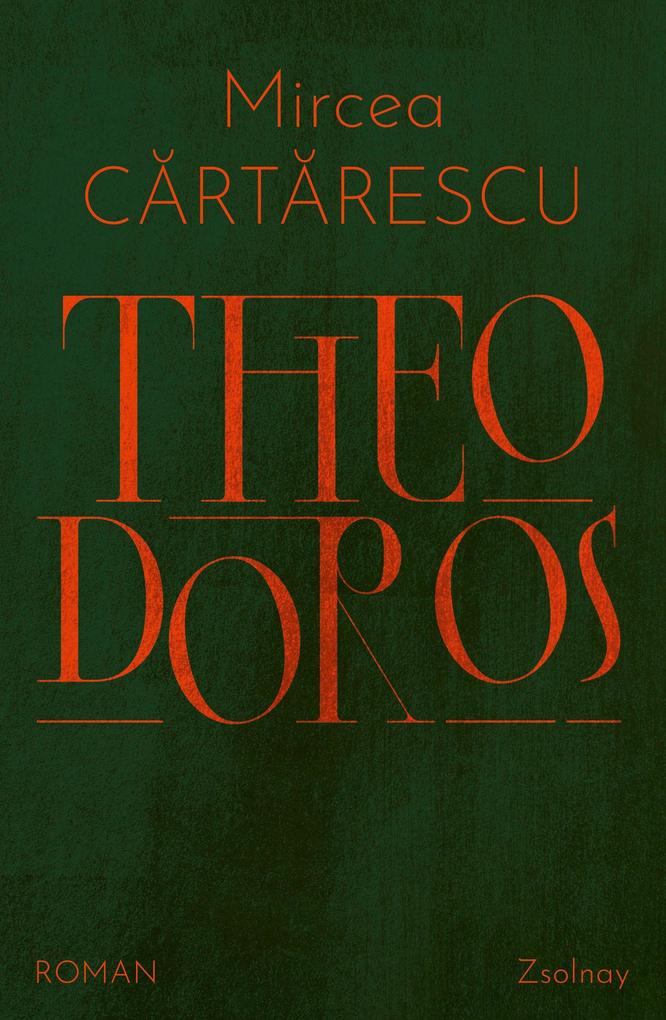
Sofort lieferbar (Download)
"Theodoros" ist Mircea Cartarescus neuer, literarischer und epochaler Roman - nach "Solenoid" geht er auch hier "aufs Ganze" (Burkhard Müller, Die Zeit).
Der Kaiser der Kaiser Afrikas, die englische Königin Victoria, Tudor, ein wissbegieriges Kind, die Königin von Saba: In 33 Kapiteln verschränkt Cartarescu Historisches, Phantastisches, Philosophisches mit schrecklich-schönen Abenteuergeschichten zu nichts weniger als einem Weltganzen, das bis in unsere Zeiten, bis zum Jüngsten Gericht reicht.
"Den Pistolenlauf noch im Mund, das Hirn verstreut auf dem roten Tisch." Ehe die britische Kolonialarmee die Bergfestung Magdala in Schutt und Asche legt und ihn als Geisel nimmt, setzt der äthiopische Kaiser am Ostersonntag des Jahres 1868 seinem Leben ein Ende. Nicht als gekrönter Despot, nicht als plündernder Seeräuber, sondern als Bojarendiener aus der Walachei, heißt es in Mircea Cartarescus neuem epochalen Roman.
Der Kaiser der Kaiser Afrikas, die englische Königin Victoria, Tudor, ein wissbegieriges Kind, die Königin von Saba: In 33 Kapiteln verschränkt Cartarescu Historisches, Phantastisches, Philosophisches mit schrecklich-schönen Abenteuergeschichten zu nichts weniger als einem Weltganzen, das bis in unsere Zeiten, bis zum Jüngsten Gericht reicht.
"Den Pistolenlauf noch im Mund, das Hirn verstreut auf dem roten Tisch." Ehe die britische Kolonialarmee die Bergfestung Magdala in Schutt und Asche legt und ihn als Geisel nimmt, setzt der äthiopische Kaiser am Ostersonntag des Jahres 1868 seinem Leben ein Ende. Nicht als gekrönter Despot, nicht als plündernder Seeräuber, sondern als Bojarendiener aus der Walachei, heißt es in Mircea Cartarescus neuem epochalen Roman.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
23. September 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
672
Dateigröße
2,83 MB
Autor/Autorin
Mircea Cartarescu
Übersetzung
Ernest Wichner
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
Romany
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783552075344
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Ein Buch, das einen gläubig machen kann, wenn man den Glauben an die Literatur schon verloren zu haben glaubt. C rt rescu schreibt sich mit seinem labyrinthischen Roman 'Theodoros' mitten unter die grössten Dichter. Schulter an Schulter steht er mit Jorge Luis Borges." Paul Jandl, NZZ, 23. 09. 24
"Ein Werk ohnegleichen, darauf angelegt, den Leser schwindlig zu erzählen, seine Sinne zu verrücken und seine Vorstellung von der realen Welt mit phantastischen Begebenheiten aus den Angeln zu heben. Geradezu betäubend ist die (von Ernest Wichner brillant übersetzte) purpurne Sprachgewalt C rt rescus, der seine imaginäre Romanwelt mit biblischen Wendungen veredelt und mit sinnlicher Opulenz und magisch-realistischer Phantasie derart ausschmückt, dass man sie nicht nur liest, sondern sie plastisch vor sich sieht, sie spürt, hört, schmeckt und riecht."
"Literatur auf dieser Stufe ist Vollendung, ist Magie. Lesen Sie dieses Meisterwerk. Sie werden das Gefühl haben, die Wahrheit der Welt mit dem Finger zu berühren." Le Monde
"Der Roman erinnert durch seinen Erzählreichtum, seine Tiefe und seine Gelehrsamkeit an die Urtexte. Mehr denn je hat Mircea C rt rescu, einer der besten Schriftsteller der Gegenwart, den Nobelpreis verdient." Le Nouvel Obs
"Jedes Buch von C rt rescu ist ein kleiner literarischer Sieg. Nur wenige Autoren sind in der Lage, so tief in sich selbst zu gehen. Buch für Buch bestätigt, dass er einer der größten literarischen Abenteurer der Gegenwartsliteratur ist." El Pais
"C rt rescu ist einer der größten lebenden Schriftsteller. Seine Literatur schafft eine neue Art, die Kunst des Romans zu verstehen und fügt dem Akt des Schreibens und Lesens neue philosophische und ästhetische Dimensionen hinzu. Seine Originalität ist absolut Er ähnelt nichts und niemandem." ABC Cultural
"Die neue Saison beginnt mit einem Paukenschlag in den Buchhandlungen. Hier ein Beispiel: Mircea C rt rescus Theodoros ist ein Roman, der ihn wohl direkt zum Nobelpreis führen wird." El Confidencial
"Der ehrgeizigste Roman des Herbstes . . . C rt rescu lässt sich vom Schicksal Theodoros II. zu einem monströsen Roman inspirieren, ein literarisches Ereignis, eine Geschichte, deren ungewöhnliche erzählerische Kraft an die der großen, alten und modernen, Erzähler anknüpft . . . In diesem Roman schwebt der Leser. Er wird von einem köstlichen und berauschenden Schwindel ergriffen, einem Gefühl der Freiheit, wie in der Kindheit, als er sich vorstellte, fliegen zu können." Le Temps
"C rt rescu erreicht mit 'Theodoros' einen herausragenden Höhepunkt seiner Karriere." Diario de Sevilla
"Seine literarische Meisterschaft ist unangefochten." Alexandru Bulucz
"Ein Werk ohnegleichen, darauf angelegt, den Leser schwindlig zu erzählen, seine Sinne zu verrücken und seine Vorstellung von der realen Welt mit phantastischen Begebenheiten aus den Angeln zu heben. Geradezu betäubend ist die (von Ernest Wichner brillant übersetzte) purpurne Sprachgewalt C rt rescus, der seine imaginäre Romanwelt mit biblischen Wendungen veredelt und mit sinnlicher Opulenz und magisch-realistischer Phantasie derart ausschmückt, dass man sie nicht nur liest, sondern sie plastisch vor sich sieht, sie spürt, hört, schmeckt und riecht."
"Literatur auf dieser Stufe ist Vollendung, ist Magie. Lesen Sie dieses Meisterwerk. Sie werden das Gefühl haben, die Wahrheit der Welt mit dem Finger zu berühren." Le Monde
"Der Roman erinnert durch seinen Erzählreichtum, seine Tiefe und seine Gelehrsamkeit an die Urtexte. Mehr denn je hat Mircea C rt rescu, einer der besten Schriftsteller der Gegenwart, den Nobelpreis verdient." Le Nouvel Obs
"Jedes Buch von C rt rescu ist ein kleiner literarischer Sieg. Nur wenige Autoren sind in der Lage, so tief in sich selbst zu gehen. Buch für Buch bestätigt, dass er einer der größten literarischen Abenteurer der Gegenwartsliteratur ist." El Pais
"C rt rescu ist einer der größten lebenden Schriftsteller. Seine Literatur schafft eine neue Art, die Kunst des Romans zu verstehen und fügt dem Akt des Schreibens und Lesens neue philosophische und ästhetische Dimensionen hinzu. Seine Originalität ist absolut Er ähnelt nichts und niemandem." ABC Cultural
"Die neue Saison beginnt mit einem Paukenschlag in den Buchhandlungen. Hier ein Beispiel: Mircea C rt rescus Theodoros ist ein Roman, der ihn wohl direkt zum Nobelpreis führen wird." El Confidencial
"Der ehrgeizigste Roman des Herbstes . . . C rt rescu lässt sich vom Schicksal Theodoros II. zu einem monströsen Roman inspirieren, ein literarisches Ereignis, eine Geschichte, deren ungewöhnliche erzählerische Kraft an die der großen, alten und modernen, Erzähler anknüpft . . . In diesem Roman schwebt der Leser. Er wird von einem köstlichen und berauschenden Schwindel ergriffen, einem Gefühl der Freiheit, wie in der Kindheit, als er sich vorstellte, fliegen zu können." Le Temps
"C rt rescu erreicht mit 'Theodoros' einen herausragenden Höhepunkt seiner Karriere." Diario de Sevilla
"Seine literarische Meisterschaft ist unangefochten." Alexandru Bulucz
 Besprechung vom 05.10.2024
Besprechung vom 05.10.2024
Ein Buch der Welt und die Welt aus dem Buch
Meisterwerk der Maßlosigkeit: Mircea Cartarescu gilt seit Langem als heißer Anwärter auf den Literaturnobelpreis. Nun erscheint der neue Roman des rumänischen Schriftstellers. "Theodoros" ist ein Erzähl- und Formspektakel.
Als Theodoros und seine beiden Piratenfreunde die griechische Insel Hydra erreichen, sind sie zunächst enttäuscht. Zwar ist der ganze Hafen voll von Schiffen, aber die vielen Menschen in den Gassen scheinen sich für die Neuankömmlinge nicht zu interessieren. Auf einem ihrer Streifzüge über die Insel fällt ihnen eine Statue auf, an der sie per Zufall einen geheimen Mechanismus entdecken. In der Tiefe des Sockels ist eine Windrose versteckt, die von einer langen stählernen Nadel durchzogen wird, dazu ist ein "leises Geräusch von Zahnrädchen" zu hören. Einer der Freunde spielt mit der Nadel und dreht sie dabei von Süd nach Südwest. Und plötzlich geschieht etwas Merkwürdiges, die Welt ringsum verändert ihr Aussehen. Und nicht nur das Aussehen wechselt, auch der Höreindruck wird ein anderer: "Tiefe Stille senkte sich herab, als wäre eine große Saphirkuppel über den Hafen von Hydra herabgesunken."
Die Bücher des rumänischen Großschriftstellers Mircea Cartarescu ähneln ein wenig dieser magischen Windrose. Beim Lesen meint man durch oft beschriebene Szenerien zu wandern, vor allem das Bukarest der Ceausescu-Zeit taucht immer wieder auf, einerlei, ob es sich um den frühen Roman "Nostalgia" handelt oder um das Alterswerk "Solenoid". Doch die vermeintliche Realität mitsamt ihren historischen Daten ist immer nur das Sprungbrett in eine höhere Art von Welt. Traum, Erinnerung und Phantasie sind hier genauso wirklich wie der tägliche Blick aus dem Fenster. Cartarescu lässt geflügelte Wesen und armgroße Skorpione durch seine Romane streifen oder vergräbt gewaltige Magnetspulen unter den Häusern Bukarests.
In "Theodoros", seinem neuen Roman, dreht er die Spirale des Phantastischen noch einmal um ein paar Windungen weiter. Die Kraft der Imagination wird in all ihren Nuancen gezeigt, von ihrem schmetterlingsgleichen Schönheitstrieb bis zu den tiefsten Abgründen der Brutalität. Cartarescu verbindet sein Faible für die phantastischen Gegenwelten der Moderne nun mit einer barocken Sprachlust und einer, fast möchte man sagen, Gier, Orte und Zeiten und Stimmen zu verschränken. Das reicht zeitlich weit in die Historie und in frühe kulturelle Speicher zurück. Aus all den biblischen Anspielungen könnte man leicht ein religionsgeschichtliches Oberseminar zusammenbasteln.
Natürlich hat Cartarescu keinen historischen Roman geschrieben, es geht vielmehr um Geschichten, um das Erschaffen von Welten und um das Erzählen selbst. "Und deine Geschichte kann beginnen", heißt es gleich im ersten Kapitel über die Hauptfigur, "verwoben mit all jenen anderen Geschichten, die wie Goldfäden aus dem ewigen Stickrahmen der Tage und Nächte funkeln." Nur sind es nicht allein Goldfäden, die hier eingesponnen werden, sondern immer wieder tiefschwarze Fasern.
Dabei spielt Bukarest diesmal eine eher untergeordnete Rolle. Viel wichtiger ist die historische Landschaft namens Walachei. Sie wird mal als "verschneit" und "wild" beschrieben, mal als Sommerwelt, deren Tage vom Duft nach Aprikosen und Quitten durchweht sind. Alles in allem auch sie mehr "eine Gegend der Märchen und des Traums als eine der Geographie". In diesem halb historischen, halb mythischen Gelände wird die titelgebende Hauptfigur im Jahr 1818 geboren. Als Sohn einer Dienstmagd aus dem griechischen Archipel und eines walachischen Pelzmützenschneiders. Man tauft den Jungen auf den Namen Tudor. Zu Tudors prägendsten Erinnerungen gehört, wie ihm seine Mutter stundenlang von Achill, Odysseus oder Alexander dem Großen erzählte. Später wird er selbst Geschichten lesen, wird sich in Scharteken ebenso versenken wie in Äsops Fabeln oder in die Abenteuer von Till Eulenspiegel.
Diese walachischen Etüden sind jedoch kein Selbstzweck. Worauf Carta- rescu abzielt, ist die langsame Verwandlung von Tudor in den Freibeuter Theodoros, der schließlich zum äthiopischen Kaiser Tewodoros II. wird. Cartarescus Tewodoros II. ist gegen Ende seines Lebens ein despotischer Herrscher, der allen möglichen Drogen verfallen ist, zu Wutausbrüchen neigt und mit Vorliebe Gewaltorgien inszeniert, die an Grausamkeit kaum zu überbieten sind. In den dreizehn Jahren zuvor hat er sich ganz Äthiopien unterworfen, zunächst mit Unterstützung der Briten, die ihn als Vertreter ihrer Interessen in der Region installieren wollten. Als er jedoch unberechenbar wird, kappt Queen Victoria die Verbindung und schickt eine Kolonialarmee, die ihn stürzen und verhaften soll. Bevor die Soldaten jene Bergfestung erreichen, in die sich Tewodoros mit seiner Familie zurückgezogen hat, erschießt er sich mit einer Pistole, die ihm Victoria als Geschenk hatte zukommen lassen.
Theodoros und Tewodoros II. gab es als historische Figuren tatsächlich. Ob sie indes ein und dieselbe Person waren, ist mehr als fraglich. So zumindest skizziert es Cartarescu in einer kleinen "Schlussbemerkung" seines Romans. Die Annahme habe "keine reale historische Grundlage", aber sie habe ihm als Schreibendem die faszinierende Gelegenheit einer "kontrafaktualen, fiktionalen, mythischen und archetypischen Geschichte" geboten.
So, wie in diesem Begriffsmonster nahezu alle Möglichkeiten der Narration enthalten sind, spinnt Cartarescu ein schier unglaubliches Romangewebe. Das beginnt schon bei den Welten, die aufgefaltet werden und zwischen denen er fortwährend wechselt. Sie reichen von König Salomon und der Königin von Saba über Äthiopien Mitte des neunzehnten Jahrhunderts bis in Splitter unserer Gegenwart und nahen Zukunft hinein, samt Jüngstem Gericht.
Zusammengehalten wird all dies durch eine raffinierte Erzählkonstruktion. Von der Ich-Erzählung, die noch in "Solenoid" prägend war, hat Cartarescu sich verabschiedet. Anfangs meint man Tewodoros II. zu lauschen, der in der Du-Form sich selbst (und seine Leserschaft) anspricht. Doch müsste er nicht um seinen vollendeten Selbstmord wissen? Und schnell merkt man, es gibt eine Gemeinschaft höherer Wesen, die über (fast) allem steht und erzählt, von einer Warte jenseits der Zeitlichkeit aus: Engel, stellt sich heraus, die Erzengel, um genauer zu sein. Ironisches Spiel mit dem biblischen Denken, aber auch diskreter Hinweis auf Tewodoros' Hybris, der sich am Ende sogar über Gott stellen will? Vielleicht vor allem eine Hommage an die Göttlichkeit des Erzählens, an den großen Traum vom "Buch der Welt und der Welt aus dem Buch".
Die erzählenden Erzengel jedenfalls nehmen für sich in Anspruch, jene Geschichten eines jeden Lebens in nuce schon zu kennen, die von den sterblichen Erdenwesen in allen Details erst noch gelebt werden müssen. Zugleich heißt es über Theodoros, in seinem Schädel wiederholten sich Gedanken immer wieder in der gleichen Schleife, wie ein Schneckengehäuse "in sich selbst zurückkehrt". Analog dazu erzählen die Erzengel in Spiralen. Ein ums andere Mal kommen sie auf die wichtigen Ereignisse in Theodoros' Leben zurück und reichern sie mit neuen Einzelheiten an oder verdichten sie, andersherum, zu einer Art narrativer Essenz.
So wird man beim Lesen hineingezogen in Theodoros' Wahrnehmungswelt und folgt zuweilen fast hypnotisch seiner Suche, die sich aus der Trias seiner manischen Wünsche speist: Er hat eine Angebetete aus Jugendjahren zum Ideal der reinen Liebe erhoben, nach dem er sich zeitlebens verzehrt. Er will die heilige Bundeslade finden, jene mythische Truhe, die den Bund Gottes mit dem Volk Israel symbolisiert. Dies führt ihn während seiner Zeit als Pirat in einer Art Schnitzeljagd hin und her durch den griechischen Archipel. Und er ist besessen davon, eines Tages Kaiser zu sein.
Es ist Ernest Wichners grandioser Übersetzung zu verdanken, dass Carta- rescus mal wahrnehmungsgesättigte, mal mit biblischer Metaphorik und Redeweise versehene Satzketten auch im Deutschen leuchten. Und nicht nur leuchten, sondern schmecken und riechen, zum Beispiel nach "Sandelholz, Zimtrinde, Nelken und Piment, nach Myrrhe und Narde und den sieben Sorten Pfeffer". Oder dass sie auch Geräusche erlebbar machen, etwa wenn man bis in die Laute hinein eine Formation von Spechten hört, wie sie "mit zinnoberroten Köpfen klopften an die nackten Bäume". Gleichzeitig kann man spüren, was Theodoros an der "Odyssee" neben dem Heldenmut bewundert: "die herrliche Musikalität der Zeilen".
Kunstvoll verschmilzt Cartarescu Splattermomente und biblisch anmutende Szenen, Trash und literarische Anspielungen auf Dante oder Joyce und ebenso Ironie und Hohen Ton. Dass der Roman auch seine Längen hat - geschenkt. Einzig die Verwunderung darüber, wie bereitwillig die erzählenden Erzengel Theodoros' Männlichkeitsphantasien reproduzieren, will nicht vergehen. Das Beeindruckende jedoch ist: Trotz seines Spiels mit der Romanform gelingt Mircea Cartarescu zugleich eine Studie darüber, wie jemand mit hoffnungsvollen Anfängen zum blutrünstigen Despoten wird. Auch in seinen Schilderungen der Exzesse des Krieges ist der Roman ganz gegenwärtig. Das macht dieses Buch voller "wahrer und gezinkter Wunder" zu einem großen. NICO BLEUTGE
Mircea Cartarescu:
"Theodoros". Roman.
Aus dem Rumänischen
von Ernest Wichner.
Paul Zsolnay Verlag, Wien 2024. 672 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 07.01.2025
Ein meisterhaftes Epos









