Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
10% Rabatt10 auf Tonieboxen, Figuren & Zubehör mit dem Gutscheincode: TONIE10
Jetzt einlösen
mehr erfahren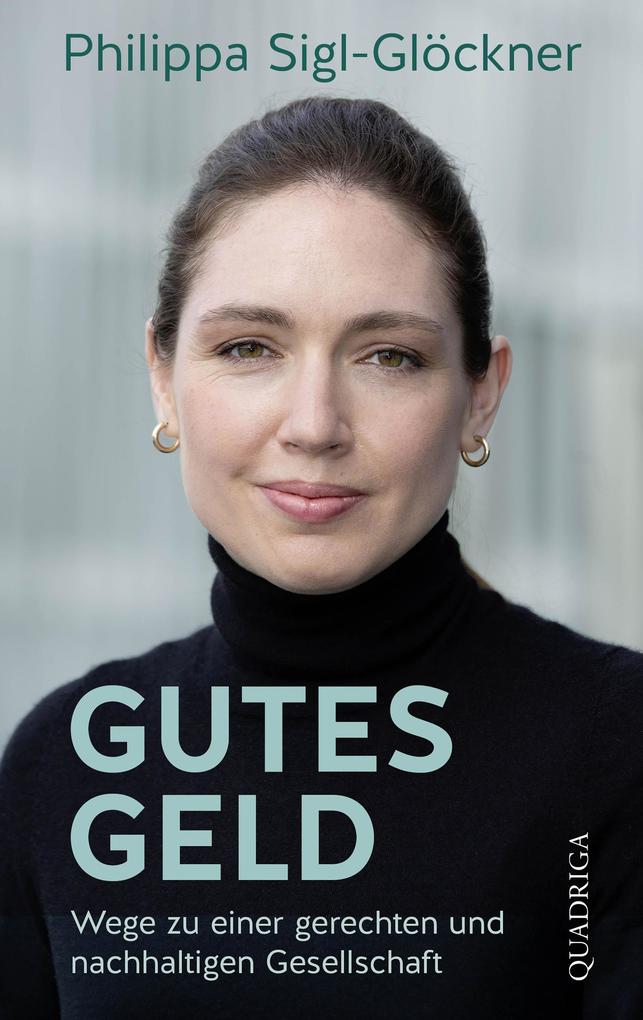
Sofort lieferbar (Download)
»Dieses Buch führt einen weit hinaus aus der eigenen politischen Komfortzone. Aber der Ausflug lohnt sich. « Giovanni di Lorenzo
»Frauen sollen weniger arbeiten als Männer«, »Wir brauchen Arbeitslosigkeit«, »Die Zukunft wird sein wie die Vergangenheit« - das sind tatsächlich die Regeln, nach denen die deutsche Regierung derzeit Entscheidungen über den Staatshaushalt trifft. Damit verspielen wir unsere Zukunft und gefährden die Demokratie. Es ist nicht der Kapitalismus an sich, der im Weg steht. Sondern die angebliche Alternativlosigkeit, die unsere Politik bestimmt. Dieses Buch zeigt, wie es anders geht. Mit gutem Geld für ein selbstbestimmtes Leben, wirksamen Klimaschutz und wirtschaftliche Unabhängigkeit von Diktatoren. Eine Geschichte von sparsamen Eichhörnchen und investierenden Kapitalisten, von Politik-Theater und zufälligen Kennzahlen - und der gefährlichsten Idee, die nie einer hatte.
»Der Staat als Unsicherheitenreduzierer - darum geht es der Autorin bei ihrem persönlichen Gang durch die finanzpolitischen Herausforderungen, vor denen unser Land heute steht. Beworben wird gedankliche Offenheit in Verbindung mit sicherem Gespür für Fragwürdigkeit. So werden die Widersprüche der deutschen Schuldenbremse enttarnt und der Reformbedarf benannt. «
Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft
Produktdetails
Erscheinungsdatum
27. September 2024
Sprache
deutsch
Auflage
1. Aufl. 2024
Seitenanzahl
285
Dateigröße
5,54 MB
Autor/Autorin
Philippa Sigl-Glöckner
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
ohne Kopierschutz
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783751764490
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 13.01.2025
Besprechung vom 13.01.2025
Das Scheitern der Ampel
Zur Unvereinbarkeit zweier Staatsverständnisse
Anfang November ging die Ampelkoalition zu Bruch. Der Anlass waren Forderungen des Bundeskanzlers zur Neuverschuldung, denen der Bundesfinanzminister nicht folgen wollte. Das vorliegende Buch ist deswegen höchst lesenswert, weil es die tieferen programmatischen Risse innerhalb der Koalition aufzeigt. Geschrieben wurde es von Philippa Sigl-Glöckner, Gründerin der Berliner Denkfabrik "Dezernat Zukunft" und im aktuellen Bundestagswahlkampf Direktkandidatin der SPD im Münchner Norden.
Das Buch ist zwei Monate vor dem Ampel-Aus erschienen. Wenn man es mit der Brille eines liberalen Ökonomen liest, versteht man schnell, warum das letzte Jahr der Koalition nach dem Karlsruher Urteil vom November 2023 derart mühsam verlaufen musste. Bis zum Urteil hatte die Koalition ausreichend Mittel, die programmatischen Unterschiede zu kaschieren, welche die drei Parteien in der Wirtschaftspolitik trennten. Sigl-Glöckner ist zu danken, dass sie diese Unterschiede eindrücklich offengelegt hat. Denn das Buch kann man als Manifest einer neuen sozialdemokratischen Wirtschaftspolitik lesen.
Wie sich das im Diskurs von Demokraten in der Mitte gehört, liegen die Unterschiede nicht im abstrakten Ziel. Es tut der politischen Kultur gut, zumal in polarisierten Zeiten, sich gegenseitig zuzugestehen, dass alle ihre jeweilige Wirtschaftspolitik betreiben, um das gute Leben für die Bürger zu ermöglichen. Die Unterschiede liegen in den Mitteln, das Ziel des guten Lebens zu erreichen, also beim wirtschaftspolitischen Instrumentarium. Sigl-Glöckner verwendet im Buch viel Raum für die Selbstverortung und findet in John Maynard Keynes die wichtigste Inspirationsquelle. Das ist zum einen eine Abgrenzung von Karl Marx, zum anderen aber auch von den Ordoliberalen. Letztere finden sich im Buch eher in der Form einer Karikatur: Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer etwa wird als "der ordoliberale Vier-Sterne-General des deutschen Beamtentums" tituliert.
Es ließe sich theoriegeschichtlich trefflich streiten, ob der elitäre Liberale Keynes mit dieser sozialdemokratischen Selbstverortung glücklich wäre. Und ob er als Theoretiker ganz besonderer Krisen wie der Großen Depression für unsere Zeit viel bietet, ohne dabei zu sehr verbogen zu werden. Trotzdem ist die Selbstverortung Sigl-Glöckners hilfreich. Im Buch taucht Friedrich August von Hayek, Keynes' großer Gegenspieler in den Dreißigerjahren, kein einziges Mal auf. Es ist aber genau der Kontrast zwischen einer von Hayek inspirierten Wirtschaftspolitik und dem von Keynes inspirierten Buch, welcher die Risse in der Ampel sowie die Weggabelungen für die nächste Bundesregierung besonders kraftvoll aufzeigt.
Ein Schwerpunkt des Buches ist die Schuldenbremse und ihre von der Autorin diagnostizierte Reformbedürftigkeit. In einer historischen Rückschau will sie zeigen, dass wichtige Parameter in den deutschen und den europäischen Schuldenregeln von historischen Zufälligkeiten bei den Verhandlungen und nicht von wissenschaftlichen Erkenntnissen resultierten. Die daraus erhobene Forderung lautet: "Redemokratisierung" der Schuldenregeln, im Extremfall sogar eine Anpassung durch das Parlament in jeder Registratur. Was dann überhaupt noch der Sinn von Regeln ist, erschließt sich auch bei näherem Hinsehen nicht.
Bei dieser Frage kann man einen Schritt zurücktreten und fragen: Was ist der Kern der hier vorgelegten politischen Ökonomie? Wie lässt sich Sigl-Glöckners Staat metaphorisch beschreiben? Weil im Buch oft von der Nachfragepumpe als entscheidendem Steuerungsinstrument die Rede ist, kann man den damit hantierenden Staat als einen Hydraulik-Ingenieur sehen, der die Wirtschaft als Röhrensystem durch ständige Änderung der Druckverhältnisse lenkt. In dieser Top-down-Perspektive auf die Wirtschaft sind Regeln hinderlich, da sie den weisen Ingenieur beim Ausüben seiner Kunst fesseln. In der Hayek'schen politischen Ökonomie hingegen tritt der Staat als Gärtner eines englischen Gartens auf. In dieser Bottom-up-Perspektive steht das Wachstum der einzelnen Pflanzen im Mittelpunkt des Systems. Anders als in einem französischen Garten kontrolliert der Gärtner nicht die einzelnen Pflanzen, sondern kultiviert die Beete des Gartens möglichst ohne Diskriminierung der einzelnen Pflanzen. Die Regeln enthalten das geronnene Wissen aus dem früheren Beackern des Gartens und sind deshalb eine wichtige Stütze des durch sie lernenden Gärtners.
Die beiden Staatsmetaphern haben unmittelbare wirtschaftspolitische Implikationen. Der Hydrauliker-Staat kennt in seiner Top-down-Logik "den Fortschritt" im Singular, der in seinem geschlossenen System klar ist, und will diesen Fortschritt in die einzig richtige Richtung verstärken. Das tut er mit Industriepolitik, etwa mit zehn Milliarden Euro für Intel. Der Gärtner-Staat versteht in seiner Bottom-up-Logik, dass es im offenen System des Gartens "die Fortschritte" nur im Plural geben kann. Deshalb darf er nicht eine einzelne Richtung vorgeben, sondern muss bessere Wachstumsbedingungen für alle Pflanzen gleichermaßen ermöglichen. Das tut er mit Ordnungspolitik, die mit den besagten Milliarden zum Beispiel anderthalb Jahre lang die Stromsteuer für alle streicht.
Dass es in der Wirtschaftspolitik wieder ein Mitte-Links und ein Mitte-Rechts gibt, welche mittels Industrie- oder Ordnungspolitik unterscheidbare Angebote an die Bürger unterbreiten, ist womöglich das wichtigste Vermächtnis der Ampel. STEFAN KOLEV
Philippa Sigl-Glöckner: Gutes Geld.
Wege zu einer gerechten und nachhaltigen Gesellschaft. Quadriga Verlag, Köln 2024, 288 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Gutes Geld" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









