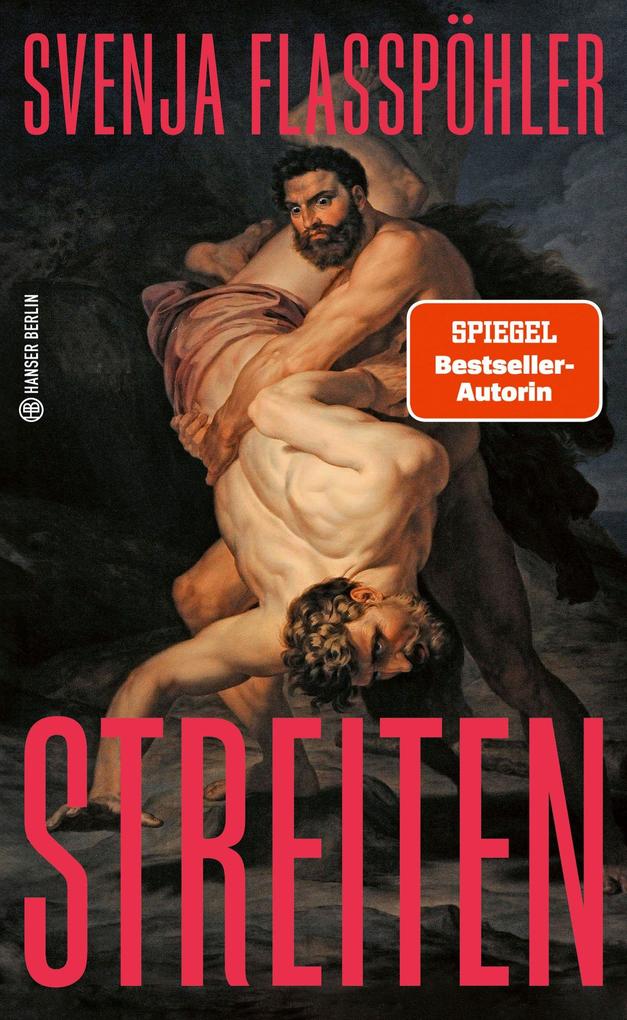
Sofort lieferbar (Download)
Wie geht Streiten heute? Svenja Flaßpöhler, eine unserer streitbarsten Denkerinnen, appelliert persönlich, philosophisch und pointiert für mehr richtigen Streit
"Warum also streite ich? Davon und von der Frage, was Streiten heißt, handelt dieses Buch." Svenja Flaßpöhler gilt als streitlustig, als jemand, der gerne angreifbare Positionen vertritt. Doch in ihr wohnt eine ganz andere Erfahrung: die eines Trennungskinds, das mit der Angst vor Streit und Eskalation aufgewachsen ist. In ihrem persönlich-philosophischen Essay zeigt sie, dass über das Streiten nachzudenken vor allem heißt, sich von Illusionen zu befreien. Ein Streit ist kein herrschaftsfreier Diskurs, sondern es geht um Macht: Der Abgrund der Vernichtung ist immer als Möglichkeit präsent. Gleichzeitig ist es gerade der Streit in seiner Unversöhnlichkeit, der uns vorantreibt und Veränderung bewirkt. Ein flammendes Plädoyer für Lebendigkeit, Mut und den Eros des Ringens.
"Warum also streite ich? Davon und von der Frage, was Streiten heißt, handelt dieses Buch." Svenja Flaßpöhler gilt als streitlustig, als jemand, der gerne angreifbare Positionen vertritt. Doch in ihr wohnt eine ganz andere Erfahrung: die eines Trennungskinds, das mit der Angst vor Streit und Eskalation aufgewachsen ist. In ihrem persönlich-philosophischen Essay zeigt sie, dass über das Streiten nachzudenken vor allem heißt, sich von Illusionen zu befreien. Ein Streit ist kein herrschaftsfreier Diskurs, sondern es geht um Macht: Der Abgrund der Vernichtung ist immer als Möglichkeit präsent. Gleichzeitig ist es gerade der Streit in seiner Unversöhnlichkeit, der uns vorantreibt und Veränderung bewirkt. Ein flammendes Plädoyer für Lebendigkeit, Mut und den Eros des Ringens.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
23. September 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
128
Dateigröße
1,65 MB
Reihe
Hanser Berlin LEBEN
Autor/Autorin
Svenja Flaßpöhler
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783446281905
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 04.02.2025
Besprechung vom 04.02.2025
Lustmörder in der Talkshow
Ohne Vernichtungswünsche geht's eben nicht: Svenja Flaßpöhler widmet sich auf recht autobiographische Weise dem Thema Streit
Die Rehabilitierung verpönter Gefühle und Verhaltensweisen erfolgt in Wellen. Vor einer Weile war die Wut an der Reihe, die in diversen Sachbüchern zur löblichen Antriebskraft erklärt wurde, jedenfalls dann, wenn es Frauen waren, die sie verspürten. Wut also ist gut - und Streit gescheit: Eine weitere Welle nämlich hat gleich mehrere Bücher in den Handel gespült, die uns das Streiten ans Herz legen oder eine Anleitung dazu liefern möchten.
Fürs Streiten plädieren so unterschiedliche Autoren wie Michel Friedman oder die einstige RTL-Krawalltalkerin Birte Karalus. Und nun auch Hanser Berlin, wo man dem Streiten einen eigenen Band in der Reihe "Das Leben lesen" gewidmet hat und es somit zu einem der "zehn wichtigsten Themen des Lebens" erklärt. Wundern wird das vor allem jene, für die in unseren Zeiten ohnehin viel zu viel gestritten wird. Auf das "Versöhnen" wird ja vielleicht noch einer der möglichen Bände elf bis zwanzig schauen.
Für das "Streiten" hat der Verlag eine Fachfrau gefunden, der das Attribut "streitbar" seit einigen Jahren als fester Teil ihrer Berufsbeschreibung anhaftet: die Philosophin Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des "Philosophie Magazins". Streitbar, das mag noch angehen für Flaßpöhler, als "streitlustig" aber, schreibt sie im Prolog ihres Buchs, sieht sie sich nicht. Für Lustigkeit nämlich ist ihr das Thema zu ernst.
Ein richtiger Streit, konstatiert sie, sei niemals harmlos, und er ziele - anders als sein verweichlichter Vetter Diskurs - auch nicht auf Verständigung: "Der Abgrund der Vernichtung ist immer da." Dem Streitenden sei an einem Sichtwechsel gar nicht gelegen, es gehe ihm um Herrschaft und um Macht: Das "andere Denken" gilt ihm als falsch, es "muss zu Fall gebracht werden". Aggression sei Grundvoraussetzung.
Wenn am Ende des Streits aber nicht Versöhnung und nicht einmal Verständigung steht, wozu überhaupt braucht ihn eine Gesellschaft? Im Grunde, so könnte man Flaßpöhler verstehen, um sich lebendig zu fühlen. Wenn, so schreibt sie mit Freud, dem Lebenstrieb Eros nicht ein wenig des Todestriebes Thanatos beigemischt sei, dann "drohen Kitsch und Konsenszwang, Scheinheiligkeit und Einheitsbrei". Sollten freilich die Bindungskräfte einer Gesellschaft dem Vernichtungsdrang nicht gewachsen sein, wäre die Konsequenz ihr Zerfall.
Und die dunklen Triebe sind mächtig. Lustmörder im freudschen Sinne hätten ihren Stammplatz etwa in Talkshows, wo sie die "Hinrichtung ihres Opfers vor klatschendem Publikum genießen". Auch Elon Musks Plattform X lebt laut Flaßpöhler "eindeutig vom Vernichtungswunsch, der Klicks generiert, und gibt der Tötungslust ganz gezielt Raum". Und damit nicht genug: Das zerstörerische Potential eines Streits zwischen Menschen in engen Beziehungen, wo man zu genau "um die Wunden des anderen weiß", sei längst ausgedehnt worden auf die Digitalwelt, wo "niemand mehr im eigentlichen Sinne fremd" und damit desto stärker gefährdet sei.
Mit wem aber soll man, um die Bindung nicht komplett zu kappen, streiten? Mit der AfD oder mit Trump, die "an sachlich konstruktiven Auseinandersetzungen überhaupt kein Interesse" haben, wie auch Flaßpöhler weiß? Eine einfache Lösung gibt es nicht. Die "notwendige Toleranz" einer Demokratie "gegenüber Andersdenkenden" könne schlimmstenfalls in ihre Abschaffung münden; gleichfalls könnten Brandmauern oder Parteiverbote zu "physischer Gewalt", ja sogar zum Bürgerkrieg führen. Über den einstigen AfD-Chef Gauland schreibt Flaßpöhler an einer Stelle, er habe in einer Rede "den Holocaust zum ,Vogelschiss' in der Geschichte" erklärt, was streng genommen nicht korrekt ist, da Gauland seinerzeit nicht den Holocaust erwähnte, sondern - auch wenn sich natürlich eines vom anderen nicht trennen lässt -"Hitler und die Nazis"; dies sei deswegen erwähnt, weil die Gegner unserer liberalen Demokratie beim politischen Streit zwar selbst auf Regeln pfeifen, auf deren Einhaltung durch andere jedoch höchsten Wert legen.
Eine Anleitung für das richtige Streiten liefert Svenja Flaßpöhlers Buch nicht. Dafür ist es über weite Teile eine autobiographische Erzählung. Flaßpöhler schildert, wie sie als Autorin, als Talkshow-Gast oder als zeitweilige Redakteurin eines öffentlich-rechtlichen Senders immer wieder - sehr bewusst - aneckte. Naturgemäß tragen die Memoiren dieser erfahrenen Streitkraft Züge der Selbstrechtfertigung. Zwar gesteht sie ein, dass bestimmte "polemische Zuspitzungen" von früher bei ihr heute "ein leichtes inneres Zucken auslösen", alles in allem aber beschreibt sie sich als unermüdliche Streiterin für Meinungsfreiheit - welcher erst die erlittene Ausgrenzung nach einem Talkshow-Auftritt zur möglichen Corona-Impfpflicht den Kampfesmut nahm. Dem "sozialen Tod" sei sie damals nur dank ihrer Entscheidung entkommen, eine Zeit lang stillzuhalten, schreibt Flaßpöhler. Und attestiert sich selbstkritisch, die Gefahr durchaus gesucht zu haben: "Auch im Heldentum kann ein gehöriges Maß an Narzissmus und Geltungsdrang stecken." Dass daran etwas Wahres ist, erkennt man an der Selbstverständlichkeit, mit der sie den Begriff Heldentum für sich beansprucht. Und trotzdem belegt das Beispiel, wie wichtig streitbare Geister gerade in Krisenzeiten sind. Wer wäre heute nicht heilfroh, dass eine Impfpflicht hierzulande nie durchgesetzt wurde?
Die Wurzeln der eigenen Streitbarkeit sieht Svenja Flaßpöhler in ihrer Kindheit begründet. Die schlimmen Auseinandersetzungen ihrer Eltern samt Geschrei und Handgemenge, der Auszug des Vaters und später die Entscheidung der Mutter, ein neues Leben zu beginnen und die Kinder in der Obhut des Stiefvaters zurückzulassen: All dies, so Flaßpöhler, habe die Rollen geformt, mit denen sie durchs Leben gehe - "die des Störenfrieds wie auch die der Mittlerin, die Kanäle offenhält, anstatt sie zu schließen". So betrachtet, wäre die Fähigkeit, engagiert zu streiten, dann gar nicht in erster Linie ein Talent. Sondern ein Schicksal. JÖRG THOMANN
Svenja Flaßpöhler: "Streiten".
Hanser Berlin Verlag, Berlin 2024. 128 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.















