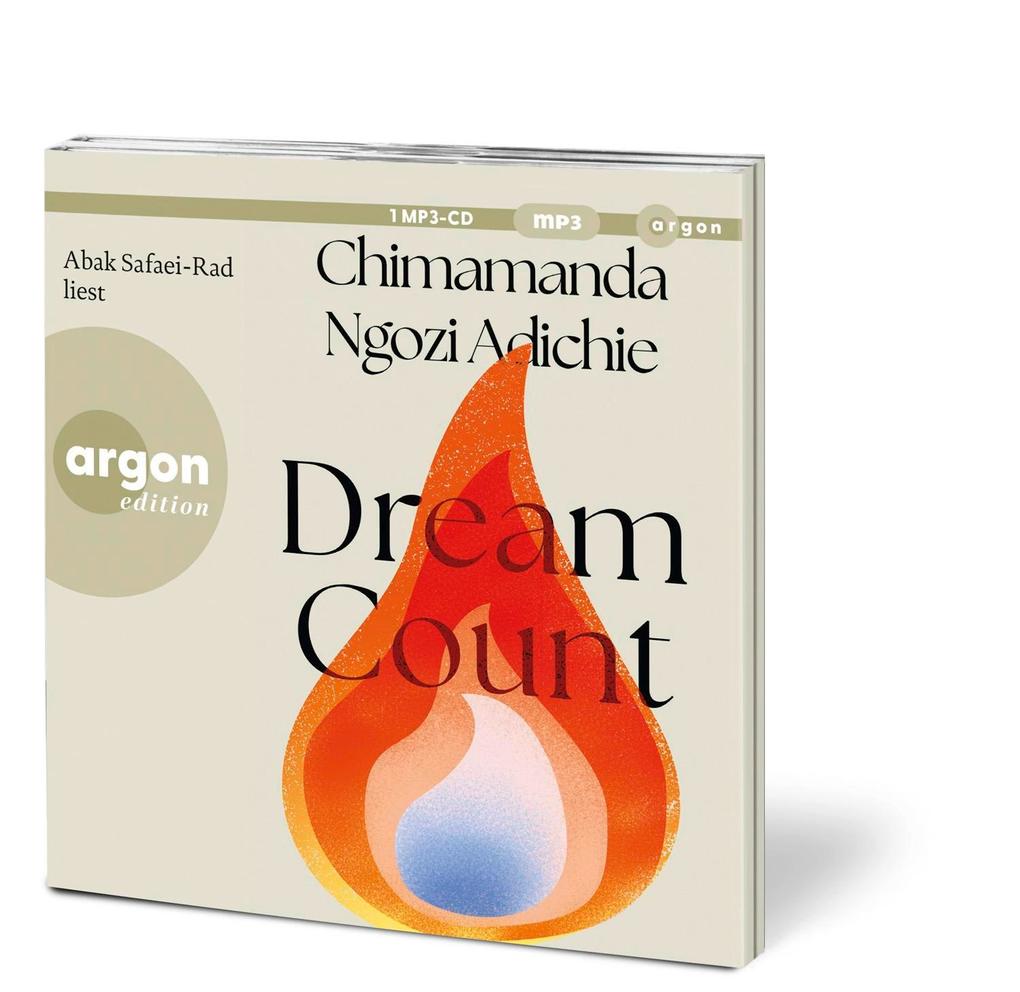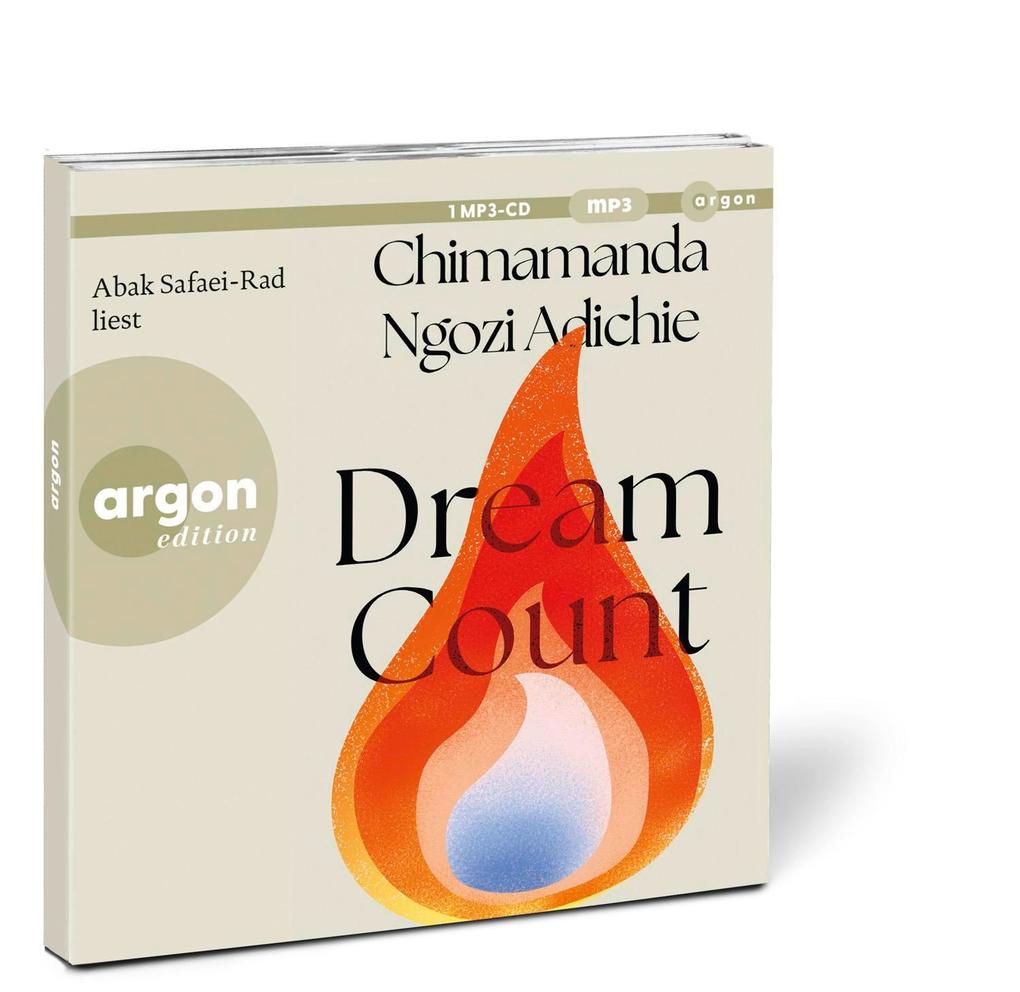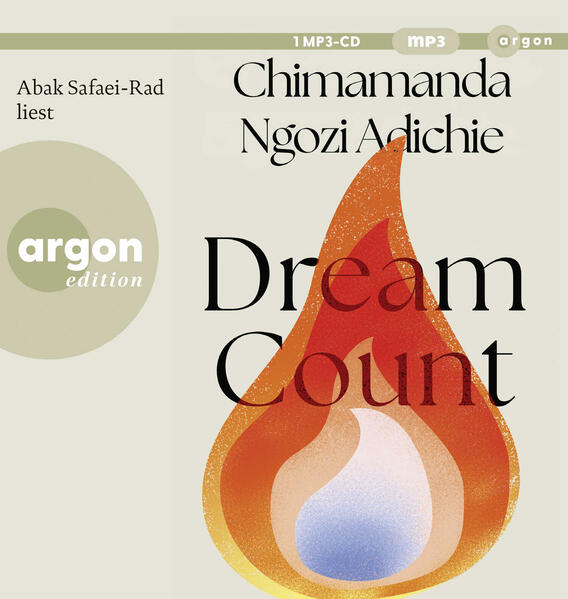
Zustellung: Mi, 25.06. - Fr, 27.06.
Noch nicht erschienen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Vier Frauen, vier Leben und die Sehnsucht nach Sichtbarkeit, Liebe und Selbstbestimmung. Der lang erwartete neue Roman von Chimamanda Ngozi Adichie. Spiegel-Bestsellerautorin, literarischer Superstar und feministische Ikone.
Chiamaka ist Reiseschriftstellerin, navigiert zwischen ihrer nigerianischen Heimat und ihrem amerikanischen Zuhause und versucht, sich im Rückblick auf die Männer ihres Lebens zu erklären, wann genau ihr ihre Träume abhandengekommen sind.
Zikora ist Anwältin und lebt in Washington D. C. Sie hat Erfolg und sich schon vor langer Zeit von ihrer Mutter distanziert; bis sie - plötzlich selbst Mutter und alleinerziehend - merkt, wie nahe sie ihr in ihrer vermeintlichen Schwäche ist.
Omelogor lebt in Nigeria. Als Bankerin hilft sie, Korruption zu verschleiern, aus Idealismus versucht sie, Frauen und ihre Unternehmen zu fördern. Doch eines Tages kündigt sie ihren Job, um in den USA zu studieren.
Kadiatou ist Chiamakas Haushälterin. Außerdem arbeitet sie in einem Hotel, wo ein mächtiger Gast sie schwer belästigt. Ein entwürdigender Prozess von Beweisaufnahme und Verfahren beginnt, in dem alles im Zentrum steht, nur nicht Kadiatous Schicksal.
Mitreißend, dringlich und klug spannt Chimamanda Ngozi Adichie über Kontinente hinweg die Geschichten von vier Frauen, die einander immer wieder die Hand reichen, und erzählt wie keine andere von existentieller weiblicher Erfahrung, die oft in den ganz kleinen Augenblicken zutage tritt: im Schwangerschaftstest auf dem Badewannenrand, in Tagträumen nach einem Augenkontakt im Flugzeug, im Warten auf einen Anruf oder im Moment plötzlich zusammengenommenen Mutes. Ein wegweisender, gegenwärtiger Roman über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Frauen in einer Welt, die es immer noch schwer macht, sich zusammenzutun.
Zehn Jahre nach dem Weltbestseller Americanah der neue große Roman von Chimamanda Ngozi Adichie.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
25. Juni 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage, Ungekürzte Ausgabe
Ausgabe
Ungekürzt
Laufzeit
1050 Minuten
Autor/Autorin
Chimamanda Ngozi Adichie
Übersetzung
Asal Dardan, Jan Schönherr
Sprecher/Sprecherin
Abak Safaei-Rad
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
MP3
Audioinhalt
Hörbuch
GTIN
9783839821992
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Jede träumt für sich allein
Es gibt viel zu viele Männer in diesem Buch: "Dream Count", der neue Roman der gefeierten Bestsellerautorin Chimamanda Ngozi Adichie.
Sie sind Freundinnen, mehr als nur Freundinnen. Sie sind Verbündete, Kampfgefährtinnen und Konkurrentinnen, Leidensgenossinnen und Schwestern im Geiste. Sie sind einander Beraterin, Beichtmutter, Coach und Therapeutin. Sie kennen ihre jeweiligen Geheimnisse, ihre Ängste und schwachen Stellen. Aber natürlich nicht alle. Sie wissen viel von einander. Aber natürlich nicht alles. Sie teilen ihre Träume. Aber jede träumt für sich allein.
"Dream Count", der neue Roman der international erfolgreichen Bestsellerautorin Chimamanda Ngozi Adichie, verfolgt die Lebenswege von vier einander eng verbundenen Frauen, auf drei Kontinenten und zum Teil über mehrere Jahrzehnte hinweg. Wir sollen diesen vier Frauen zuhören, mit ihnen leiden, mit ihnen kämpfen, streiten, glücklich oder verzweifelt sein. Auf gewisse Weise handelt es sich um ein Ermächtigungsbuch, aber am Ende ist es gar nicht so leicht zu sagen, worauf genau diese Ermächtigung eigentlich abzielt. Das ist eine der Stärken des Romans, der auf gewisse Weise auch ein Frauenbuch ist, denn es ist ein Roman über Frauen, der von einer Frau nicht nur für Frauen, aber wohl vor allem für Frauen geschrieben wurde. Männer kommen darin auch vor, sogar häufig und zahlreich. Männer nehmen viel zu viel Raum in diesem Buch ein. Das ist eines der Probleme des Romans, aber nicht einmal sein größtes.
Adichie beginnt mit Chiamaka, einer jungen, bildschönen Nigerianerin aus reichem Haus, die in den Vereinigten Staaten lebt und davon träumt, Schriftstellerin zu werden, aber auch noch andere Träume hat: "Ich habe mich immer danach gesehnt, von einem anderen Menschen erkannt zu werden, wirklich erkannt. Manchmal hegen wir jahrelang Sehnsüchte, die wir nicht benennen können, bis sich ein Riss im Himmel auftut, durch den wir uns selbst erkennen, wie eine Offenbarung." So lauten die beiden ersten Sätze des Buches, und mit ihnen schlägt Adichie einen Ton an, den sie häufig aufgreifen wird, einen Ton, der vibrieren soll vor Ernsthaftigkeit, Pathos und Gravitas, der aber nicht selten einfach nur pompös klingt. Adichie ist nicht gerade sparsam im Umgang mit ihren stilistischen Mitteln. Sie mag es eindringlich, überdeutlich, nachdrücklich. Man könnte auch sagen: Sie buttert ihr Brot gern von beiden Seiten. Auf die Dauer von mehr als fünfhundert Seiten ist das keine leichte Kost.
Chiamaka nimmt die Pandemie zum Anlass, ihr bisheriges Leben Revue passieren zu lassen. Aus der Autorinnenkarriere wird nichts, vielleicht fehlt es ihr an Ausdauer, vielleicht an Talent, vielleicht auch nur am nötigen Selbstbewusstsein. So wird Chiamaka Reisejournalistin, aber Aufsehen erregen ihre überwiegend in entlegenen Onlinemagazinen erscheinenden Reportagen nur, wenn Leser der Autorin vorwerfen, sie pflege die Perspektive einer verwöhnten First-Class-Reisenden. Dass derlei Vorwürfe nicht ungerechtfertigt sind, macht Adichie allerdings schnell deutlich: Chiamaka fliegt auf eigene Kosten für eine lausig bezahlte Onlinereportage nach Zürich, lässt sich dort stundenlang mit dem Taxi durch die Gegend chauffieren und hält das für eine Recherche über das Zürcher Umland. Adichie vergöttert ihre weiblichen Hauptfiguren zwar, lässt aber keinen Zweifel daran, dass auch Göttinnen nicht perfekt sind.
Auf beruflichem Gebiet hat Chiamaka zwei Probleme: Sie neigt erstens zu Selbstzweifeln, die zweitens in der Regel leider begründet sind. In ihrem Privatleben hält sie es umgekehrt: Jeder neue Mann löst eine gigantische Euphorie aus, die in keinem angemessenen Verhältnis zu seinen recht überschaubaren Qualitäten steht. Unglücklicherweise urteilt sie über Männer nicht viel anders als über die Städte, die sie bereist: ein erster Blick, und ihr Urteil ist gefällt. Zum Beispiel Chuka: Ausstrahlung eines Löwen. Außergewöhnliche Raum- und Selbstbeherrschung. "Archetyp eines Erwachsenen, so höflich und korrekt, so vernünftig. Er wird Vertrauensschüler in der Oberstufe gewesen sein."
So wie dem armen Chuka geht es vielen Figuren in diesem Buch: Sie stecken in Adichies detailversessenen Beschreibungen fest wie in einem Schraubstock. Denn im Grunde beschreibt diese Autorin ihre Figuren nicht, sie definiert sie. Dadurch werden sie nicht leblos, aber uninteressant. Vor allem, wenn sie wie die Männer in Chiamakas oder Omelogors Leben im Gänsemarsch am Leser vorbeidefilieren. Es sind zu viele, es sind immer die Falschen, und eher früher als später sind sie wieder weg. Wenn man bedenkt, dass es sich bei "Dream Count" um den 2025 erschienenen Roman einer als Feministin geltenden Autorin handelt, sind die Beharrungskräfte des romantischen Liebesideals, das hier zum Ideal der Kleinfamilie führen soll, schon einigermaßen erstaunlich.
Der Titel des Romans ist eine kluge, aber auch recht morbide Anspielung auf den Begriff "Body Count", eine in sozialen Medien verwendete Bezeichnung für die Anzahl von Sexualpartnern, die eine Person hatte. Ursprünglich kommt der Terminus jedoch aus dem Militärbereich, wo er für die Anzahl der getöteten Angehörigen der gegnerischen Kriegspartei verwendet wird. Wenn Adichie nun von "Dream Count" spricht, sind damit sowohl die von der Bildfläche verschwundenen Männer im Leben ihrer Erzählerinnen gemeint wie auch die geplatzten oder in Erfüllung gegangenen Träume.
Also ein Roman von heute über vier Frauen, die Bilanz ziehen in ihrem Leben, die sich Rechenschaft geben über ihre Erfolge, Fehler, Versäumnisse? Das ist "Dream Count" tatsächlich, aber zugleich wirkt dieser Roman, als wäre er aus einer anderen Zeit. Die Corona-Jahre geben den zeitlichen Rahmen vor, aber alles andere lässt sich historisch kaum verorten. Die Szenen, die im Milieu selbstgerechter liberaler Intellektueller spielen, sind glänzend geschrieben und scharfzüngig formuliert, etwa wenn es heißt, dass linke Weiße es nicht mögen, wenn Schwarze in Reichtum leben, weil sie dann kein Mitleid mit ihnen haben können. Aber die Paradoxien und Selbstwidersprüche der Wokeness hat Adichie ganz ähnlich bereits vor zwölf Jahren in "Americanah" beschrieben. Und auch die Spannungen und Herausforderungen, die sich daraus ergeben, dass Chiamaka, Omelogor und ihre Freundin Zikora in der konservativ geprägten nigerianischen Oberschicht aufgewachsen sind, aber in den Vereinigten Staaten geprägt wurden, sind heute nicht viel anders, als sie in "Americanah" waren. Politik wird jetzt nicht erwähnt, "Dream Count" spielt in einer unspezifischen, fast schon zeitlosen Gegenwart.
Das mag damit zu tun haben, dass Kadiatou, die vierte der Hauptfiguren des Romans, zeitlich exakt zu verorten ist, nämlich im Jahr 2011. Wie Zikora, eine erfolgreiche Juristin und alleinerziehende Mutter, und Omelogor, die als Bankerin durch Korruptionsgeschäfte und Geldwäsche reich geworden ist und nun als weiblicher Robin Hood kleine Projekte selbständiger Frauen finanziert, lebt auch die älter gewordene Chiamaka allein. Aber doch nicht ganz allein, denn Hauspersonal stellt für die drei Frauen eine Selbstverständlichkeit dar, und Kadiatou ist Chiamakas Haushaltshilfe und Mädchen für alles. Nebenher arbeitet sie als Zimmermädchen in einem Luxushotel, in dem sie eines Tages von einem Gast vergewaltigt wird.
Adichie hat ihre Figur der aus Guinea stammenden Hotelangestellten Nafissatou Diallo nachempfunden, die im Mai 2011 von dem damaligen IWF-Direktor Dominique Strauss-Kahn in New York vergewaltigt wurde. Sie hat den Fall nicht nur gründlich recherchiert, sondern dem Opfer ein Leben vor dem Gewaltverbrechen gegeben: eine Kindheit in Guinea, eine Tochter, ein Leben als Immigrantin. Dieses vierte und letzte Kapitel ist das stärkste des Romans, aber auch das problematischste. Denn Kadiatou, das wehrlose Opfer des reichen weißen Mannes, wird nun zum Mündel reicher schwarzer Frauen, die sich vehement, aber vergeblich dafür einsetzen, dass ihr Gerechtigkeit widerfährt. Das soziale Gefälle zwischen Kadiatou und ihrer Arbeitgeberin Chiamaka und deren Freundinnen wird dadurch aber nicht überwunden, sondern noch verstärkt. Vom Traum einer klassenlosen Gesellschaft hat Kadiatou vermutlich noch nie gehört. Und ihre Freundinnen haben wohl kaum vor, ihr davon zu erzählen. HUBERT SPIEGEL
Chimamanda Ngozi Adichie: "Dream Count". Roman.
Aus dem Englischen von Asal Dardan und Jan Schönherr. Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2024. 528 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Dream Count" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.