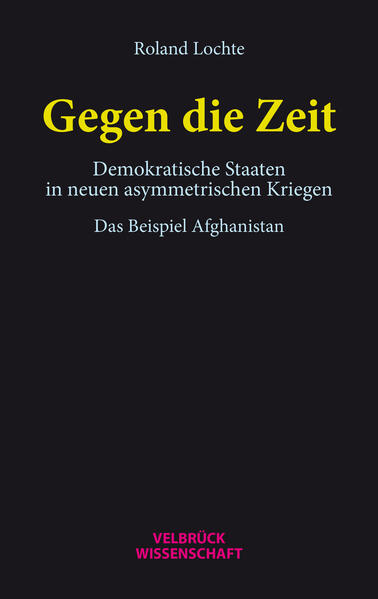
Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Mit welchen strukturellen und strategischen Herausforderungen sind mächtige Staaten in modernen asymmetrischen Konflikten konfrontiert? Warum gelingt es ihnen nicht - wie das Scheitern der USA im Vietnamkrieg und das unrühmliche Ende des Afghanistan-Einsatzes 2021 erwiesen haben -, ihre militärische Überlegenheit auszuspielen? Roland Lochte rückt in seiner politikwissenschaftlichen Studie die bislang unterschätzte Rolle der strategischen Dimension Zeit in den Fokus. Diese kann sich insbesondere im Kontext der demokratischen Verfasstheit der westlichen Staaten, aber auch in autokratischen Regimes folgenschwer auswirken. So gelingen dem Autor innovative Erweiterungen klassischer Kriegstheorien von Kant bis Clausewitz. Am Beispiel des 20-jährigen Afghanistan-Einsatzes zeigt er detailliert, wie zeitliche Dynamiken, gesellschaftlicher Rückhalt und strategische Fehler den Erfolg militärischer Interventionen beeinflussen.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
24. Januar 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage 2025
Seitenanzahl
444
Autor/Autorin
Roland Lochte
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
640 g
Größe (L/B/H)
222/140/31 mm
ISBN
9783958323889
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 01.04.2025
Besprechung vom 01.04.2025
Nicht die Taliban waren der größte Feind
Warum der Afghanistan-Einsatz des Westens von vorneherein keine Aussicht auf Erfolg hatte
Als im Februar die Enquetekommission des Bundestages ihren Abschlussbericht vorlegte, rückte er noch einmal ins öffentliche Bewusstsein: der Afghanistan-Einsatz, von dem nach zwanzig Jahren am Hindukusch nicht viel mehr geblieben ist als der Staub, den die Soldaten des Westens an ihren Stiefeln mit nach Hause brachten. Allein 100.000 Bundeswehrsoldaten waren dort, 59 von ihnen fielen, Hunderte wurden verwundet, Tausende traumatisiert.
Das Versagen des Westens und der Bundesrepublik, lange Zeit (und mit großem Abstand) zweitgrößter Truppensteller hinter den USA, ist inzwischen Allgemeingut. Und es war die Enquetekommission, die in ihrem Bericht die wesentlichen Symptome des Versagens noch einmal zusammenfasste: jahrelange Schönfärberei der Lage in Afghanistan durch die Regierenden bis kurz vor dem Kollaps, zu wenige Kräfte vor Ort, mangelhafte und der Lage nicht angemessene Ausrüstung sowie eine chaotische Zusammenarbeit der Ressorts, wenn sie denn überhaupt stattfand. So fabulierte die damalige Koalition noch im März 2021 davon, dass das zivile deutsche Engagement "zur Entstehung eines demokratisch kontrollierten Staatswesens, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung, zum Zugang zu Bildung sowie insbesondere zur Stärkung der Rechte von Frauen und Kindern" beitragen könne. Dass sich die Verantwortlichen zehn Jahre zuvor in der Region Kunduz dem Vernehmen nach nur mit Polaroidfotos von zurückkehrenden Bundeswehrpatrouillen ein Bild vom Stand ihrer Projekte machten - vergessen.
Die Dissertation von Roland Lochte, die fast zeitgleich mit dem Abschlussbericht erschien, greift die Fragen aller Fragen auf, auf welche auch die Enquetekommission keine abschließenden Antworten geben konnte: Können Demokratien asymmetrische Kriege überhaupt gewinnen? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen?
Die Antwort des Autors, die er in seiner über 400 Seiten umfassenden politikwissenschaftlichen Analyse unter Einbeziehung namhafter Referenzgrößen von Clausewitz über Kant bis Münkler erarbeitet, ist ernüchternd und stellt die Empfehlung der Kommissionsmehrheit infrage, internationalen Einsätzen weiterhin einen hohen Stellenwert beizumessen. Nach Lochte ist jeder asymmetrische Krieg, den eine oder mehrere Demokratien in der Ferne zu führen beabsichtigen, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und unter den vielen Faktoren, die dafür verantwortlich sind, gibt es einen, der für Lochte alles entscheidet: die Zeit. Das Dilemma, das der Autor ausmacht, fasst er in folgende Gleichung: "(...) je länger ein Krieg dauert und je mehr sich dadurch die Anzahl der gefallenen und verwundeten Soldaten und der um sie trauernden Angehörigen sowie die finanziellen Kosten akkumulieren, und je länger Erfolge ausbleiben, umso stärker werden die Staatsbürger gegen den Krieg opponieren".
Anhand von Umfragen, Zitaten führender Politiker aus den USA und Deutschlands zeigt Lochte, dass die Entwicklungen in beiden Staaten - bei allen Unterschieden - grundsätzlich ähnlich verliefen. So glaubte in beiden Ländern eine große Mehrheit, sich nach den Terroranschlägen von New York und Washington verteidigen zu müssen. Gleichzeitig wuchs auf beiden Seiten des Atlantiks mit der Zeit der Anteil derer, die es für richtig hielten, die eigenen Truppen nach Hause zu holen.
Dass die Unterstützung für einen lang andauernden asymmetrischen Einsatz in der Ferne ihre Grenzen hat, war den Verantwortlichen, wie Lochte überzeugend belegt, in beiden Ländern von Anfang an bewusst. Und auch wenn die maßgeblichen Referenzinstanzen für die Regierungen in den USA und Deutschland (der Vietnamkrieg für die Regierung von George W. Bush und der Zweite Weltkrieg für die Regierung von Gerhard Schröder) unterschiedlich waren, so führten sie doch in beiden Fällen dazu, dass die Regierenden von Anfang an ohne massive militärische Interventionen am Boden planten. Dabei bewegten sie und ihre Nachfolger sich - auch bei allen zwischenzeitlichen Truppenaufstockungen und Strategiewechseln - stets auf einem Niveau, das die Unterstützung langsam schwinden ließ und zugleich nicht ausreichte, um die Taliban dauerhaft zurückzudrängen und damit den Hindukusch als Rückzugsraum für den internationalen Terrorismus auszuschalten.
Trotz aller technischen und finanziellen Überlegenheit, so Lochte, hätten die Fundamentalisten den Krieg nur in die Länge ziehen und abwarten müssen, bis die Unterstützung des Westens schwindet. Dass Präsident Donald Trump ihnen das Land später ohne substanzielle Gegenleistung auf dem Silbertablett servierte und sich sein strategisches Geschick darauf beschränkte, das folgende vietnamgleiche Desaster seinem Nachfolger Joe Biden zu überlassen, erinnert einmal mehr an die Verhandlungsschwäche des selbsternannten Dealmakers, beschleunigte für den Autor aber nur das Unvermeidliche. Dass ein Strategiewechsel etwas am Ausgang des Krieges hätte ändern können, so Lochte abschließend, sei äußerst unwahrscheinlich. Und dass auch schon zu Beginn.
Hätte US-Präsident George W. Bush mit einer Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede à la Winston Churchill im Zweiten Weltkrieg eine Chance gehabt, die langfristige Unterstützung der Amerikaner für einen umfassenden Truppeneinsatz am Hindukusch zu erhalten? Ein frühzeitiger Einsatz von U.S. Army Rangers in der Schlacht von Tora Bora hätte nach Ansicht vieler Fachleute Osama bin Laden und die Al-Qaida-Führung frühzeitig zur Strecke gebracht. Und auch ein von vornherein auf ein oder zwei Jahrzehnte angelegter Einsatz mit Zehntausenden Soldaten und einer ausgeklügelten Strategie, um die Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen, hätte ein anderes Signal an die Taliban gesendet. Wie dem auch sei: Die Devise für die Zukunft, so scheint es nach der Lektüre des Buches, kann bei asymmetrischen Kriegen nur "alles oder nichts" lauten. Ob Ersteres grundsätzlich ausgeschlossen ist, wie der Autor folgert, mag man bezweifeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass die westlichen Staaten auf lange Sicht von Einsätzen wie in Afghanistan Abstand halten werden, ist äußerst hoch. LORENZ HEMICKER
Roland Lochte: Gegen die Zeit. Demokratische Staaten in neuen asymmetrischen Kriegen. Das Beispiel Afghanistan.
Velbrück Wissenschaft, Weilerswist 2025, 444 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Gegen die Zeit" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









