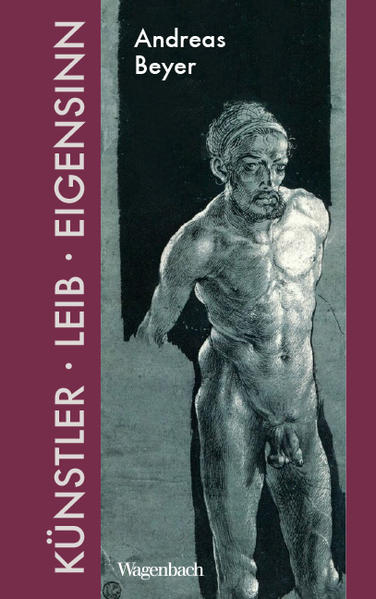
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 02.12.2022
Besprechung vom 02.12.2022
Vom Schaffen des Körpers des Künstlers
Auch die Diät nicht vergessen! Andreas Beyer optiert dafür, sich näher mit der Leiblichkeit von Künstlern zu befassen, und hält sich dafür an solche der Renaissance.
Die ersten beiden Sätze der "Geschichte der Kunst" von Ernst Gombrich, dem weltweit meistverkauften Buch zum Thema der bildenden Kunst, lauten so: "Die Kunst gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt nur Künstler." Das leuchtet ein, denn wir verwenden den Begriff "Kunst" als Sammelbegriff für eine Gesamtheit von sehr verschiedenen Objekten. Nun hätte Gombrich aber eigentlich sagen müssen, in der wirklichen Welt gäbe es nicht die Kunst als solche, sondern nur einzelne Kunstwerke. Dass er stattdessen behauptet, es gäbe nur Künstler, ist merkwürdig.
Andreas Beyer zitiert Gombrichs Sätze gleich zu Beginn seines unlängst erschienenen Buchs. Er äußert sich allerdings nicht zu der logischen Irritation, die sich daraus ergibt, sondern nutzt das Zitat nur zur Bekräftigung seiner Überzeugung, dass sich die Kunstgeschichtsschreibung nicht allein mit den Werken beschäftigen sollte, sondern auch mit deren Urhebern.
Beyers Buch ist ein Buch über Künstler, und vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass Künstlerinnen darin so gut wie gar nicht vorkommen. Das liegt daran, dass sich die Ausführungen auf die Zeit von etwa 1400 bis 1550 konzentrieren, aus der nur wenige Zeugnisse von Künstlerinnen überliefert sind. Malerinnen wie Lavinia Fontana und Sofonisba Anguissola machten erst später von sich reden.
Über die Künstler jener Zeit gibt es hingegen eine Fülle von mehr oder weniger detaillierten Berichten. Giorgio Vasari erzählt in seinen ab 1550 gedruckten Lebensbeschreibungen von mancherlei Eigenarten der jeweiligen Künstler, ihren Charakteren, Krankheiten, Essgewohnheiten und dergleichen. Über Piero di Cosimo erfahren wir zum Beispiel, dass er bei der Zubereitung von Leim auch fünfzig Hühnereier kochte, die er dann Tag für Tag verzehrte.
Beyer interessiert sich für solche Details. Nach seiner Meinung wird die konkrete Praxis von Künstlern viel mehr durch materielle Bedingungen bestimmt, als es eine Auffassung einräumen möchte, die "Ideen" und intellektuelle Arbeit als zentral erachtet. Weshalb die Forschung immer auch die besondere leibhaftige Konstitution der Künstler berücksichtigen sollte. Eine ausführliche methodologische Begründung hierfür hat der Autor sich und seiner Leserschaft jedoch erspart. Wie Erwin Panofsky, der mit fortschreitendem Alter immer mehr zu der pragmatischen Maxime neigte, dass die Diskussion einer Methode nur deren Anwendung erschwert, hat sich auch Beyer entschlossen, sein umfangreiches Material ohne aufgeblähte Programmatik zu präsentieren.
Stattdessen erläutert Beyer in vierzehn Abschnitten sehr anschaulich anhand von unzähligen konkreten Beispielen alle möglichen Dimensionen, in denen die Leiblichkeit eines Künstlers zur Geltung kommen kann. Dazu zählen der persönliche Stil, die handwerkliche Virtuosität, die Art zu signieren, aber auch Kleidung, Geselligkeiten, Essgewohnheiten, Verdauungsstörungen, Alkoholkonsum, Krankheiten, Träume, sexuelle Praktiken, Varianten des Selbstmordes und noch vieles mehr.
Wenn man sich für solche Aspekte der Künstlerexistenz nicht weiter interessiert, kann das durchaus gute Gründe haben. Es lässt sich etwa die Maxime anführen, dass man das bestmögliche Verständnis eines bestimmten Werkes nur dann erreicht, wenn man sich auf das konzentriert, was an diesem selbst ablesbar ist. Demnach wäre es zum Beispiel müßig zu fragen, was uns ein Künstler mit seinem Werk sagen will, denn das Einzige, was zählt, ist das, was er wirklich gesagt hat. So wie die Intentionen des Künstlers scheinen auch seine Ängste und Wünsche für die Deutung seiner Werke belanglos zu sein - und seine Ernährungsgewohnheiten und Magen-Darm-Beschwerden erst recht. Berichte über Dürers Albträume und Pontormos unregelmäßigen Stuhlgang wären demnach bestenfalls der Kategorie "Klatsch und Tratsch" zuzuordnen.
Eine solche generalisierende Schlussfolgerung wäre jedoch voreilig, denn die entscheidende Frage, ob die leiblichen Zustände eines Künstlers Einfluss auf seine Werke haben oder nicht, kann man nicht im Allgemeinen, sondern nur für jeden konkreten Einzelfall beantworten. Wenn Dürer von sintflutartigen Wassermassen träumt, die auf die Erde herabstürzen, dann ist das von Bedeutung, da er diesen Traum in einem Aquarell wiedergegeben und ihn ausführlich in Worten geschildert hat. In diesem Fall wirkt sich dieses Erleben offenkundig auf eines seiner Werke aus. Ob sich in Pontormos Gemälden Symptome seiner Verstopfung entdecken lassen, ist dagegen eher fraglich.
Wenn man sich nun allein auf jene Werke beschränkt, in denen sich tatsächlich Auswirkungen der körperlichen Konstitution ihrer Urheber nachweisen lassen, steht man allerdings vor dem Problem, mit einer Fülle von besonderen Einzelfällen konfrontiert zu sein, die sich nicht länger in eine historische Abfolge bringen lassen. Jeder Körper ist etwas Singuläres und jede davon zeugende Kunst ebenfalls. Deshalb nötigt Beyers Konzeption zu einem Rückgang von der Kunstgeschichte zur älteren Künstlergeschichte. Damit fügt sich diese aber zugleich in den Kontext des gegenwärtig herrschenden Pluralismus, dem die Suche nach historischen Entwicklungen nicht mehr wichtig ist. Durch ein Denken in simultaner Diversität, wie man es bei Vasari noch findet und wie es sich seit einiger Zeit wieder verbreitet, dürfte sich Beyers Buch besonders bei jüngeren Lesern empfehlen, die gewohnt sind, in sozialen Medien Konsumprodukte mit Persönlichkeiten in Verbindung gesetzt zu sehen. Dazu passt, dass Beyer besonders hervorhebt, der antike Maler Zeuxis habe seinen Namen mit goldenen Buchstaben in die Mäandermuster seines Gewandes einweben lassen. Derartiges self-fashioning kommt einem heute, im Zeitalter der Markennamen, nur allzu bekannt vor.
Beyer selbst begründet seine Feier der konkreten Leiblichkeit des Künstlers allerdings nicht aus den genannten Kontexten. Er beruft sich vielmehr auf Foucault, der sich in seinem Spätwerk zunehmend zu der Überzeugung bekehrte, dass man die körperliche Verfassung einer Person auch als Ergebnis einer bewussten Sorge des Subjekts um sich selbst ansehen kann. Von diesem Gedanken inspiriert, versteht Beyer die künstlerische Arbeit letztlich als eine Bemühung, das eigene Leben zu "kuratieren", um es zu einem Kunstwerk aus eigenem Recht zu gestalten. Das Kunstwerk wäre dann nicht mehr das materielle Objekt, das vom Künstler geschaffen und der Menge der Kunstwerke hinzugefügt wird. Das Kunstwerk wäre der Künstler selbst, und die Kunst wäre wirklich die Summe der Künstler. Das ist jedoch nur eine utopische Vision, die für Beyers Argumentation nebensächlich ist. Unter den faktischen Gegebenheiten des Kunstsystems gilt weiterhin, dass es keine Kunst gibt, nur einzelne Werke. KARLHEINZ LÜDEKING
Andreas Beyer: "Künstler - Leib - Eigensinn". Die vergessene Signatur des Lebens in der Kunst.
Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2022. 332 S., Abb., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Künstler, Leib und Eigensinn" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.
























