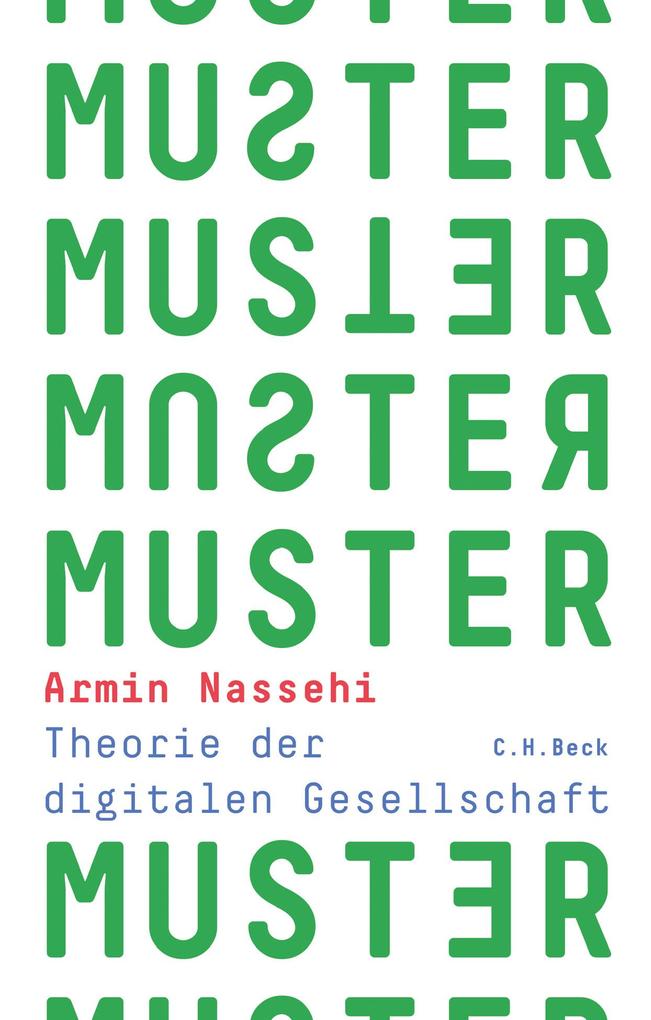
Zustellung: Fr, 02.05. - Mo, 05.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
ARMIN NASSEHIS RADIKALE THEORIE DER DIGITALE GESELLSCHAFT
Wir glauben, der Siegeszug der digitalen Technik habe innerhalb weniger Jahre alles revolutioniert: unsere Beziehungen, unsere Arbeit und sogar die Funktionsweise demokratischer Wahlen. In seiner neuen Gesellschaftstheorie dreht der Soziologe Armin Nassehi den Spieß um und zeigt jenseits von Panik und Verharmlosung, dass die Digitalisierung nur eine besonders ausgefeilte technische Lösung für ein Problem ist, das sich in modernen Gesellschaften seit jeher stellt: Wie geht die Gesellschaft, wie gehen Unternehmen, Staaten, Verwaltungen, Strafverfolgungsbehörden, aber auch wir selbst mit unsichtbaren Mustern um?
Schon seit dem 19. Jahrhundert werden in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften statistische Mustererkennungstechnologien angewandt, um menschliche Verhaltensweisen zu erkennen, zu regulieren und zu kontrollieren. Oft genug wird die Digitalisierung unserer Lebenswelt heutzutage als Störung erlebt, als Herausforderung und als Infragestellung von gewohnten Routinen. Im vorliegenden Buch unternimmt Armin Nassehi den Versuch, die Digitaltechnik in der Struktur der modernen Gesellschaft selbst zu fundieren. Er entwickelt die These, dass bestimmte gesellschaftliche Regelmäßigkeiten, Strukturen und Muster das Material bilden, aus dem die Digitalisierung erst ihr ökonomisches, politisches und wissenschaftliches Kontroll- und Steuerungspotential schöpft. Infolge der Digitalisierung wird die Gesellschaft heute also regelrecht neu entdeckt.
Wir glauben, der Siegeszug der digitalen Technik habe innerhalb weniger Jahre alles revolutioniert: unsere Beziehungen, unsere Arbeit und sogar die Funktionsweise demokratischer Wahlen. In seiner neuen Gesellschaftstheorie dreht der Soziologe Armin Nassehi den Spieß um und zeigt jenseits von Panik und Verharmlosung, dass die Digitalisierung nur eine besonders ausgefeilte technische Lösung für ein Problem ist, das sich in modernen Gesellschaften seit jeher stellt: Wie geht die Gesellschaft, wie gehen Unternehmen, Staaten, Verwaltungen, Strafverfolgungsbehörden, aber auch wir selbst mit unsichtbaren Mustern um?
Schon seit dem 19. Jahrhundert werden in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften statistische Mustererkennungstechnologien angewandt, um menschliche Verhaltensweisen zu erkennen, zu regulieren und zu kontrollieren. Oft genug wird die Digitalisierung unserer Lebenswelt heutzutage als Störung erlebt, als Herausforderung und als Infragestellung von gewohnten Routinen. Im vorliegenden Buch unternimmt Armin Nassehi den Versuch, die Digitaltechnik in der Struktur der modernen Gesellschaft selbst zu fundieren. Er entwickelt die These, dass bestimmte gesellschaftliche Regelmäßigkeiten, Strukturen und Muster das Material bilden, aus dem die Digitalisierung erst ihr ökonomisches, politisches und wissenschaftliches Kontroll- und Steuerungspotential schöpft. Infolge der Digitalisierung wird die Gesellschaft heute also regelrecht neu entdeckt.
- Der Bestseller als Taschenbuch
- Einer der bekanntesten deutschen Soziologen legt seine Gesellschaftstheorie vor
- Eine völlig neue, unerwartete Perspektive auf die Digitalisierung
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Wie über Digitalisierung nachdenken?
Eine techniksoziologische Intuition
Frühe Technologieschübe
Original und Kopie
Produktive Fehlanzeige und Sollbruchstelle
1 Das Bezugsproblem der Digitalisierung
Funktionalistische Fragen
Connecting Data - offline
Was ist das Problem?
Das Unbehagen an der digitalen Kultur
Die digitale Entdeckung der «Gesellschaft»
Empirische Sozialforschung als Mustererkennung
«Gesellschaft» als Digitalisierungsmaterial
Der / die / das Cyborg als Überwindung der Gesellschaft?
2 Der Eigensinn des Digitalen
Die ungenaue Exaktheit der Welt
Der Eigensinn der Daten
Kybernetik und die Rückkopplung von Informationen
Digitalisierung der Kommunikation
Dynamik der Geschlossenheit
Die Selbstreferenz der Datenwelt
3 Multiple Verdoppelungen der Welt
Daten als Beobachter
Verdoppelungen
Störungen
Querliegende datenförmige Verdoppelungen
Die Spur der Spur und diskrete Verdoppelungen
Spuren, Muster, Netze
4. Einfalt und Vielfalt
Medium und Form
Codierung und Programmierung
Die digitale Einfachheit der Gesellschaft
Optionssteigerungen
Sapere aude im Spiegel der Digitalisierung
Exkurs Digitaler Stoffwechsel
5 Funktionierende Technik Die Funktion des Technischen
Digitale Technik
Kommunizierende Technik
Die Funktion des Funktionierens
Niedrigschwellige Technik
Dämonisierte Technik
Unsichtbare Technik und der Turing-Test
Das Privileg, Fehler zu machen
6 Lernende Technik Entscheidungen
Abduktive Maschinen?
Verteilte Intelligenz?
Anthropologische und technologische Fragen
Erlebende und handelnde Maschinen
Unvollständigkeit, Vorläufigkeit, systemische Paradoxien
Künstliche, leibliche, unvollständige Intelligenz
7 Das Internet als Massenmedium Sinnüberschussgeschäfte
Synchronisationsfunktion
Synchronisation und Sozialisation
Selektivität, Medialität und Voice im Netz
Beim Zuschauen zuschauen
Komplexität und Überhitzung
Das Netz als Archiv aller möglichen Sätze
Intelligenz im Modus des Futur 2. 0
8 Gefährdete Privatheit Die Unwahrscheinlichkeit informationeller Selbstbestimmung
Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?
Gefährdungen
Privatheit 1. 0
Privatheit 1. 0 als Ergebnis von Big Data?
Big Data und die Privatheit 2. 0
Privatheit retten?
9 Debug: Die Wiedergeburt der Soziologie aus dem Geist der Digitalisierung Digitale Dynamik und gesellschaftliche Komplexität
Eine Chance für die Soziologie
Anmerkungen
Sachregister
Einleitung
Wie über Digitalisierung nachdenken?
Eine techniksoziologische Intuition
Frühe Technologieschübe
Original und Kopie
Produktive Fehlanzeige und Sollbruchstelle
1 Das Bezugsproblem der Digitalisierung
Funktionalistische Fragen
Connecting Data - offline
Was ist das Problem?
Das Unbehagen an der digitalen Kultur
Die digitale Entdeckung der «Gesellschaft»
Empirische Sozialforschung als Mustererkennung
«Gesellschaft» als Digitalisierungsmaterial
Der / die / das Cyborg als Überwindung der Gesellschaft?
2 Der Eigensinn des Digitalen
Die ungenaue Exaktheit der Welt
Der Eigensinn der Daten
Kybernetik und die Rückkopplung von Informationen
Digitalisierung der Kommunikation
Dynamik der Geschlossenheit
Die Selbstreferenz der Datenwelt
3 Multiple Verdoppelungen der Welt
Daten als Beobachter
Verdoppelungen
Störungen
Querliegende datenförmige Verdoppelungen
Die Spur der Spur und diskrete Verdoppelungen
Spuren, Muster, Netze
4. Einfalt und Vielfalt
Medium und Form
Codierung und Programmierung
Die digitale Einfachheit der Gesellschaft
Optionssteigerungen
Sapere aude im Spiegel der Digitalisierung
Exkurs Digitaler Stoffwechsel
5 Funktionierende Technik Die Funktion des Technischen
Digitale Technik
Kommunizierende Technik
Die Funktion des Funktionierens
Niedrigschwellige Technik
Dämonisierte Technik
Unsichtbare Technik und der Turing-Test
Das Privileg, Fehler zu machen
6 Lernende Technik Entscheidungen
Abduktive Maschinen?
Verteilte Intelligenz?
Anthropologische und technologische Fragen
Erlebende und handelnde Maschinen
Unvollständigkeit, Vorläufigkeit, systemische Paradoxien
Künstliche, leibliche, unvollständige Intelligenz
7 Das Internet als Massenmedium Sinnüberschussgeschäfte
Synchronisationsfunktion
Synchronisation und Sozialisation
Selektivität, Medialität und Voice im Netz
Beim Zuschauen zuschauen
Komplexität und Überhitzung
Das Netz als Archiv aller möglichen Sätze
Intelligenz im Modus des Futur 2. 0
8 Gefährdete Privatheit Die Unwahrscheinlichkeit informationeller Selbstbestimmung
Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?
Gefährdungen
Privatheit 1. 0
Privatheit 1. 0 als Ergebnis von Big Data?
Big Data und die Privatheit 2. 0
Privatheit retten?
9 Debug: Die Wiedergeburt der Soziologie aus dem Geist der Digitalisierung Digitale Dynamik und gesellschaftliche Komplexität
Eine Chance für die Soziologie
Anmerkungen
Sachregister
Produktdetails
Erscheinungsdatum
28. Oktober 2019
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
352
Autor/Autorin
Armin Nassehi
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit 2 Abbildungen
Gewicht
580 g
Größe (L/B/H)
221/147/30 mm
ISBN
9783406740244
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
" Eine fundamentale wissenschaftliche Beschreibung der digitalen Welt. (Nassehi) führt mit exzellenter Denkschärfe vor, was Wissenschaft vermag: Die Legobausteine der digitalen Gesellschaft in den Blick zu nehmen, die Dynamiken wirtschaftlicher Interessen ebenso wie die " Widerständigkeiten" gesellschaftlicher Verharrung. Das ist Aufklärung im besten Sinn.
Frankfurter Rundschau, Thomas Kaspar
" Ohne apokalyptischen Beigeschmack.
Falter, Heinz P. Wassermann
" Der Münchner Soziologieprofessor Armin Nassehi hat seit dem letzten Jahr die Führung unter den deutschen Intellektuellen übernommen.
taz, Peter Unfried
" Für mich das grandioseste Buch über eine digitalisierte Gesellschaft!
ZDF Kultur, Gert Scobel
" Nassehis Analyse kann dabei helfen, sich selbst im verworrenen Geflecht, das sich Gesellschaft nennt, zu verorten.
ZEIT Wissen, Sophie Weller
" Armin Nassehi - einer der meist beachteten Denker der Gegenwart - erklärt, warum die Digitalisierung ein gesellschaftliches Problem löst und unsere ureigensten Strukturen entlarvt.
Die Furche, Brigitte Quint
" Überzeugende und inspirierende Darlegung.
Wiener Zeitung, Gerald Schmickl
" Nassehis Buch ist blendend geschrieben, stellenweise funkelnd polemisch, nie grimmig, mit fein ziseliertem Spott über das Panikorchester kritischer Kollegen.
ZEIT, Thomas Assheuer
" Brillante und erfrischend differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit Künstlicher Intelligenz.
literaturkritik. de, Christophe Fricker
" Weil (Armin Nassehi) systemtheoretisch denkt, geht es ihm darum, wie die Dinge funktionieren. Das hat den Vorteil, dass man auf einmal freie Sicht hat darauf, was die Digitalisierung mit unserer Gesellschaft tatsächlich tut.
Tages-Anzeiger, Pascal Blum
" Wertfrei, soziologisch, gut und angesichts des komplexen Gegenstands leicht verständlich.
Fränkischer Tag
Nassehi hat sein bislang wichtigstes Buch verfasst (. . .) Eine kleine Sensation, denn Muster` folgt mit seiner hermeneutischen Tiefenschärfe den großen Gesellschaftsstudien eines Adorno, Habermas, Luhmann, Bourdieu ( ) Wenn es so klug und unterhaltsam passiert wie hier, könnte Gesellschaftswissenschaft wieder eine echte Leitdisziplin sein.
WELT, Marc Reichwein
" Viele Thesen, viele Hinweise, viel Stoff zum Nachdenken über das wunderlichste und nach wie vor unbegriffene Phänomen unserer Zeit.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Jürgen Kaube
" Eine wunderbare Analyse des Digitalisierungsprozesses. "
Wolfram Eilenberger
" Es ist das Buch der Stunde. ( ) Nassehis Buch ist ein Augenöffner. Ein origineller Theorieansatz, frei von Alarmismus und Allgemeinplätzen.
SRF Kultur, Yves Bossart
" Ein wirklich wichtiges Werk. Wer es liest, wird durch dieses Buch sehr viel klüger.
Deutschlandfunk Kultur, Florian Felix Weyh
" Helles Licht der Aufklärung strahlt aus dem eleganten Buch des deutschen Soziologen Armin Nassehi. "
Falter, Armin Thurnher
" Eine ungemein anregende Diagnose der Gegenwart"
Tagesspiegel
" Sein Buch [macht] eindringlich darauf aufmerksam, wie tief die Gesellschaft bereits von digitalen Strukturen imprägniert ist.
WDR3, Martin Hubert
" Nassehi hat ein interessantes, das philosophische Denken herausforderndes, spannendes Buch geschrieben. Musterhaft!
Philosophie Magazin, Gert Scobel
" So radikal wie originell.
WDR 3, Martin Hubert
" Ein lesenswertes Buch.
Basler Zeitung, Christine Richard
" Ein anspruchsvolles, kluges Buch.
WELT am Sonntag
" Dieses Buch lenkt den Blick weg von der Katastrophenerwartung, hin zur Herausforderung, das grosse Ganze in den Blick zu nehmen. Sein Reiz liegt im Versuch, die Grundfesten der Gesellschaft freizulegen.
Neue Zürcher Zeitung, Martina Läubli
" Die Argumente sind eine aufschlussreiche Ergänzung, um die Erfolgsbedingungen der gegenwärtigen digitalen Entwicklungen nachvollziehen zu können.
socialnet. de, Christoph Schnabel
Frankfurter Rundschau, Thomas Kaspar
" Ohne apokalyptischen Beigeschmack.
Falter, Heinz P. Wassermann
" Der Münchner Soziologieprofessor Armin Nassehi hat seit dem letzten Jahr die Führung unter den deutschen Intellektuellen übernommen.
taz, Peter Unfried
" Für mich das grandioseste Buch über eine digitalisierte Gesellschaft!
ZDF Kultur, Gert Scobel
" Nassehis Analyse kann dabei helfen, sich selbst im verworrenen Geflecht, das sich Gesellschaft nennt, zu verorten.
ZEIT Wissen, Sophie Weller
" Armin Nassehi - einer der meist beachteten Denker der Gegenwart - erklärt, warum die Digitalisierung ein gesellschaftliches Problem löst und unsere ureigensten Strukturen entlarvt.
Die Furche, Brigitte Quint
" Überzeugende und inspirierende Darlegung.
Wiener Zeitung, Gerald Schmickl
" Nassehis Buch ist blendend geschrieben, stellenweise funkelnd polemisch, nie grimmig, mit fein ziseliertem Spott über das Panikorchester kritischer Kollegen.
ZEIT, Thomas Assheuer
" Brillante und erfrischend differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit Künstlicher Intelligenz.
literaturkritik. de, Christophe Fricker
" Weil (Armin Nassehi) systemtheoretisch denkt, geht es ihm darum, wie die Dinge funktionieren. Das hat den Vorteil, dass man auf einmal freie Sicht hat darauf, was die Digitalisierung mit unserer Gesellschaft tatsächlich tut.
Tages-Anzeiger, Pascal Blum
" Wertfrei, soziologisch, gut und angesichts des komplexen Gegenstands leicht verständlich.
Fränkischer Tag
Nassehi hat sein bislang wichtigstes Buch verfasst (. . .) Eine kleine Sensation, denn Muster` folgt mit seiner hermeneutischen Tiefenschärfe den großen Gesellschaftsstudien eines Adorno, Habermas, Luhmann, Bourdieu ( ) Wenn es so klug und unterhaltsam passiert wie hier, könnte Gesellschaftswissenschaft wieder eine echte Leitdisziplin sein.
WELT, Marc Reichwein
" Viele Thesen, viele Hinweise, viel Stoff zum Nachdenken über das wunderlichste und nach wie vor unbegriffene Phänomen unserer Zeit.
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Jürgen Kaube
" Eine wunderbare Analyse des Digitalisierungsprozesses. "
Wolfram Eilenberger
" Es ist das Buch der Stunde. ( ) Nassehis Buch ist ein Augenöffner. Ein origineller Theorieansatz, frei von Alarmismus und Allgemeinplätzen.
SRF Kultur, Yves Bossart
" Ein wirklich wichtiges Werk. Wer es liest, wird durch dieses Buch sehr viel klüger.
Deutschlandfunk Kultur, Florian Felix Weyh
" Helles Licht der Aufklärung strahlt aus dem eleganten Buch des deutschen Soziologen Armin Nassehi. "
Falter, Armin Thurnher
" Eine ungemein anregende Diagnose der Gegenwart"
Tagesspiegel
" Sein Buch [macht] eindringlich darauf aufmerksam, wie tief die Gesellschaft bereits von digitalen Strukturen imprägniert ist.
WDR3, Martin Hubert
" Nassehi hat ein interessantes, das philosophische Denken herausforderndes, spannendes Buch geschrieben. Musterhaft!
Philosophie Magazin, Gert Scobel
" So radikal wie originell.
WDR 3, Martin Hubert
" Ein lesenswertes Buch.
Basler Zeitung, Christine Richard
" Ein anspruchsvolles, kluges Buch.
WELT am Sonntag
" Dieses Buch lenkt den Blick weg von der Katastrophenerwartung, hin zur Herausforderung, das grosse Ganze in den Blick zu nehmen. Sein Reiz liegt im Versuch, die Grundfesten der Gesellschaft freizulegen.
Neue Zürcher Zeitung, Martina Läubli
" Die Argumente sind eine aufschlussreiche Ergänzung, um die Erfolgsbedingungen der gegenwärtigen digitalen Entwicklungen nachvollziehen zu können.
socialnet. de, Christoph Schnabel
 Besprechung vom 25.08.2019
Besprechung vom 25.08.2019
So scheint es zu sein
Der Soziologe Armin Nassehi entdeckt in seinem Buch "Muster" die Gesellschaft anhand der Digitalisierung neu
Von Jürgen Kaube
Die Funktion der Technik ist es, zu funktionieren. Wenn sie es nicht tut, haben Zündhölzer, Korkenzieher und Fernbedienungen einfach keinen Sinn. Zwar gibt es Technik, mit der man auch angeben kann, designte Korkenzieher beispielsweise. Aber solange sie den Korken nicht ziehen, bleibt das Vergnügen an ihrem Ausstellungswert begrenzt. Ein Bugatti, der nicht anspringt, ist nur noch ein Auto, aber kein Mobil mehr.
Der Münchner Soziologe Armin Nassehi legt eine Soziologie der Digitaltechnik vor, die sie von Korkenziehern und Automobilen stark abhebt. Anders als klassische Geräte haben für ihn die digitalen Techniken einen Sinnüberschuss. Korkenzieher öffnen Flaschen, Automobile bringen von hier nach dort. Digitale Korkenzieher - sofern es sie schon gibt - und mit Digitaltechnik vollgestopfte Autos hingegen vernetzen, während sie funktionieren, mit vielen anderen Möglichkeiten jenseits ihres primären Zwecks. Sie melden dem Kühlschrank oder dem digitalen Einkaufszettel, dass gerade Weißwein abfließt, halten Trinkgewohnheiten fest, warnen mittels einer Gesundheits-App, sie suchen Parkplätze, zeigen Restaurants an, informieren den Hersteller über die Fahrwege.
Jedes Handeln hat einen solchen Sinnüberschuss. Er ist nur, in soziologischer Sprache, latent. Heißt: nicht sofort zu sehen. Wir gehen über die Straße und verbrauchen dabei Kalorien, legen Strecken zurück, die sich über den Tag hinweg zu irgendeiner Kilometerzahl aufaddieren, sind auf bestimmten Straßen öfter als auf anderen unterwegs, bewegen uns in Gegenden, in denen es nachts unsicher oder lustig ist, überqueren unterschiedlich riskante Kreuzungen.
Was immer wir tun, heißt das, hat Aspekte, die über den subjektiv gemeinten Sinn des Handelns hinausgehen. Dass sie uns nicht bewusst sind, heißt nicht, dass wir oder der Einzelhandel, die Stadtplanung und die Geheimdienste ihnen keinen Sinn zuordnen können: Verkaufssinn, Planungssinn, Sicherheitssinn, Orientierungssinn und so weiter. Ganze Industrien sind hinter uns und unseren Datenspuren her, um uns Taxifahrten, eine höhere Lebenserwartung, Parkplätze, Leonardo DiCaprio oder Weißwein zu verkaufen. Die Polizei findet manches davon auch interessant, die Wissenschaft sowieso und die Krankenkassen.
Digitale Technologien haben es möglich gemacht, all diese wie nebenbei anfallenden Informationen und ihre etwaigen Sinnüberschüsse zu erfassen. Sie nehmen mehr auf, als wir jemals könnten. Insofern passt für Nassehi die Digitalisierung zur modernen Gesellschaft, weil sich deren Regelmäßigkeiten nur noch mittels solcher datenaufzeichnenden Maschinen ermitteln lassen. Denn modern an dieser Gesellschaft ist, dass es in ihr nur noch sehr wenige eindeutige Ordnungsmuster gibt, sondern vor allem eine Vielzahl von heterogenen Perspektiven und widersprüchlichen Orientierungen. Und eine Unmenge an Informationen, denen nicht auf den ersten analogen Blick anzusehen ist, was man mit ihnen anfangen soll.
Früh schon war beispielsweise die Sozialstatistik auf den Umstand gestoßen, dass individuelles Verhalten kollektive Regelmäßigkeiten ausprägt. Selbstmörder bringen sich aus sehr individuellen, sehr lokalen Gründen um, aber dann wurde festgestellt, dass es Protestanten auffällig häufiger taten als Katholiken. Die Leute heiraten, weil sie sich zuvor verliebt haben, und sie haben sich unter dem Motto "All you need is love" verliebt, aber die Sozialstatistik erweist, dass auch gleiche Bildungsabschlüsse, regionale Herkunft und Konfession eine Rolle spielen.
Für Nassehi heißt Digitalisierung, dass nun jegliche denkbare Information in eine Form gebracht wird, die sie mit anderen Informationen vergleichbar macht und Wahrscheinlichkeitsschlüsse zulässt. Insofern mache sie das gesellschaftliche Geschehen transparenter. Ob das auch in den vielbeschworenen Filterblasen gilt? Wenn es mehrere davon gibt, schon, würde Nassehi vermutlich sagen. Das Internet sagt aus seiner Sicht, anders als Zeitungen, Bücher oder der Funk, nicht: "So ist es" oder vorsichtiger "So scheint es zu sein", sondern: "So scheint es diesem Beobachter zu sein, hier aber ist schon der nächste." Digitale Technologien setzen also nicht alles zu allem in Beziehung, das wäre unergiebig. Aber sie kombinieren viel mehr, prüfen alles auf Muster, sind bereit, alles als Information zu begreifen, und wirken dadurch wie eine apparateförmige Synthese aus Utilitarismus und Romantik.
So weiß die Maschine mehr über uns als wir selbst und auch mehr über die Gesellschaft, als wir jemals ohne sie erheben könnten. Das gilt für Nassehi vor allem für die moderne Gesellschaft, weil diese viel mehr Möglichkeiten zulässt, auf eine Spezialisierung der Arbeit und auf Individualisierung der Welterfahrung setzt. Löst sich also alles in eine fallweise Betrachtung des Sozialen, mithin in Unübersichtlichkeit auf? Die Digitalisierung zeigt Nassehi, wie viel Regelmäßigkeit es doch gibt. Als ein Beispiel dafür verweist er auf seinen eigenen Musikgeschmack, von dem ihm Musikportale zeigen, wie berechenbar er ist und was er als Nächstes hören sollte. Ob der Autor wohl den Einwand zuließe, dass das vielleicht an seinem Musikgeschmack liegt und nicht an der Weisheit der Algorithmen?
Sinnüberschüsse dieser Art bringen jedenfalls denjenigen einen Erkenntnisvorteil, die über möglichst viele Daten verfügen, an denen sich die Muster zeigen. Die digitale Ökonomie, schreibt Nassehi nicht als Erster, tendiere darum zu einer Konzentration auf wenige Spieler. Fast möchte man ihm hier Untertreibung vorwerfen. Denn wenn die Fahrt mit dem Auto auch für die Restaurantbesitzer, das Parkplatz-Management, die Taxizentrale und die Kfz- wie die Einbruchsversicherungen informativ ist, wenn die Tankstellen etwas von dem Wissen über Fahrverhalten hätten und die Autohersteller sowieso - warum sollte es denn dann überhaupt mehr als eine Firma geben, die im Besitz all dieser Daten optimale Investitionsentscheidungen treffen könnte und das günstigste Angebot macht?
Im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts ist das unter Ökonomen einmal kurz diskutiert worden. Damals existierten die heutigen Rechenkapazitäten noch nicht, was Ludwig von Mises einen gewissen Vorteil gegenüber seinem Kontrahenten Oskar Lange gab. Der nämlich meinte, die Wirtschaft in der Hand einer einzigen Firma, der Sozialismus also, sei vor allem ein Kalkulationsproblem. Mises hielt dem entgegen, durch nichts könne die Information des dezentralen Handelns besser verarbeitet werden als durch den Markt, das Auf und Ab seiner Preise. Lange hatte auch 1965, als er "Computer und Markt" schrieb, noch keine Maschine zur Hand, die er dem hätte entgegenstellen können. Heute könnte er für den Einzelhandel die Amazon-Maschine, für das Suchverhalten die Google-Maschine, für das Fahrverhalten die vielen Bordcomputer, für das Essverhalten urbaner Stubenhocker die Lieferando-Maschine und so weiter anführen. Und er könnte die Frage stellen, was aus Effizienzgründen denn dagegen spräche, alle diese Maschinen in einem Großrechner einer Weltfirma zu vereinen. Der chinesische Umgang mit der Datenkontrolle macht allerdings deutlich, dass Effizienz nicht alles ist. Würden wir Wohlstand gegen Freiheit eintauschen, wenn wir einsähen, dass beides nicht zusammenhängen muss?
Armin Nassehi streift diese Frage wie viele andere, die sich angesichts der digitalen Technik stellen. So erörtert er die Eigenschaft des Internets, jeden fast alles sagen zu lassen, was der Sau, die deshalb gerne rausgelassen wird, zu viel Prominenz verhilft. Wenn dreihundert Interessenten sich empören, war es schon ein "Shit-Storm", und die Massenmedien berichten darüber, weil es ihnen passt, dass er stattfand. Dieselben Übertreibungen, die der Buchdruck hervorbrachte, begleiten auch die Digitalisierung, und womöglich ist die Behauptung, mittels digitaler Techniken würde die Gesellschaft transparent, auch nur ein Werbespruch der Datenhändler. Mit anderen Worten: Digitale Technik zeichnet nicht nur auf und wertet aus, sie bringt auch Verhaltensweisen hervor.
Dazu passt es, wenn Nassehi vom Internet als Überhitzungsmaschine spricht. Falsche Informationen werden in den Gesinnungsgemeinschaften auf Twitter schneller prozessiert als richtige und auch schneller als mit jeder anderen Technik, zitiert er eine Studie des MIT. Doch was kühlt die Gesellschaft ab, wenn das Netz sie nervöser macht als je ein Massenmedium zuvor? Nassehi lässt das offen. Vielleicht, weil für ihn die Antwort lautet: "gar nichts". Oder gehört sein Satz "Das Funktionieren ist der Feind der Reflexion" an diese Stelle? Dann wäre Bildung ein auskühlendes Mittel im Umgang mit Technik.
Doch auch hier ist Nassehi skeptisch, weil er Bildung ihrerseits für ein Selbstoptimierungsprogramm hält, das gegenüber Leuten, die digital ihren Konsum, ihr Gesundheitsverhalten und ihre Partnerwahl optimieren, nicht das bessere, weil ruhigere und auf- wie abgeklärtere Dasein repräsentiert. Es werde in der Kritik der digitalisierten Welt oft zu retten versucht, was es gar nie gegeben hat: eine entschleunigte, private, nicht nervöse, vom Kapitalismus und vom Staat nicht erreichbare Lebenswelt.
Mindestens so anregend ist Nassehis Kapitel über eine andere Erhitzung durch das Internet, nämlich über seinen Strombedarf, das für Rezo und seine Behauptung, die Umwelt werde vor allem von den anderen zerstört, leider zu spät kommt. Oder seine Ausführungen über die Zerstörung der Privatheit durch das Einsammeln von Daten. Das Neue an den digitalen Technologien ist für ihn dabei nicht, dass sie die Privatheit transparent machen und insofern entprivatisieren. Neu sei vielmehr, dass Daten ausgewertet werden, die gar nicht für die Zwecke erhoben wurden, denen man sie zuführt. Jemand meint, einfach nur von A nach B zu fahren, aber sein Bewegungsprofil wird einem Datenkunden von Uber als "Nachtfahrer" gemeldet. Jemand benutzt eine App, die das Gesundheitsverhalten registriert, und eine Lebensversicherung oder eine Pharmafirma kauft die entsprechenden Daten.
So neu ist vieles nicht, sagt Nassehi also. Dann aber ist die Digitalisierung doch wieder der einzige Schlüssel, um sowohl die Gesellschaft zu verstehen wie die musikalischen Präferenzen des Soziologen. Der Autor wechselt zwischen Bewunderung, Erschrecken, Skepsis und Freude über die digitalen Maschinen. Das ist gut nachvollziehbar und unterscheidet sich wohltuend von all denen, die sich sicher sind, dass es sich bei der Digitalisierung um etwas bedenkenlos Gutes oder unerhört Schlimmes handelt.
Nassehi möchte anhand der Digitalisierung die Gesellschaft neu entdecken, weil die digitalen Techniken für ihn selbst Techniken der Gesellschaftsentdeckung sind; ihr Einsatz im Bereich der Naturwissenschaften steht hier nicht im Zentrum. Die eine oder andere Passage hat Nassehi mit dem Rücken zu einem Publikum geschrieben, das nicht aus Kollegen besteht, die es interessiert, wie man Shannon, Heidegger, Luhmann, Foucault und Latour miteinander verschrauben kann. Aber wer sich durch solche Passagen nicht erschöpfen lässt und wen auch der eine oder andere Einsatz des Wortes "Ich" - "Die Figur der Verdopplung habe ich das erste Mal 2006 nicht zufällig anlässlich der Beantwortung der Frage entwickelt, warum es Kunst gibt" - nicht vom Weiterlesen abhält, dem bietet dieses Buch viel. Viele Thesen, viele Hinweise, viel Stoff zum Nachdenken über das wunderlichste und nach wie vor unbegriffene Phänomen unserer Zeit.
Armin Nassehi: "Muster - Theorie der digitalen Gesellschaft". Verlag C. H. Beck, 352 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
am 10.04.2020
Spannende und aufschlussreiche Darstellung der Digitalisierung! Armin Nassehi reiht sich nicht in die Katastrophendiagnosen zur Digitalisierung ein, sondern versucht, sich in seiner Analyse über die Vorzüge technischer Entwicklung anzunähern. Trotzdem betont Nassehi auch negative Aspekte und Risiken der Entwicklung. Insgesamt wächst beim Leser ein Grundverständnis für die Funktion der digitalen Welt.
am 14.10.2019
Für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung?
Die zugrundeliegende Frage für dieses Buches ist:
"Für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung?"
(S. 28)
Inhalt:
Buchrückseite:
"Wir glauben, der Siegeszug der digitalen Technik habe innerhalb weniger Jahre alles revolutioniert: unsere Beziehungen, unsere Arbeit und sogar die Funktionsweise demokratischer Wahlen. In seiner neuen Gesellschaftstheorie dreht der Soziologe Armin Nassehe den Spieß um und zeigt jenseits von Panik und Verharmlosung, dass die Digitalisierung nur eine besonders ausgefeilte technische Lösung für ein Problem ist, das sich in modernen Gesellschaften seit jeher stellt: Wie geht die Gesellschaft, wie gehen Unternehmen, Staaten, Verwaltungen, Strafverfolgungsbehörden, aber auch wir selbst mit unsichtbaren Mustern um?"
Umschlaginnenseite:
"Schon seit dem 19. Jahrhundert werden in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften statistische Mustererkennungstechnologien angewandt, um menschliche Verhaltensweisen zu erkennen, zu regulieren und zu kontrollieren. Oft genug wird die Digitalisierung unserer Lebenswelt heutzutage als Störung erlebt, als Herausforderung und als Infragestellung von gewohnten Routinen. Im vorliegenden Buch unternimmt Armin Nassehi den Versuch, die Digitaltechnik in der Struktur der modernen Gesellschaft selbst zu fundieren. Er entwickelt die These, dass bestimmte gesellschaftliche Regelmäßigkeiten, Strukturen und Muster das Material bilden, aus dem die Digitalisierung überhaupt erst ihr ökonomisches, politisches und wissenschaftliches Kontroll- und Steuerungspotential schöpft. Infolge der Digitalisierung wird die Gesellschaft heute also geradezu neu entdeckt."
Inhaltsverzeichnis (gemäß Verlagshomepage):
Vorwort
Einleitung
- Wie über Digitalisierung nachdenken?
- Eine techniksoziologische Intuition
- Frühe Technologieschübe
- Original und Kopie
- Produktive Fehlanzeige und Sollbruchstelle
1 Das Bezugsproblem der Digitalisierung
- Funktionalistische Fragen
- Connecting Data - offline
- Was ist das Problem?
- Das Unbehagen an der digitalen Kultur
- Die digitale Entdeckung der «Gesellschaft»
- Empirische Sozialforschung als Mustererkennung
- «Gesellschaft» als Digitalisierungsmaterial
- Der / die / das Cyborg als Überwindung der Gesellschaft?
2 Der Eigensinn des Digitalen
- Die ungenaue Exaktheit der Welt
- Der Eigensinn der Daten
- Kybernetik und die Rückkopplung von Informationen
- Digitalisierung der Kommunikation
- Dynamik der Geschlossenheit
- Die Selbstreferenz der Datenwelt
3 Multiple Verdoppelungen der Welt
- Daten als Beobachter
- Verdoppelungen
- Störungen
- Querliegende datenförmige Verdoppelungen
- Die Spur der Spur und diskrete Verdoppelungen
- Spuren, Muster, Netze
4. Einfalt und Vielfalt
- Medium und Form
- Codierung und Programmierung
- Die digitale Einfachheit der Gesellschaft
- Optionssteigerungen
- Sapere aude im Spiegel der Digitalisierung
Exkurs Digitaler Stoffwechsel
5 Funktionierende Technik
- Die Funktion des Technischen
- Digitale Technik
- Kommunizierende Technik
- Die Funktion des Funktionierens
- Niedrigschwellige Technik
- Dämonisierte Technik
- Unsichtbare Technik und der Turing-Test
- Das Privileg, Fehler zu machen
6 Lernende Technik
- Entscheidungen
- Abduktive Maschinen?
- Verteilte Intelligenz?
- Anthropologische und technologische Fragen
- Erlebende und handelnde Maschinen
- Unvollständigkeit, Vorläufigkeit, systemische Paradoxien
- Künstliche, leibliche, unvollständige Intelligenz
7 Das Internet als Massenmedium
- Sinnüberschussgeschäfte
- Synchronisationsfunktion
- Synchronisation und Sozialisation
- Selektivität, Medialität und Voice im Netz
- Beim Zuschauen zuschauen
- Komplexität und Überhitzung
- Das Netz als Archiv aller möglichen Sätze
- Intelligenz im Modus des Futur 2.0
8 Gefährdete Privatheit
- Die Unwahrscheinlichkeit informationeller Selbstbestimmung
- Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?
- Gefährdungen
- Privatheit 1.0
- Privatheit 1.0 als Ergebnis von Big Data?
- Big Data und die Privatheit 2.0
- Privatheit retten?
9 Debug: Die Wiedergeburt der Soziologie aus dem Geist der Digitalisierung
- Digitale Dynamik und gesellschaftliche Komplexität
- Eine Chance für die Soziologie
Anmerkungen
Sachregister
Meine Meinung:
Die Sprache des Autos ist an sehr vielen Stellen unnötig verkompliziert.
Vieles von dem Geschriebenen hätte man wesentlich komprimierter vermitteln können; und sehr vieles bleibt immer nur im Allgemeinen, während das Konkrete auf der Strecke bleibt.
Textbeispiel:
"... hätte das erhebliche Konsequenzen für eine soziologische Theorie der Digitalisierung, die nicht einfach Digitalisierungsfolgen und den Modus der Störung durch eine bestimmte Technologie und Technik untersucht, sondern an den Grundfesten der modernen Gesellschaft selbst ansetzt. Und das würde heißen: Wir sehen nicht die Digitalisierung, sondern zentrale Bereiche der Gesellschaft sehen bereits digital. Digitalität ist einer der entscheidenden Selbstbezüge der Gesellschaft." (S. 29)
Fazit: Für mich war dies nichts.









