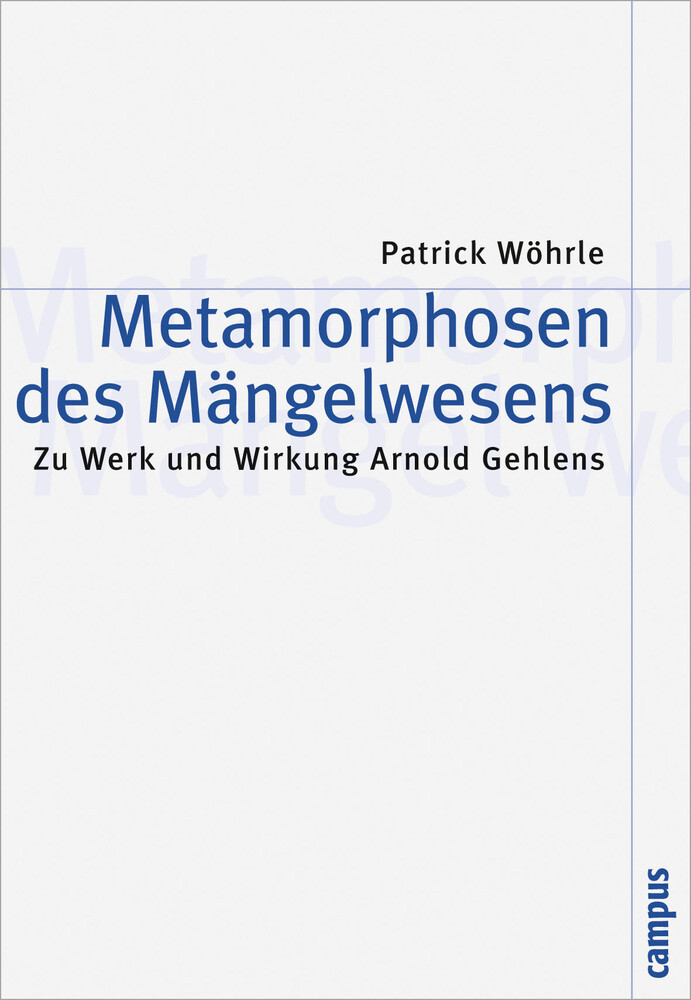
Zustellung: Di, 20.05. - Fr, 23.05.
Versand in 3 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die jüngsten Arbeiten zur wieder verstärkt rezipierten philosophischen Anthropologie haben deren umstrittensten Vertreter, den Philosophen und Soziologen Arnold Gehlen, meist stiefmütterlich behandelt. Auch Untersuchungen zum Einfluss politisch belasteter Autoren auf das intellektuelle Leben der Nachkriegszeit mieden ihn weitgehend. Diese Arbeit schließt eine doppelte Lücke, indem sie - vor allem mit Blick auf überraschend aktuelle handlungstheoretische Einsichten - die analytische Kraft seiner beiden Hauptwerke "Der Mensch" und "Urmensch und Spätkultur" rekonstruiert, ohne deren ideologische Dimensionen zu verschweigen. Daran anschließend wird erstmals die enorme, aber oft verdeckte Wirkung nachgezeichnet, die das so kontroverse Denken Gehlens auf bedeutende Sozialwissenschaftler nach 1945 hatte, unter anderem auf Jürgen Habermas und Niklas Luhmann.
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Einleitung
1. Handlung bei Arnold Gehlen - Schlüsselprinzip oder "Schlüsselattitüde"?
1. 1 Anmerkungen zu Werkgenese und Entstehungskontext, Begründung der Quellenwahl
1. 2 Die Handlung im Horizont der elementaren Anthropologie
1. 2. 1 Kommunikatives Handeln
1. 2. 2 Handeln als Zwecktätigkeit
1. 2. 3 "Irrationale Erfahrungsgewissheiten" - Handlungstheoretische Inkonsistenzen und die Vorbereitung der institutionentheoretischen Fragestellung
1. 3 Die Handlung im Horizont der Institutionenlehre
1. 3. 1 Handeln als Selbstzweck: Gehlens Kritik des Zweck-Mittel-Denkens
1. 3. 2 "Von-den-Dingen-her-Handeln": Die Auslöserwirkung des Gegenstandes
1. 3. 3 Handeln qua Gewohnheit
1. 3. 4 Rituell-darstellendes Handeln
2. Denkmotive, Denkzwänge
2. 1 Selbstentfremdung, Selbstformierung, Selbststeigerung
2. 2 Die Aporien des metafunktionalistischen Blicks
2. 3 Beschädigungen aus dem reflektierten Leben
2. 4 Halbierter Pragmatismus und Dingsozialität
2. 5 Sozialphilosophische und ethische Konsequenzen
3. Wirkungsgeschichte(n) und Wahlverwandtschaften
3. 1 Vorbemerkungen zur Methode und zu den Kriterien der Wirkungsgeschichte
3. 2 Helmut Schelsky: Wegmarken einer Schülerschaft zwischen Popularisierung und Kritik
3. 2. 1 Die Vermittlungsposition Schelskys
3. 2. 2 "Bewusstseinsbedürfnisse" und die Institutionalisierbarkeit der Dauerreflexion
3. 2. 3 Auf der Suche nach Wirksamkeit? Zwischen Popularisierung, Assimilation und Anschlussfähigkeit
3. 2. 4 Vom "Sachzwang" zur "Anti-Soziologie"
3. 3 Die Sprache als Metainstitution? Gehlen, Habermas und die diskursethische Umdeutung der Institutionenlehre
3. 3. 1 Erste Koordinaten der Motivverwandtschaft
3. 3. 2 Mit Gehlens Anthropologie gegen die Dialektik der Aufklärung
3. 3. 3 Der Blick auf Marx durch Gehlens Brille
3. 3. 4 Das Eigenrecht des institutionellen Rahmens
3. 3. 5 "Zwecklos obligatorisches Handeln": Konvergenzen in der phylogenetischen Rekonstruktion kollektiver Moral
3. 3. 6 Zwischen moralischer Alltagsintuition, Dauerreflexion und Letztbegründung
3. 3. 7 Die Sprache als Meta-Institution? Verständigungsinstitutionalismus bei Karl-Otto Apel und Dietrich Böhler
3. 4 Funktionen und Folgen systemtheoretischer Transformation - Die Verwahrscheinlichung des Unwahrscheinlichen bei Gehlen und Luhmann
3. 4. 1 Entlastung und Komplexitätsreduktion
3. 4. 2 Grenzen des Zweck-Mittel-Schemas: Handlungstheoretische Konvergenzen zwischen Gehlens Anthropologie und Luhmanns Organisationssoziologie
3. 4. 3 Trennung des Motivs vom Zweck und Affinitäten des Symbolbegriffs
3. 4. 4 Umschlag in den Selbstzweck
3. 4. 5 Funktionen und Folgen systemtheoretischer Transformation
3. 4. 6 Lässt sich die Institutionalisierung institutionalisieren?
3. 4. 7 Diesseits der Kulturkritik
3. 4. 8 Die Verwahrscheinlichung des Unwahrscheinlichen
3. 5 Die Sozialisation des "Mängelwesens" - Dieter Claessens' Sozialanthropologie
3. 5. 1 Primäre Sozialität und formale Instinktprinzipien oder die phylogenetische Sozialisierung des Mängelwesens
3. 5. 2 "Mittlere Entlastungen" oder die ontogenetische Sozialisierung des Mängelwesens
3. 5. 3 "Bist Du Deutschland?" Die Vermittlung von Konkretem und Abstraktem als motivationales Ursprungsproblem der Institutionen
3. 6 Institutionenanalyse als "kritische Theorie" - Karl-Siegbert Rehberg: Ein Lehrer-Schüler-Verhältnis in stabilisierter Spannung
3. 6. 1 Erkenntnistheoretische Grundreflexionen und die "Perspektive der Betroffenheit"
3. 6. 2 Abstraktion, Autonomisierung, Akkumulation: Merkzeichen einer kritischen Theorie der Institutionen
3. 6. 3 Die "Leitidee" im Kampf um Deutungshoheiten
3. 6. 4 Institutionelle Symbolizität zwischen Transzendierung und Verflüssigung
4. Schlussbetrachtung: Metamorphosen des Mängelwesens
Danksagung
Siglen
Literatur
Personenregister
Einleitung
1. Handlung bei Arnold Gehlen - Schlüsselprinzip oder "Schlüsselattitüde"?
1. 1 Anmerkungen zu Werkgenese und Entstehungskontext, Begründung der Quellenwahl
1. 2 Die Handlung im Horizont der elementaren Anthropologie
1. 2. 1 Kommunikatives Handeln
1. 2. 2 Handeln als Zwecktätigkeit
1. 2. 3 "Irrationale Erfahrungsgewissheiten" - Handlungstheoretische Inkonsistenzen und die Vorbereitung der institutionentheoretischen Fragestellung
1. 3 Die Handlung im Horizont der Institutionenlehre
1. 3. 1 Handeln als Selbstzweck: Gehlens Kritik des Zweck-Mittel-Denkens
1. 3. 2 "Von-den-Dingen-her-Handeln": Die Auslöserwirkung des Gegenstandes
1. 3. 3 Handeln qua Gewohnheit
1. 3. 4 Rituell-darstellendes Handeln
2. Denkmotive, Denkzwänge
2. 1 Selbstentfremdung, Selbstformierung, Selbststeigerung
2. 2 Die Aporien des metafunktionalistischen Blicks
2. 3 Beschädigungen aus dem reflektierten Leben
2. 4 Halbierter Pragmatismus und Dingsozialität
2. 5 Sozialphilosophische und ethische Konsequenzen
3. Wirkungsgeschichte(n) und Wahlverwandtschaften
3. 1 Vorbemerkungen zur Methode und zu den Kriterien der Wirkungsgeschichte
3. 2 Helmut Schelsky: Wegmarken einer Schülerschaft zwischen Popularisierung und Kritik
3. 2. 1 Die Vermittlungsposition Schelskys
3. 2. 2 "Bewusstseinsbedürfnisse" und die Institutionalisierbarkeit der Dauerreflexion
3. 2. 3 Auf der Suche nach Wirksamkeit? Zwischen Popularisierung, Assimilation und Anschlussfähigkeit
3. 2. 4 Vom "Sachzwang" zur "Anti-Soziologie"
3. 3 Die Sprache als Metainstitution? Gehlen, Habermas und die diskursethische Umdeutung der Institutionenlehre
3. 3. 1 Erste Koordinaten der Motivverwandtschaft
3. 3. 2 Mit Gehlens Anthropologie gegen die Dialektik der Aufklärung
3. 3. 3 Der Blick auf Marx durch Gehlens Brille
3. 3. 4 Das Eigenrecht des institutionellen Rahmens
3. 3. 5 "Zwecklos obligatorisches Handeln": Konvergenzen in der phylogenetischen Rekonstruktion kollektiver Moral
3. 3. 6 Zwischen moralischer Alltagsintuition, Dauerreflexion und Letztbegründung
3. 3. 7 Die Sprache als Meta-Institution? Verständigungsinstitutionalismus bei Karl-Otto Apel und Dietrich Böhler
3. 4 Funktionen und Folgen systemtheoretischer Transformation - Die Verwahrscheinlichung des Unwahrscheinlichen bei Gehlen und Luhmann
3. 4. 1 Entlastung und Komplexitätsreduktion
3. 4. 2 Grenzen des Zweck-Mittel-Schemas: Handlungstheoretische Konvergenzen zwischen Gehlens Anthropologie und Luhmanns Organisationssoziologie
3. 4. 3 Trennung des Motivs vom Zweck und Affinitäten des Symbolbegriffs
3. 4. 4 Umschlag in den Selbstzweck
3. 4. 5 Funktionen und Folgen systemtheoretischer Transformation
3. 4. 6 Lässt sich die Institutionalisierung institutionalisieren?
3. 4. 7 Diesseits der Kulturkritik
3. 4. 8 Die Verwahrscheinlichung des Unwahrscheinlichen
3. 5 Die Sozialisation des "Mängelwesens" - Dieter Claessens' Sozialanthropologie
3. 5. 1 Primäre Sozialität und formale Instinktprinzipien oder die phylogenetische Sozialisierung des Mängelwesens
3. 5. 2 "Mittlere Entlastungen" oder die ontogenetische Sozialisierung des Mängelwesens
3. 5. 3 "Bist Du Deutschland?" Die Vermittlung von Konkretem und Abstraktem als motivationales Ursprungsproblem der Institutionen
3. 6 Institutionenanalyse als "kritische Theorie" - Karl-Siegbert Rehberg: Ein Lehrer-Schüler-Verhältnis in stabilisierter Spannung
3. 6. 1 Erkenntnistheoretische Grundreflexionen und die "Perspektive der Betroffenheit"
3. 6. 2 Abstraktion, Autonomisierung, Akkumulation: Merkzeichen einer kritischen Theorie der Institutionen
3. 6. 3 Die "Leitidee" im Kampf um Deutungshoheiten
3. 6. 4 Institutionelle Symbolizität zwischen Transzendierung und Verflüssigung
4. Schlussbetrachtung: Metamorphosen des Mängelwesens
Danksagung
Siglen
Literatur
Personenregister
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
08. März 2010
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
459
Reihe
Theorie und Gesellschaft, 71
Autor/Autorin
Patrick Wöhrle
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
608 g
Größe (L/B/H)
214/142/29 mm
Sonstiges
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur
ISBN
9783593391960
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Bedürftig
"Die enorme, aber häufig verdeckte Wirkung, die Gehlen auf Sozialwissenschaftler nach 1945 hatte, wird höchst ertragreich am Beispiel von Jürgen Habermas und Niklas Luhmann untersucht." (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. 03. 2010)
"Die enorme, aber häufig verdeckte Wirkung, die Gehlen auf Sozialwissenschaftler nach 1945 hatte, wird höchst ertragreich am Beispiel von Jürgen Habermas und Niklas Luhmann untersucht." (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. 03. 2010)
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Metamorphosen des Mängelwesens" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.

































