Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
Ihr Ostergeschenk: 15% Rabatt auf viele Sortimente11 mit dem Code OSTERN15
Jetzt einlösen
mehr erfahren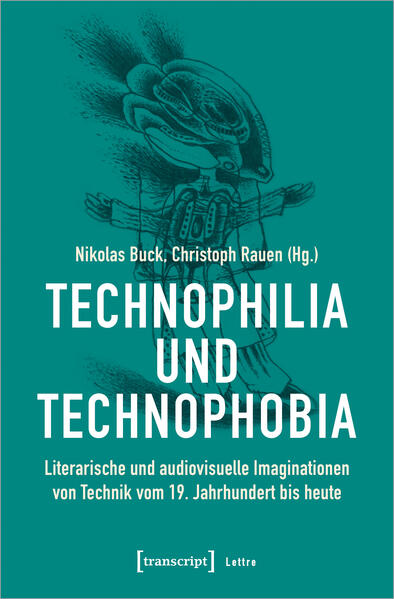
Zustellung: Fr, 04.04. - Mo, 07.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Gestaltung und Kontrollverlust durch Technik: Neue Studien zur wohl größten thematischen und formalen Herausforderung der Kunst in neuerer Zeit.
Spätestens im 19. Jahrhundert wurde die technische Gestaltbarkeit der Welt zu einem bestimmenden Faktor der materiellen und immateriellen Lebensumstände des Menschen. Entsprechend affektstark haben Literatur und später auch Film auf tatsächliche oder behauptete Veränderungen durch Technik reagiert: Das in technischen Erfindungen wurzelnde Angst- und Sehnsuchtspotential wurde poetologisch reflektiert und wirkungsästhetisch genutzt. Die Beiträge der Festschrift für Hans-Edwin Friedrich zeigen, wie die literarische und audiovisuelle Kunst technikbezogene Machbarkeitshoffnungen und dystopische Horrorvisionen sowohl intensiv aufgegriffen als auch in vielfältiger Weise daran mitgearbeitet haben.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
02. September 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
222
Reihe
Lettre
Herausgegeben von
Nikolas Buck, Christoph Rauen
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
4 SW-Abbildungen, 2 Farbabbildungen
Gewicht
356 g
Größe (L/B/H)
221/147/16 mm
Sonstiges
Kt
ISBN
9783837657401
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 01.10.2024
Besprechung vom 01.10.2024
1 Denker
Groß ist die Bandbreite der Emotionen, die Technik wecken kann. Das zeigt der Sammelband "Technophilia und Technophobia" (Transcript Lettre, 222 Seiten, 60 Euro) mit Aufsätzen aus Literatur- und Medienwissenschaft. Der Schwerpunkt liegt auf künstlerischen Technikbildern vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Es geht in den Beiträgen unter anderem um die literarische Reflexion der Eisenbahn, die Beispiele reichen von Justinus Kerner bis Johannes R. Becher. Literatur und Film werden als Spiegel von Phänomenen wie der Technisierung des Wohnens betrachtet, insbesondere seit der Hochmoderne und der Mobilisierung des Musikhörens durch Kofferplattenspieler, Transistorradio und natürlich Autoradio. pts.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Technophilia und Technophobia" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.
































