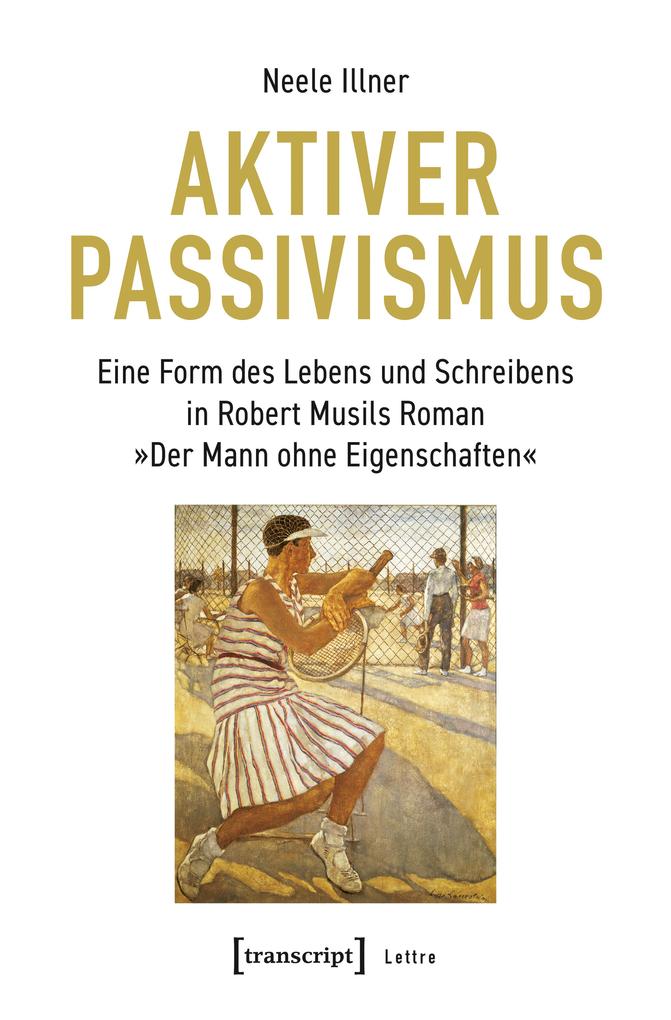
Sofort lieferbar (Download)
Aktiver Passivismus ist Handlungshemmung und spannungsgeladene Lösung - und er ist der Grund dafür, dass in Robert Musils »Mann ohne Eigenschaften« so wenig passiert. Neele Illner zeigt auf, wie sich mit diesem Konzept nicht nur Musils Roman neu lesen, sondern auch ein Begriff des rechten Lebens entwickeln lässt, welches Widersprüche vereint, ohne sie aufzuheben. Dabei erweist sich der aktive Passivismus als Thema, das zahlreiche Denker*innen des 20. und 21. Jahrhunderts - von Hannah Arendt bis Quentin Meillassoux - umtreibt. Als Form des Lebens und der Literatur vermag er den Krieg aufzuhalten und die geschwisterliche Liebe wiederzuentdecken.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
31. Dezember 2022
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
288
Dateigröße
1,70 MB
Reihe
Lettre
Autor/Autorin
Neele Illner
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
PDF
ISBN
9783839464991
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 14.03.2025
Besprechung vom 14.03.2025
Möglichkeitssinn in Krisenzeiten
Robert Musils "Mann ohne Eigenschaften" erklärt den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Er zeigt politische und kommunikative Muster, die noch relevant sind
Obwohl Robert Musil ein Eigenbrötler war, der nicht viel in der Öffentlichkeit verkehrte, war sein Rang schon Zeitgenossen offensichtlich. "Es gibt keinen anderen lebenden deutschen Schriftsteller, dessen Nachruhm mir so bewusst ist", schrieb Thomas Mann, damals schon Literaturnobelpreisträger, dem Kärntner Schriftstellerkollegen. Der "Mann ohne Eigenschaften", sein Hauptwerk, könne sich leicht mit den größten Romanen seiner Zeit messen. "Es ist ein Buch, das die Jahre überdauern wird und in der Zukunft hoch in Ehren stehen wird."
Dieses Urteil hat die Zeit überdauert. Aber hat uns der zweibändige, fast zweitausend Seiten starke, am Ende Torso gebliebene Roman etwas für heute zu sagen? Kann er etwas über die Konflikte des frühen 21. Jahrhunderts lehren? In den zwei Jahrzehnten bis zu seinem Tod im Jahr 1942, in denen er ohne Unterlass daran arbeitete, setzte sich Robert Musil ein Ziel: Er wollte zeigen, wie sich ein geistiger Mensch gegenüber der Gegenwart verhalten soll. Als Gesellschaftsmodell diente ihm Kakanien, sein verballhornter Ausdruck für den Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn, die K.-u.-k.-Monarchie.
"Unter dem Vorwand, das letzte Lebensjahr Österreichs zu beschreiben, werden die Sinnfragen der Existenz des modernen Menschen darin aufgeworfen und in einer ganz neuartigen, aber sowohl leicht-ironischen wie philosophisch-tiefen Weise beantwortet", so hat es Musil in einem Brief an einen Leser formuliert, der in seinen "Gesammelten Werken" abgedruckt ist. Die Hauptfigur Ulrich, der Mann, der sich nicht auf eine berufliche oder soziale Identität festlegen will, deshalb ohne Eigenschaften ist und Möglichkeitssinn, Utopie und Experiment dem Wirklichkeitssinn vorzieht, vereinigt die besten, aber nicht zur Synthese gelangenden Zeitelemente in sich.
Durch seine gesellschaftliche Stellung wird der zweiunddreißig Jahre alte Mathematiker als Sekretär in einen Salon gezogen, der das siebzigste Thronjubiläum des Kaisers Franz Joseph in fünf Jahren vorbereiten soll. Eingeladen sind ranghohe Vertreter der Gesellschaft, des Militärs, des Unternehmertums, aus Kultur und Verwaltung. Sie diskutieren kontroverse, aber stets folgenlose Fragen wie: Friedenskaiser oder Weltösterreich?
Die darin verhandelten Fragen der Wiener Moderne zum Verständnis von Kunst, Wissenschaft und Wirklichkeit seien auch zu seiner Zeit noch relevant gewesen, schrieb der Germanist Helmut Bachmaier im Jahr 1990. Musils Schilderung des raschen Wandels der Lebensverhältnisse und des Untergangs der Habsburgermonarchie durch technische und industrielle Entwicklungen und ihre Reflexion durch gesellschaftliche Strömungen wie Liberalismus, Monarchismus, Nationalismus und progressives Denken gilt als präziseste literarische Beschreibung der Epoche vor dem Ersten Weltkrieg: Für Bachmaier stehen Wertverlust, Traditionsverfall und Sinnvakuum im Zentrum der Reflexion.
Der Salon der Ermelinda Tuzzi, von Ulrich hassliebend zu Diotima umgetauft, wird zum Schauplatz geistesgeschichtlicher Scharmützel. Jeder Bereich gewinne durch Abgrenzung von anderen seine Wirklichkeit und schaffe Misstrauen untereinander, schrieb Ingrid Dreyermann schon 1966 in einer frühen literaturwissenschaftlichen Abhandlung über Musils Roman. Österreich ist wie die Hose, die von ihrem Anzug (Deutschland) getrennt wurde und mit anderer Jacke (Ungarn) harmonieren muss, heißt es an einer Stelle im Roman. "Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum", so schreibt Robert Musil zu Beginn - im sicheren Wissen, dass das Gequassel ohne Mitte seiner Parallelaktion in kürzester Zeit in einen Weltkrieg münden wird. Auch alle Versuche des weichlichen Generals Stumm zu Bordwehr, Ordnung in die divergierenden Positionen zu bringen, sind zum Scheitern verurteilt.
Ulrichs Gegenspieler ist Paul Arnheim, ein preußischer Politiker, Erbe einer Müllunternehmerdynastie, "Gelehrter, Gutsbesitzer, Börsenmann", wie es an einer Stelle heißt. Er vertritt die Auffassung, Kunst vermöge die fehlende Einheit des Daseins herzustellen, Zivilisationsfragen seien mit dem Herzen zu lösen. Er hält sich auf Erholungsurlaub von der Vernunft in Wien auf. Für die verheiratete Diotima, die sich platonisch zu ihm hingezogen fühlt, verkörpert er einen neuen Typus. Ulrich verachtet ihn als Wirklichkeitsmenschen, der für das Experimentelle nichts übrig hat. Trotzdem bietet dieser Ulrich an, in seine Firma einzutreten. Verhindert wird das durch den Tod von Ulrichs Vater, der seinen Lebensinhalt radikal umwirft.
Das folgenlose Geplapper der Parallelaktion, die keine konkrete Aufgabe für sich erspähen kann, findet eine Entsprechung in den aufgeregten und kontroversen Debatten unserer Zeit. Schauplatz ist hier nicht Diotimas Salon, sondern der unmoderierte Diskurs bei X, Threads oder Bluesky. Ewig wiederkehrende Thesen, voller Besserwissereien, aber ohne echten Kitt und ohne Mitte, auf die sich die Teilnehmer verständigen, während Teile der westlichen Welt politisch autoritärer, imperialistischer und protektionistischer werden. Gleichzeitig machen unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit Plattformbetreiber auch die radikalsten Positionen hoffähig.
Und einige der heutigen Grundpositionen finden sich auch im "Mann ohne Eigenschaften": Leo Fischel, der Freihandel und Liberalismus durch Rassentheorien und Straßenschlagworte in Gefahr sieht, ist ein Beispiel. Währenddessen verkehrt seine Tochter Gerda im selben Haus mit den Christgermanen um Hans Sepp, die der Parallelaktion zutrauen, das deutsche Volk geistig zu vernichten. Sein Spott über ihre Ziele mache die Bewegung wütend, gesteht Gerda dem angehimmelten Ulrich. Teilnehmer der Thronjubiläumsorganisation und ihre Gegner ließen sich beliebig durch Twitterprominenz von Elon Musk über Sigmar Gabriel bis Martin Sellner ersetzen. Mit wenigen Anpassungen ergäbe sich ein Sittengemälde unserer Zeit.
Ulrich entzieht sich nach der Wiederbegegnung mit seiner Schwester Agathe zunehmend dem Wiener Geschehen und beginnt mit ihr ein philosophisch-utopisches Experiment, das zwischen Meister Eckhart und Ernst Mach nach geistiger Vereinigung strebt. Er entzieht sich der Aufgabe, während die Extreme in der Parallelaktion unüberbrückbarer werden. "Experiment, Möglichkeitssinn, ergebnisloses Dauergerede und Realitätsverlust sind wichtige Stichworte", sagt der Germanist Helmuth Kiesel: "Die Gesellschaft hat ihren Kompass verloren. Die besten Köpfe - wie Ulrich - sehen keine Möglichkeit zum korrigierenden Eingreifen und beginnen, ihren Individualismus zu pflegen."
Eine interessante Projektionsfläche des Romans ist der darin geschilderte Fall des wegen Prostituiertenmordes inhaftierten Handwerkers Moosbrugger. Verschiedene Figuren des Romans fühlen sich zu seiner rohen Gewalt hingezogen, was als Vorausschau auf die Verheerungen des Krieges zu lesen ist. Ulrichs Freundin Clarisse bemüht sich darum, ihn freizubekommen. Dabei zeichnet sich Moosbrugger durch verminderte Zurechnungsfähigkeit und seine Lust aus, allen den Kopf abzuschlagen. Hier sind Muster zu erkennen, wie in langen Friedenszeiten eine Verklärung roher Gewalt einsetzen kann. Die Fehlinterpretationen des russischen Imperialismus kurz vor dem Angriff auf die Ukraine entsprechen den Wünschen der Romanfiguren, den Mörder durch Zureden zu läutern.
Wir lebten in schnelllebigen Zeiten, sagte die Musil-Forscherin Kathrin Rosenfield vergangenes Jahr in einer Veranstaltung des Roman-Herzog- Instituts. Musils Roman sei eine wunderbare Gelegenheit, sich an komplexerem Denken, Schreiben und Fühlen auszuprobieren. Das wirke wie ein Gegengewicht zu heutigen Praktiken bei Tiktok oder Whatsapp. Arnheim sei reich wie Musk. Und liest man ihn und Ulrich, Fischel und Diotima, Hans Sepp und Gerda, Stumm zu Bordwehr und Clarisse wieder, fühlt man sich allzu oft daran erinnert, dass es nicht nur lohnt, sich mit 1932 zu befassen, sondern auch mit 1913. Philipp Krohn
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Aktiver Passivismus" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.
































